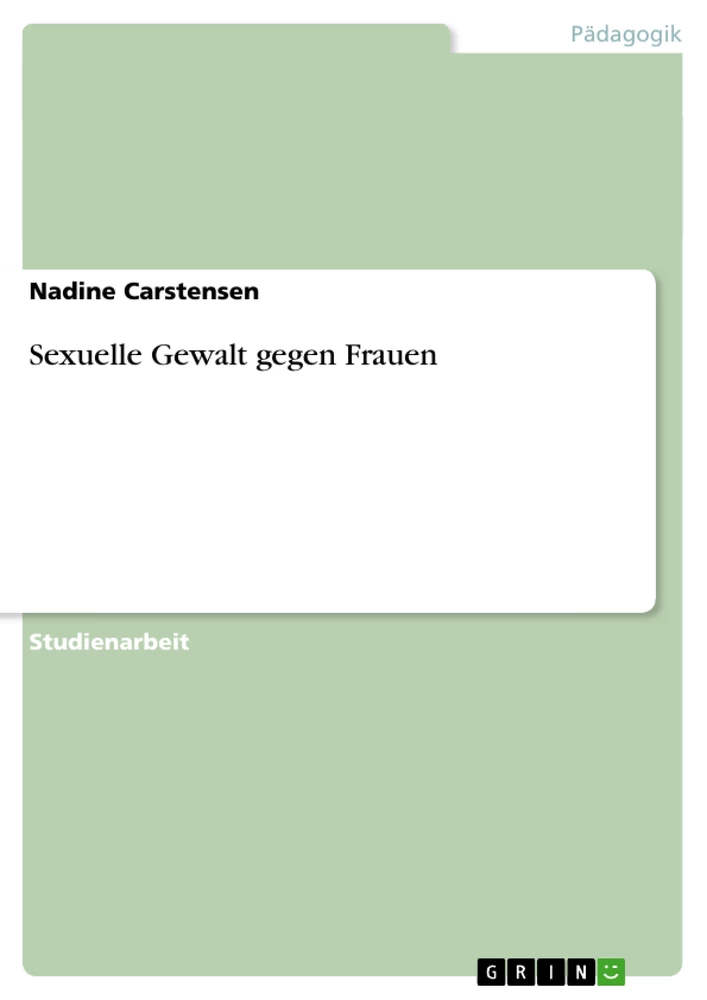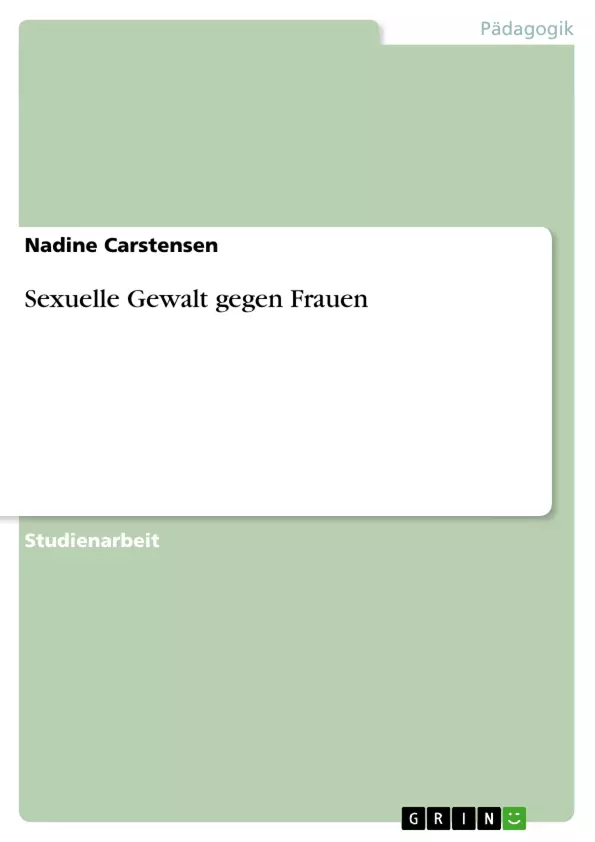Ventil aufgestauter Triebe, Variation eines leidenschaftlichen Liebeslebens, Rachebehauptung einer „frigiden Zicke“, Akt verzweifelter Selbstbehauptung, extreme Äußerungsform von Sexualität ohne Liebe, Mittel zur Destabilisierung des Kriegsgegners, Ausfluß weiblicher Erziehung ohne positives männliches Vorbild, von Frauen im Grunde erwünschtes Männerverhalten, legitimer Abtreibungsgrund unerwünschten Nachwuchses – zwischen solchen Extremen schwankt je nach Blickwinkel des Betrachters die Vorstellung von sexueller Gewaltanwendung gegen Frauen in unserer Gesellschaft. Ein Problembewußtsein ist teilweise vorhanden, hat aber bislang nicht zu systematischen Versuchen einer gesamtgesellschaftlichen Bewältigung geführt, abgesehen von einem ersten Schritt, der Fassung der Paragraphen §§ 176 und 177 im StGB.
Es hat mich daher gereizt, die Ursachen des Phänomens sexuelle Gewalt gegen Frauen in unserer Gesellschaft aufzuspüren, bei denen die anzustrebende Überwindung des Problems ansetzen könnte. Einen Schwerpunkt habe ich bei dem Problembereich sexuelle Gewalt in der Ehe gesetzt, da hier das Problembewusstsein am geringsten entwickelt zu sein scheint. In diesem Bereich wird Gewalt weniger offenbar als bei sexuellen Gewalttaten außerhalb dauerhafter Beziehungen, denn das Opfer selbst deckt den Täter im abgegrenzten Tabu-Bezirk Ehe stärker als außerhalb dieses Schutzwalls für den Täter.
Inhaltsverzeichnis
- Vorüberlegung zum Problemfeld sexuelle Gewalt gegen Frauen
- Sexuelle Gewalt – Begriffsdefinition
- Gesetzliche Grundlagen
- Vergewaltigung und Gesellschaft
- Mitschuld und Selbstvorwurf des Opfers
- Sexualität und Gewalt
- Kulturelle Perspektiven einer Vergewaltigung
- Auswirkungen einer Vergewaltigung auf das Opfer
- Vergewaltigung in der Ehe
- Formen des Zwangs
- Psychische Folgen einer Vergewaltigung
- Physische Folgen einer Vergewaltigung
- Gewalt und Widerstand
- Ursachen für das „Nichtanzeigen“ der Ehemänner
- Die Täter
- Vergewaltigungstypen nach Groth
- Grundsätzliche Persönlichkeitsmerkmale von Vergewaltigern
- Behandlung der Straftäter
- Vergewaltigungstypen nach Groth
- Staatliche Interventionsmaßnahmen
- Sozialpädagogische Interventionsmaßnahmen
- Beratungsstellen
- Frauenhäuser
- Sozialpädagogische Interventionsmaßnahmen
- Ansatzmöglichkeiten zur Dezimierung sexueller Gewalt gegen Frauen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Werk setzt sich mit dem Problemfeld sexueller Gewalt gegen Frauen in unserer Gesellschaft auseinander. Es analysiert die Ursachen für diese Form der Gewalt und beleuchtet die verschiedenen Arten, Folgen und Interventionen.
- Definition und Abgrenzung sexueller Gewalt
- Gesetzliche Grundlagen und gesellschaftliche Wahrnehmung
- Auswirkungen sexueller Gewalt auf die Opfer
- Männer als Täter und Frauen als Opfer
- Interventionen und Präventionsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Problematik sexueller Gewalt gegen Frauen und beleuchtet unterschiedliche Perspektiven auf diese Form der Gewalt. Das zweite Kapitel definiert den Begriff „sexuelle Gewalt" und geht auf gesetzliche Grundlagen sowie auf die gesellschaftliche Wahrnehmung dieser Thematik ein. Es werden verschiedene Formen von sexueller Gewalt vorgestellt. Das dritte Kapitel widmet sich der sexuellen Gewalt in der Ehe und ihren Folgen für die Opfer. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Tätern, ihren Motiven und den verschiedenen Vergewaltigungstypen. Das fünfte Kapitel behandelt staatliche Interventionsmaßnahmen und verschiedene Formen der Unterstützung für die Opfer.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind sexuelle Gewalt, Vergewaltigung, Opfer, Täter, Gesellschaft, Gesetzgebung, Prävention, Intervention, Frauenhäuser, Beratungsstellen und die Auswirkungen auf die Opfer. Die Arbeit beleuchtet die komplexe Problematik der sexuellen Gewalt und untersucht die verschiedenen Faktoren, die zu dieser Form der Gewalt beitragen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist sexuelle Gewalt in der Ehe ein Schwerpunkt dieser Arbeit?
Weil hier das Problembewusstsein oft am geringsten ist und Täter durch den privaten Schutzraum der Ehe häufiger von den Opfern gedeckt werden.
Was sind die rechtlichen Grundlagen bei Vergewaltigung?
Maßgeblich sind die Paragraphen §§ 176 und 177 des Strafgesetzbuches (StGB), die sexuelle Nötigung und Vergewaltigung unter Strafe stellen.
Welche Folgen hat sexuelle Gewalt für die Opfer?
Neben physischen Verletzungen leiden Opfer oft unter schweren psychischen Traumata, Selbstvorwürfen und sozialer Isolation.
Welche Tätertypen gibt es nach Groth?
Groth unterscheidet verschiedene Typen von Vergewaltigern basierend auf ihren Motiven, wie Machtausübung, Wut oder Sadismus.
Welche staatlichen Hilfsmaßnahmen gibt es?
Dazu gehören spezialisierte Beratungsstellen, Frauenhäuser und sozialpädagogische Interventionsprogramme für Opfer und Täter.
- Arbeit zitieren
- Nadine Carstensen (Autor:in), 2005, Sexuelle Gewalt gegen Frauen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35950