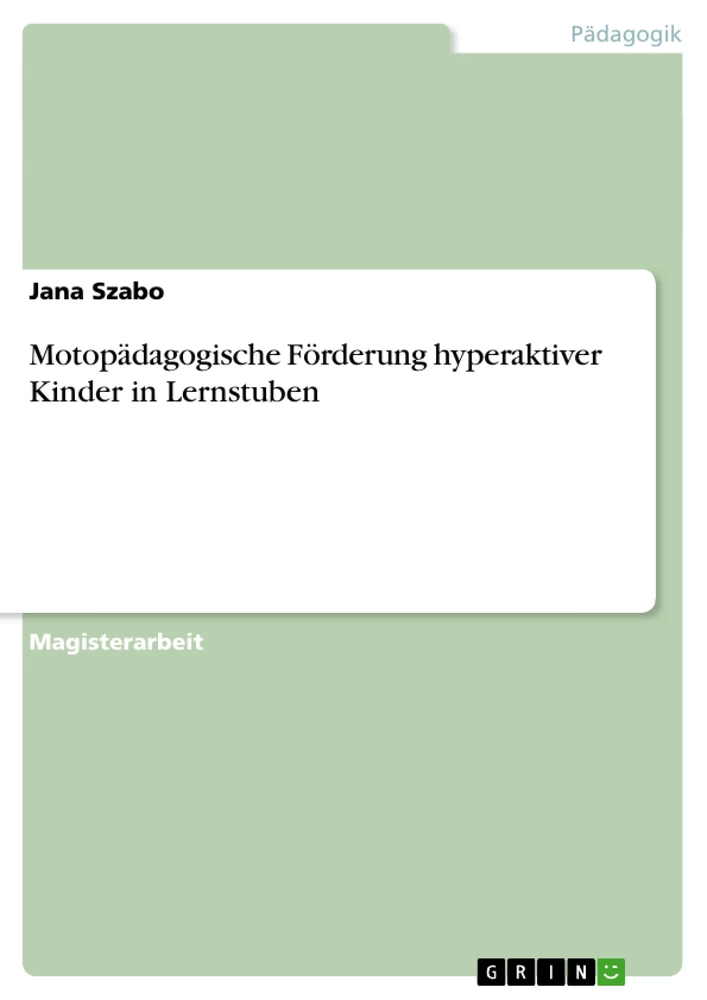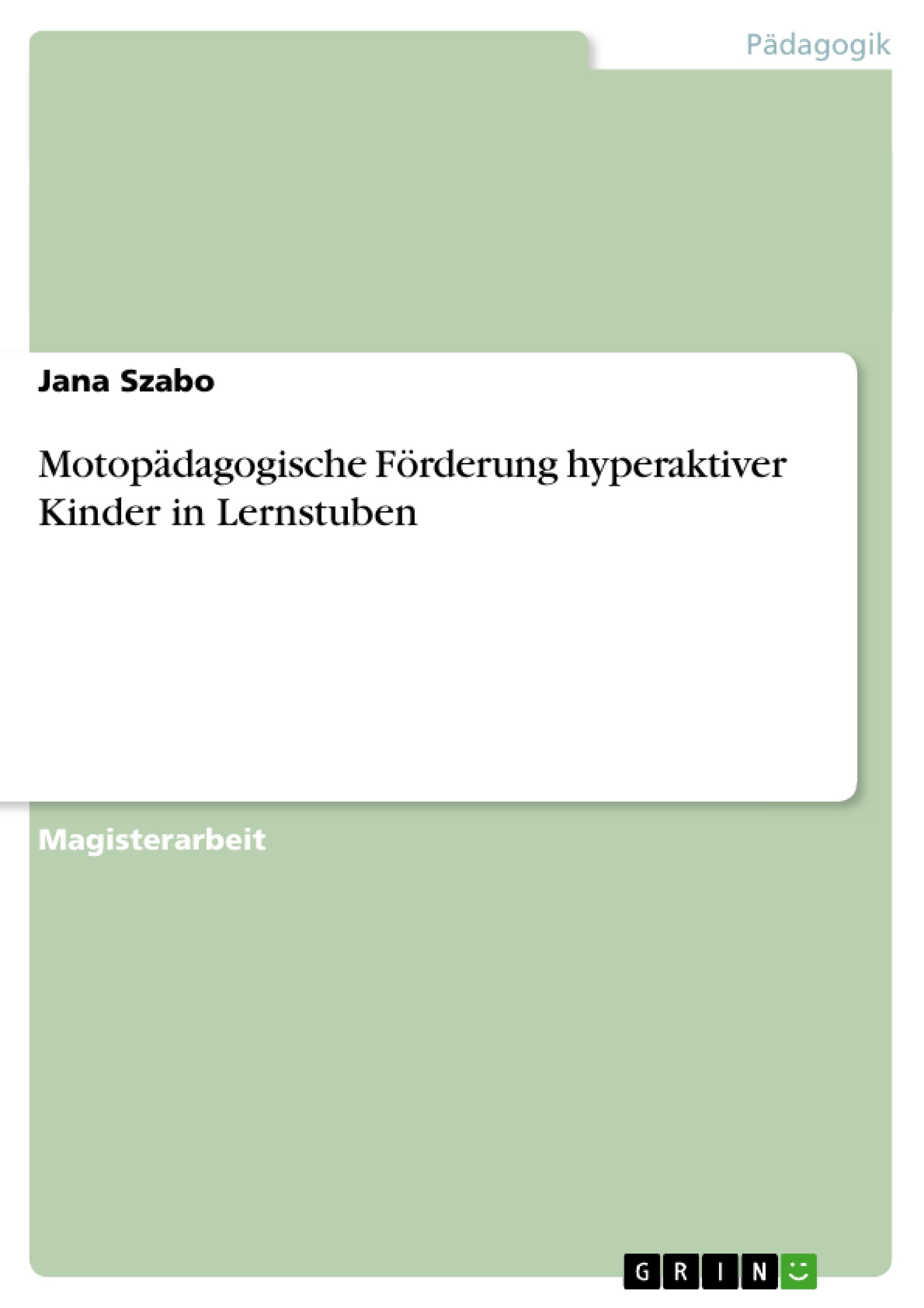[...] Schon bald fielen mir die vielfältigen Probleme der Kinder auf. Die meisten von ihnen kamen aus sozialschwachen Familien. Vor allem das soziale Umfeld trug dazu bei, dass die Kinder auffällig in ihrem Verhalten waren, erhebliche Probleme in der Schule hatten und nur schwer stabile und vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Mitmenschen aufbauen konnten. Auch besuchten verstärkt Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung die Lernstube. Kindheit hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Entweder ist der Tagesablauf eines Kindes bis ins Letzte geplant, so dass ihm keine Zeit bleibt, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Im anderen Extremfall ist das Kind sich selbst überlassen. In beiden Fällen aber sind sie mit der Situation überfordert. Dazu kommt noch die ständige Präsenz der Medien, vor allem Fernsehen und Computer. Soziale Kontakte werden immer mehr eingeschränkt, genauso wie der natürliche Bewegungsdrang der Kinder. Soziale Einrichtungen, wie im vorliegenden Fall die Lernstuben, müssen sich diesen veränderten Bedingungen stellen und im Rahmen der sich bietenden Möglichkeiten einen positiven Beitrag zur Erziehung leisten. Ausgehend von einem ganzheitlichen Menschenbild soll mit der vorliegenden Arbeit eine Möglichkeit aufgezeigt werden, den veränderten Bedingungen der Umwelt von Kindern gerecht zu werden, Störungen im Verhalten zu verhindern bzw. zu kompensieren. Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung, das Basiskonzept der Motopädagogik, als dynamischer Prozess fördert das Kind in seiner Ganzheit, ist Prävention von Fehlentwicklungen und kann durch den Einsatz vielfältiger Methoden, Elemente und Themen zu einer Stabilisierung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes beitragen. Das Vertrauen in eigene Fähigkeiten wird gestärkt, und es setzt sich mit seiner Umwelt auseinander. Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird das Konzept der Lernstuben in Erlangen beschrieben, die Möglichkeiten der Motopädagogik vorgestellt und das Krankheitsbild des ADHS dargestellt. Im praktisch-empirischen Teil soll an einem Fallbeispiel gezeigt werden, wie die motopädagogische Förderung in die Praxis integriert wird. Dabei wird in besonderem Maße auf die Möglichkeiten Wert gelegt, die sich auf Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung beziehen und die für das Konzept zur Umsetzung in die Praxis relevant sind.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- I. Theoretische Grundlagen
- 1. Lernstuben
- 1.1. Was ist eine Lernstube?
- 1.2. Entstehung der ersten Lernstuben in Erlangen
- 1.3. Die Erlanger Lernstuben heute
- 1.4. Die Grundidee der Erlanger Lernstuben
- 1.5. Gesetzliche Rahmenbedingungen der Erlanger Lernstuben
- 1.6. Die Kinder der Erlanger Lernstuben
- 1.6.1 Kinder aus Problemfamilien
- 1.6.2 Kinder alleinerziehender Eltern
- 1.6.3 Kinder ausländischer Herkunft
- 1.7. Ziele der Erlanger Lernstuben
- 1.7.1 Förderung des Selbstwertgefühls
- 1.7.2 Förderung der sozialen Wahrnehmung
- 1.7.3 Förderung der Konflikt- und Handlungsfähigkeit in Konfliktsituationen
- 1.7.4 Förderung der Kooperationsfähigkeit
- 1.7.5 Förderung der Kommunikationsfähigkeit
- 1.7.6 Schulische Förderung
- 1.7.7 Entwicklung eines positiven Körpergefühls
- 1.8. Die Notwendigkeit der Lernstubenarbeit heute
- 2. Die Lernstube in Erlangen-Büchenbach
- 2.1. Tagesablauf in der Lernstube Erlangen-Büchenbach
- 2.2. Arbeitsansatz in der Lernstube Erlangen-Büchenbach
- 2.2.1. Erziehungsplanung
- 2.2.2. Soziales Lernen
- 2.2.3. Familienarbeit
- 2.2.4. Lebensweltansatz
- 2.3. Personal in der Lernstube Erlangen-Büchenbach
- 2.4. Heilpädagogische Arbeit in der Lernstube Erlangen-Büchenbach
- 3. Motopädagogik
- 3.1. Ursprünge der Motopädagogik
- 3.2. Ziele und Inhalte der Motopädagogik
- 3.3. Das Menschenbild in der Motopädagogik
- 3.4. Aspekte der kindlichen Entwicklung
- 3.4.1. Entwicklung der Wahrnehmung
- 3.4.2. Entwicklung der Motorik
- 3.4.3. Entwicklung der Sprache
- 3.4.4. Entwicklung des Selbstkonzepts
- 3.4.5. Soziale Entwicklung
- 3.4.6. Kognitive Entwicklung
- 3.5. Entwicklungsförderung durch Motopädagogik
- 3.5.1. Entwicklungsförderung der Sinne
- 3.5.2. Motorische Entwicklungsförderung
- 3.5.3. Emotionale und soziale Entwicklungsförderung
- 4. Hyperaktivität
- 4.1. Geschichtlicher Hintergrund
- 4.2. Begriffserklärung
- 4.3. Ursachen
- 4.4. Symptome
- 4.4.1. Primärsymptome
- 4.4.2. Sekundärsymptome
- 4.5. Verlauf
- 4.6. Diagnose
- 4.7. Therapie
- 4.7.1. Umfeldbezogene Maßnahmen
- 4.7.2. Kindzentrierte Maßnahmen
- 4.7.3. Multimodale Behandlung
- 4.8. Positive Eigenschaften von Kindern mit ADHS
- II. Empirische Erhebung
- 1. Art der Datenerhebung
- 1.1. Methodisches Vorgehen
- 1.2. Das Erhebungsinstrument: Die Beobachtung
- 2. Auswertung
- 2.1. Aufbau der Einzelförderstunden
- 2.2. Aufbau der Kleingruppenförderstunden
- 3. Entwicklungsbericht
- III. Zusammenfassung
- Die Bedeutung der Lernstubenarbeit für die Entwicklung von Kindern, insbesondere aus sozialschwachen Familien
- Das Konzept der Motopädagogik und ihre Anwendung in der Lernstubenarbeit
- Die Bedeutung der Bewegungsförderung und Wahrnehmungsschulung für die Entwicklung von hyperaktiven Kindern
- Die Herausforderungen und Chancen der Arbeit mit hyperaktiven Kindern in Lernstuben
- Die Rolle der Motopädagogik als Präventions- und Interventionsmaßnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der motopädagogischen Förderung hyperaktiver Kinder in Lernstuben am Beispiel der Grundschullernstube in Erlangen-Büchenbach. Die Arbeit untersucht die Lernstubenarbeit im Allgemeinen und die Möglichkeiten der Motopädagogik, um Kindern mit Auffälligkeiten im Verhalten zu helfen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Motivation für die Themenwahl und die Relevanz der Lernstubenarbeit erläutert werden. Im ersten Teil werden die theoretischen Grundlagen der Lernstubenarbeit dargestellt, darunter die Geschichte der Lernstuben in Erlangen, die pädagogischen Ziele und die Zielgruppen. Der zweite Teil der Arbeit fokussiert auf die Lernstube in Erlangen-Büchenbach, einschließlich des Tagesablaufs, der Arbeitsansätze und des Personals. Im dritten Teil wird die Motopädagogik als ein wichtiges Konzept zur Förderung von Kindern vorgestellt, mit besonderem Schwerpunkt auf die Bedeutung von Bewegung und Wahrnehmung für die kindliche Entwicklung. Der vierte Teil befasst sich mit dem Thema Hyperaktivität, indem er die Geschichte, die Ursachen, Symptome, die Diagnose und die Therapieformen beleuchtet. Der zweite Teil der Arbeit, der die empirische Erhebung beinhaltet, beschreibt die methodischen Ansätze und die Ergebnisse der Beobachtungsstudie in der Lernstube.
Schlüsselwörter
Lernstuben, Motopädagogik, Hyperaktivität, ADHS, Bewegungsförderung, Wahrnehmungsschulung, Entwicklungsförderung, Kinder aus sozialschwachen Familien, Lernförderung, Pädagogische Arbeit, Präventionsmaßnahme, Intervention.
- Quote paper
- Jana Szabo (Author), 2004, Motopädagogische Förderung hyperaktiver Kinder in Lernstuben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35962