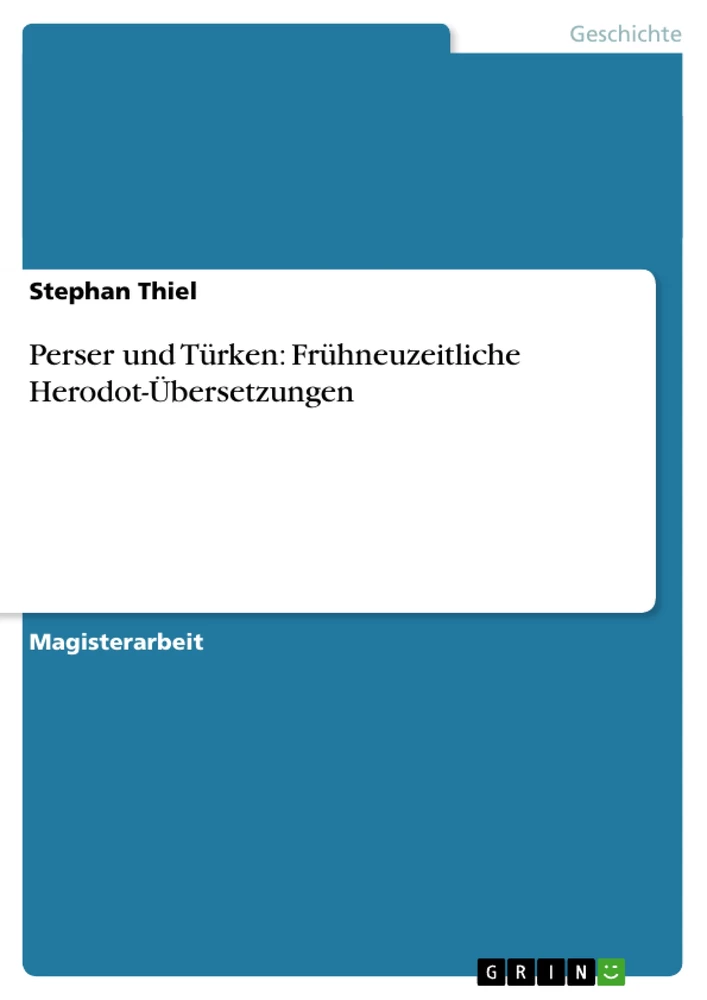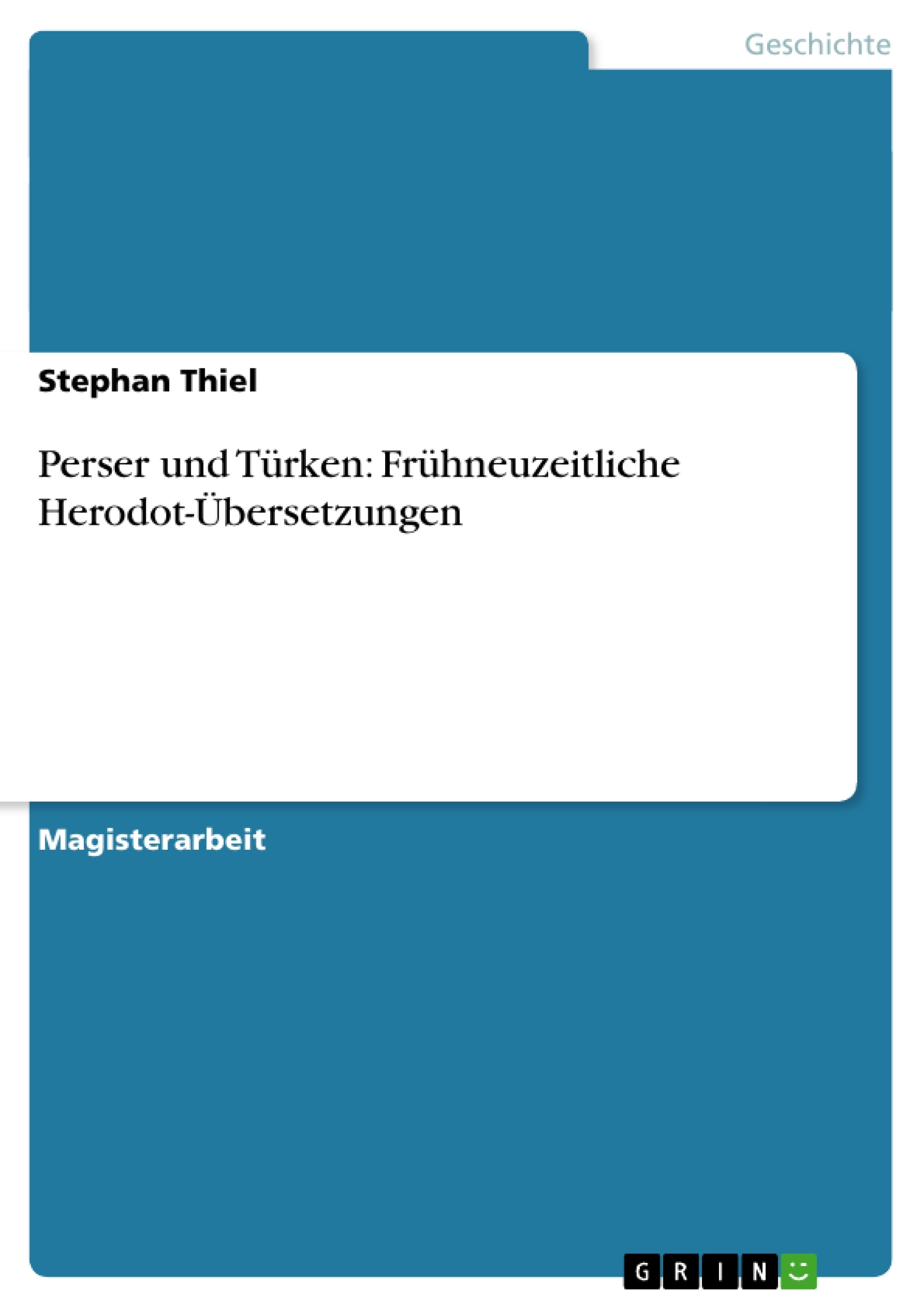Erst kürzlich fiel mir bei der Lektüre eines historischen Fachbuches folgende These des Altertumswissenschaftlers Ernst Kornemann auf: „Die Geschichte des Altertums ist eine Auseinandersetzung der griechisch-römischen Kultur mit dem Iraniertum.“1 Er meinte damit natürlich nicht nur die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Europa und Asien (wie etwa die Abwehrkriege der Griechen im 5.Jahrhundert, der Eroberungszug Alexanders des Großen und - weit später - die Konflikte der Römer mit den Parthern und ihren Nachfolgern), sondern auch kulturelle und soziale Phänomene und Entwicklungen, die durch das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Lebensweisen entstanden. Als einer der wichtigsten Orte des Austausches der Kulturen ist der Schmelztiegel Ionien zu sehen, dessen Lage zwischen griechischem Siedlungsraum und vom asiatischen Brauchtum geprägten Völkern eine rege Kommunikation der Kulturen von vornherein bedingte. So war die ionische Weltauffassung seit jeher eine der Aufgeschlossenheit gegenüber verschiedenartigsten Tendenzen und Formen der Lebensführung und nicht zufälligerweise ist schon bei Herodot (der ja dem ionischen Raum entstammt) die Auseinandersetzung mit den Kulturen deutlich erkennbar. Doch nicht nur in der griechischen Geschichte läßt sich immer wieder die gegenseitige Beeinflussung von Europa und Asien feststellen. So tauchen auch im antiken Rom immer wieder Phänomene aus dem asiatischen Raum auf. Man denke nur daran, daß gerade im dritten Jahrhundert vermehrt Personen aus dem asiatischen Gebiet bis zum Kaisertum aufstiegen und sogar ehemalige kriegsgefangene Sklaven in einflußreiche Positionen kamen. Als weiteres Beispiel sei noch die Euphorie genannt, die das Auftauchen des kleinasiatischen Kybele-Kultes in Rom während des zweiten Punischen Krieges bewirkte. Trotzdem scheint es mir alles in allem doch angebracht, die These Ernst Kornemanns mit etwas Vorsicht zu genießen, da sie die Bedeutung anderer wichtiger Ereignisse des Altertums völlig außer acht läßt. Seine Behauptung klammert nämlich unter anderem die gesamte westliche und südliche Expansion der römischen Welt aus (z.B. Punische Kriege, Gallische Kriege oder die Eroberung Britanniens), genauso wie innere Entwicklungen, die ohne Zweifel nicht durch das Iraniertum beeinflusst wurden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung: Parallelen zwischen den Türken der Frühen Neuzeit und den antiken Persern - Grundlagen, Ziele und Fragestellung der Arbeit
- B Hauptteil: Perser und Türken - Frühneuzeitliche Herodot-Übersetzungen
- 1. Geschichtliche Grundlagen aus der Zeit der Übersetzungen
- 1.1. Die türkischen Kriegszüge bis zum Ende des 16.Jahrhunderts
- 1.2. Türkenbild und Formen der antitürkischen Propaganda im 16.Jahrhundert
- 1.2.1. Die Haltung der Protestanten
- 1.2.2. Formen der antitürkischen Propaganda
- 1.2.3. Das Türkenbild der Reichsbevölkerung
- 2. Das Geschichtswerk Herodots
- 2.1. Die Rezeption Herodots in der Frühen Neuzeit
- 2.2. Herodots Perserbild
- 3. Die frühneuzeitlichen Herodot-Übersetzungen
- 3.1. Biographische Betrachtung der Übersetzer und der Drucker
- 3.1.1. Die Übersetzung von Hieronymus Boner
- 3.1.2. Die Übersetzung von Schwartzkopff
- 3.2. Die Widmungsvorreden
- 3.2.1. Die Dedicationen
- 3.2.2. Die Vorreden
- 3.3. Allgemeine Vorbemerkungen zu den Übersetzungen
- 3.3.1. Die Übersetzungstechnik
- 3.3.2. Die Übernahme frühneuzeitlicher Denkstrukturen
- 3.4. Perser und Griechen in den frühneuzeitlichen Übersetzungen
- 3.4.1. Die Komprimierung des Textes durch Boner
- 3.4.2. Die Darstellung der Perser und der Großkönige
- a) Boner
- b) Schwartzkopff
- 3.4.3. Die Darstellung des persischen Hellasfeldzuges
- a) Boner
- b) Schwartzkopff
- 3.1. Biographische Betrachtung der Übersetzer und der Drucker
- C Schluß: Die frühneuzeitlichen Herodot-Übersetzungen - Reine Übertragungen oder verdeckte Propaganda ?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die frühneuzeitlichen Übersetzungen des Geschichtswerks Herodots mit einem besonderen Fokus auf die Darstellung der Perser und Türken. Das Ziel ist es, die Parallelen zwischen den Perserbildern Herodots und dem Türkenbild der Frühen Neuzeit herauszuarbeiten und die Bedeutung dieser Übersetzungen für das Verständnis des damaligen Weltbildes und der europäischen Wahrnehmung des Orients zu beleuchten.
- Die politischen und kulturellen Zusammenhänge zwischen den Türken und den antiken Persern
- Die Rolle der Herodot-Übersetzungen in der antitürkischen Propaganda
- Die Darstellung von Persern und Türken in den Übersetzungen und ihre Auswirkungen auf die europäische Vorstellungswelt
- Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Übersetzungsstrategien der verschiedenen Übersetzer
- Die Rezeption Herodots in der Frühen Neuzeit und seine Bedeutung für das Selbstverständnis Europas
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar, indem sie die These Ernst Kornemanns zum Ringen zwischen griechisch-römischer Kultur und dem Iraniertum diskutiert und Parallelen zwischen den antiken Persern und den Türken der Frühen Neuzeit aufzeigt. Der Hauptteil beleuchtet die geschichtlichen Hintergründe der Übersetzungen und untersucht das Geschichtswerk Herodots, insbesondere sein Perserbild. Anschließend wird die Arbeit auf die frühneuzeitlichen Übersetzungen von Hieronymus Boner und Schwartzkopff eingehen, ihre Biographien beleuchten und die Widmungsvorreden analysieren. Des Weiteren werden die Übersetzungsstrategien und die Darstellung von Persern und Griechen in den Übersetzungen detailliert betrachtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Herodot, Perser, Türken, Frühneuzeit, Übersetzungen, antitürkische Propaganda, Orient, Europa, Geschichte, Kultur, Weltbild, Rezeption, Geschichtsbild.
Häufig gestellte Fragen
Welche Parallelen zieht die Arbeit zwischen antiken Persern und frühneuzeitlichen Türken?
Die Arbeit untersucht, wie das Perserbild in den Herodot-Übersetzungen des 16. Jahrhunderts genutzt wurde, um Parallelen zur damaligen „Türkengefahr“ und zur antitürkischen Propaganda zu ziehen.
Welche Rolle spielten Herodot-Übersetzungen in der Frühen Neuzeit?
Sie dienten nicht nur der Wissensvermittlung, sondern oft auch als Instrumente zur Formung eines europäischen Selbstverständnisses gegenüber dem Orient.
Wer waren die wichtigsten Übersetzer, die in der Arbeit behandelt werden?
Die Arbeit analysiert insbesondere die Übersetzungen von Hieronymus Boner und Schwartzkopff.
Was war das Ziel der antitürkischen Propaganda im 16. Jahrhundert?
Ziel war es, die Reichsbevölkerung gegen die türkischen Kriegszüge zu mobilisieren, wobei oft religiöse und kulturelle Feindbilder genutzt wurden.
Wie wurde der Text von Herodot in den Übersetzungen angepasst?
Übersetzer wie Boner komprimierten den Text oder übernahmen frühneuzeitliche Denkstrukturen, um die antiken Inhalte für die zeitgenössischen Leser relevanter zu machen.
Was besagt die These von Ernst Kornemann zum Iraniertum?
Kornemann behauptete, die Geschichte des Altertums sei primär eine Auseinandersetzung zwischen griechisch-römischer Kultur und dem Iraniertum, eine Sichtweise, die in der Arbeit kritisch hinterfragt wird.
- 1. Geschichtliche Grundlagen aus der Zeit der Übersetzungen
- Quote paper
- Stephan Thiel (Author), 1999, Perser und Türken: Frühneuzeitliche Herodot-Übersetzungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35976