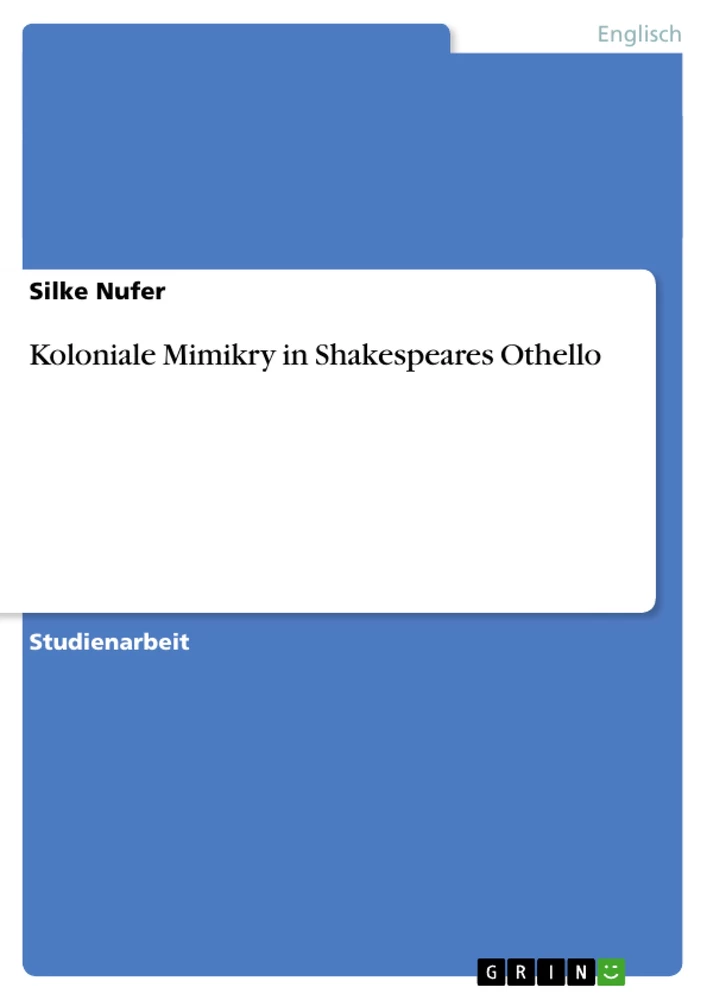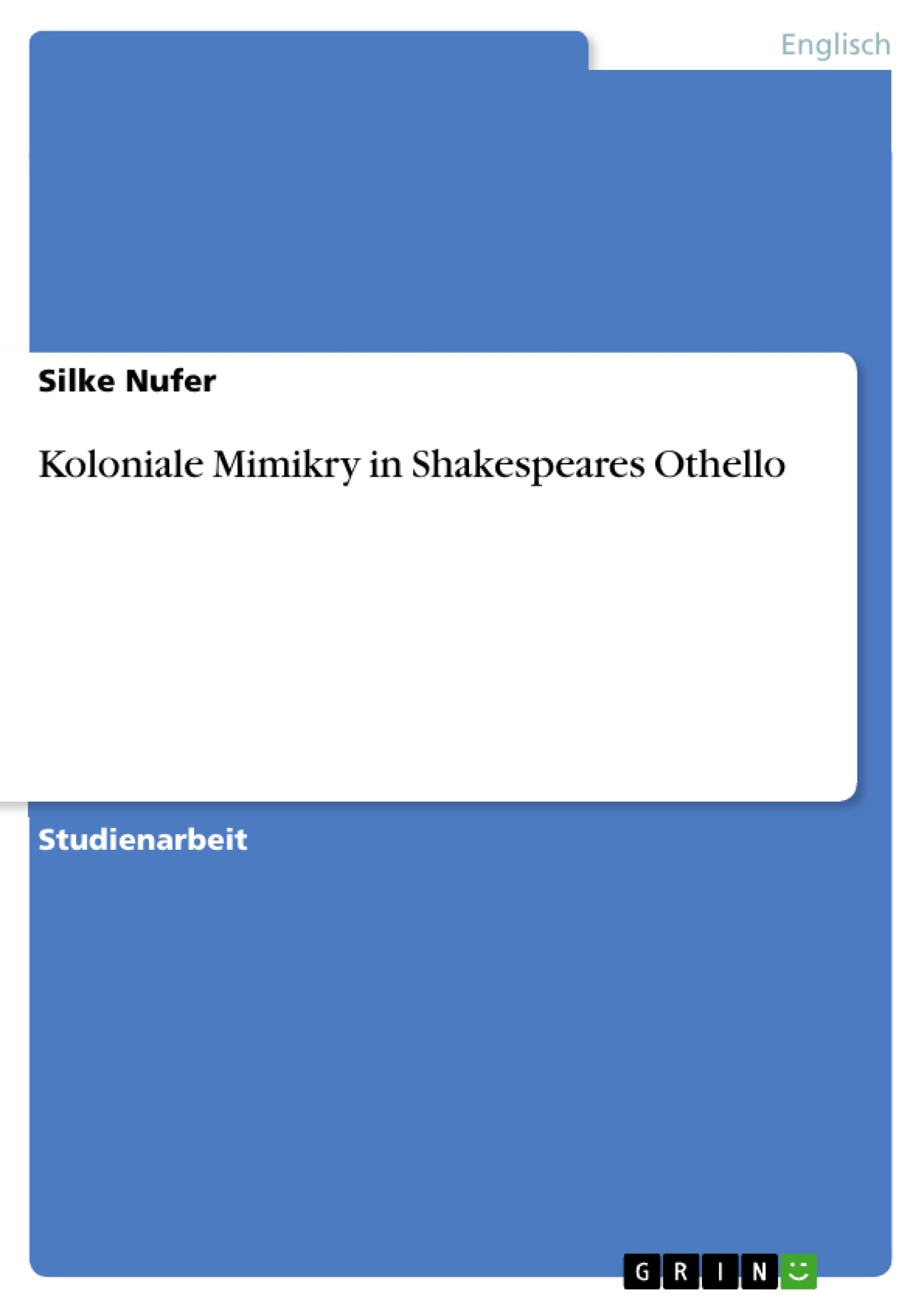Vielleicht ist Shakespeares Werk „Othello, the moor from Venice“, welches in den Anfängen der Kolonialzeit entstand, im Hinblick auf den aktuellen kolonialen Diskurs gerade deshalb so interessant, da in der Entstehungszeit des Werkes der Grundstein für jeglichen kolonialen Diskurs gelegt wurde. England war zu einer bedeutenden Seemacht aufgestiegen und das Empire begann, sich auszudehnen. Neue Kolonien wurden erobert und einige der Kolonisierten wurden als Arbeitskräfte nach England gebracht. Der Umgang mit den kolonialisierten Menschen wurde einerseits von einem Gefühl der kulturellen Überlegenheit und gleichzeitig von Neugier und Furcht beherrscht. Man wollte die fremden Völker und ihre Kulturen erforschen, unzählige Reiseberichte der Renaissancezeit dokumentieren diese Etappe der Geschichte und liefern Einblicke über den Kontakt und die Einstellung der Kolonialmächte gege nüber den Kolonisierten in jener Zeit.
Verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen stimmen darin überein, dass der dominante Diskurs von Shakespeares Kultur bezüglich Annahmen von Hautfarbe und fremden Sitten ethnozentrisch war. Die Diskurse sind nicht einstimmig, ob Shakespeare selbst diese Annahmen teilte. Bei allen Kritikern herrscht Einigkeit über Stereotypisierung der kolonisierten Völker. Nichtübereinstimmung herrscht bezüglich der Auswertung dieser Stereotypisierung. (Vaughan 64) Im Kontrast zum kolonialen Diskurs des 18. und 19. Jahrhunderts war die Mimikry des 16. Jh. nicht betroffen von der konfliktgeladenen Ökonomie des kolonialen Diskurses, welche Edward Said als Spannung zwischen der synchronischen panoptischen Vision der Beherrschung - dem Bedürfnis nach Identität, Stasis - und dem Gegendruck der Diachronie der Geschichte - Veränderung, Differenz beschreibt (Said, 240) In der Renaissance wurde die Geschichte nicht als allumfassendes Konzept des ‚Ursprungs’, der Entwicklung und unvermeidlicher historischer Natur von allem und jedem Geschehen gesehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziel der Arbeit
- Die europäische Überlegenheit
- Schwarze im England des 16. Jahrhunderts
- Die partielle Kolonisation
- Die Terminologie race im 16. Jahrhundert
- Kurzer Abriss der Geschichte des Rassismus
- Die Interpretation schwarzer Hautfarbe
- wissenschaftliche Erklärung der schwarzen Hautfarbe
- religiöse Interpretation der schwarzen Hautfarbe
- Die Bedeutung des bibelorientierten Weltkonzepts
- Das Konstrukt des Anderen
- Die Farbensymbolik von Schwarz
- Der orientalistische Split
- Das Konstrukt des Anderen im kolonialistischen und orientalistischem Diskurs
- Schwarz/Weiß Gegensätze im Stück: ist das Stück rassistisch?
- Mimikry als Diskurs „,zwischen den Zeilen”.
- Die Sichtbarkeit der Mimikry
- Die Offstage-Handlung
- Das Hochzeitsbett
- Die Offstage-Handlung in Othello als Diskurs zwischen den Zeilen
- Die Rolle des Fetisches
- Die Tragödie um das Taschentuch
- Das Bindeglied zwischen Femininität und dem Monströsen
- Othellos Tragödie: Das Taschentuch als feminine Trivialität
- Der Verlust der Magie des Taschentuchs
- Definition des Begriffs, Fetisch' nach Pietz
- Die Fetischisierung und Ent-Fetischisierung des Taschentuchs
- Der Fetisch als Teil-Objekt
- Die Tragödie um das Taschentuch
- Othello als mimic man
- Shakespeares und Bhabas Chamäleon-Menschen
- Othellos zwiespältiges Selbstkonzept
- Desdemona als Garantie für gesellschaftliche Akzeptanz
- Othellos Persönlichkeitsspaltung
- Othello als Quelle und Objekt einer endlosen textuellen Produktion
- Hat Othello seine Identität verloren?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Shakespeares „Othello“ im Kontext der kolonialen Mimikry und untersucht, wie sich diese im Stück manifestiert. Dabei wird die Ambivalenz des kolonialen Diskurses in der Renaissance und der Bedeutung von Zeichen, Personen und Besitz für die Darstellung der Mimikry im Stück beleuchtet.
- Koloniale Mimikry in der Renaissance
- Die Darstellung des „Anderen“ in Shakespeares „Othello“
- Die Rolle von Zeichen, Personen und Besitz in der kolonialen Mimikry
- Die Bedeutung der Hautfarbe und sozialer Stand für die Konstruktion von Identität
- Die Ambivalenz des kolonialen Diskurses
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik der kolonialen Mimikry in Shakespeares „Othello“ ein und stellt die historische und kulturelle Bedeutung des Werkes im Kontext der frühen Kolonialzeit heraus.
- Das zweite Kapitel widmet sich dem Ziel der Arbeit und erläutert den Ansatz der Analyse anhand der Terminologie Homi Bhabas.
- Im dritten Kapitel wird die europäische Überlegenheit im England des 16. Jahrhunderts beleuchtet. Es werden die Lebensbedingungen von Afrikanern in England und die Befürchtungen der weißen Bevölkerung hinsichtlich einer möglichen „Verschmutzung“ durch die „farbige“ Rasse dargestellt.
- Kapitel vier befasst sich mit der Entstehung des Rassendiskurses im 16. Jahrhundert und der Bedeutung des Begriffs „race“ in dieser Zeit.
- Das fünfte Kapitel analysiert das Konstrukt des „Anderen“ im kolonialistischen und orientalistischem Diskurs. Es werden die Bedeutung der Farbensymbolik von Schwarz und der orientalistische Split thematisiert.
- Kapitel sechs erörtert die Bedeutung der Mimikry als Diskurs „zwischen den Zeilen“ und untersucht die Sichtbarkeit der Mimikry in der Handlung des Stückes.
- Im siebten Kapitel wird die Rolle des Fetischs und des Taschentuchs im Stück analysiert. Es werden die Verbindung zwischen Femininität und dem Monströsen, sowie die Tragödie Othellos durch die Fetischisierung des Taschentuchs beleuchtet.
- Kapitel acht beschäftigt sich mit Othello als „mimic man“ und untersucht Shakespeares und Bhabas Konzept des Chamäleon-Menschen.
Schlüsselwörter
Koloniale Mimikry, Rassismus, Hautfarbe, Identität, Othello, Shakespeare, Renaissance, England, Fetisch, Orientalismus, Ambivalenz, Diskurs, postkolonial, postmoderne, Zeichen, Personen, Besitz.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „koloniale Mimikry“ in Bezug auf Othello?
Mimikry beschreibt das Phänomen, bei dem der Kolonialisierte (Othello) versucht, die Kultur der Kolonialmacht (Venedig/England) nachzuahmen, dabei aber nie vollständig akzeptiert wird.
Wie wurde schwarze Hautfarbe im 16. Jahrhundert interpretiert?
Die Interpretation war oft bibelorientiert oder pseudowissenschaftlich und verknüpfte dunkle Hautfarbe häufig mit negativen moralischen Eigenschaften.
Welche Rolle spielt das Taschentuch in der Analyse?
Das Taschentuch fungiert als „Fetisch“, der als Bindeglied zwischen Othellos Identität, seiner Herkunft und seinem Untergang steht.
Ist Shakespeares „Othello“ ein rassistisches Stück?
Die Arbeit untersucht die Schwarz-Weiß-Gegensätze und fragt, ob das Stück rassistische Vorurteile der Renaissance bedient oder diese durch Othellos Charakter hinterfragt.
Warum wird Othello als „mimic man“ bezeichnet?
In Anlehnung an Homi Bhabha wird Othello als jemand analysiert, der zwischen zwei Kulturen steht und dessen Identität durch diese Spaltung bedroht ist.
- Quote paper
- Silke Nufer (Author), 2002, Koloniale Mimikry in Shakespeares Othello, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35995