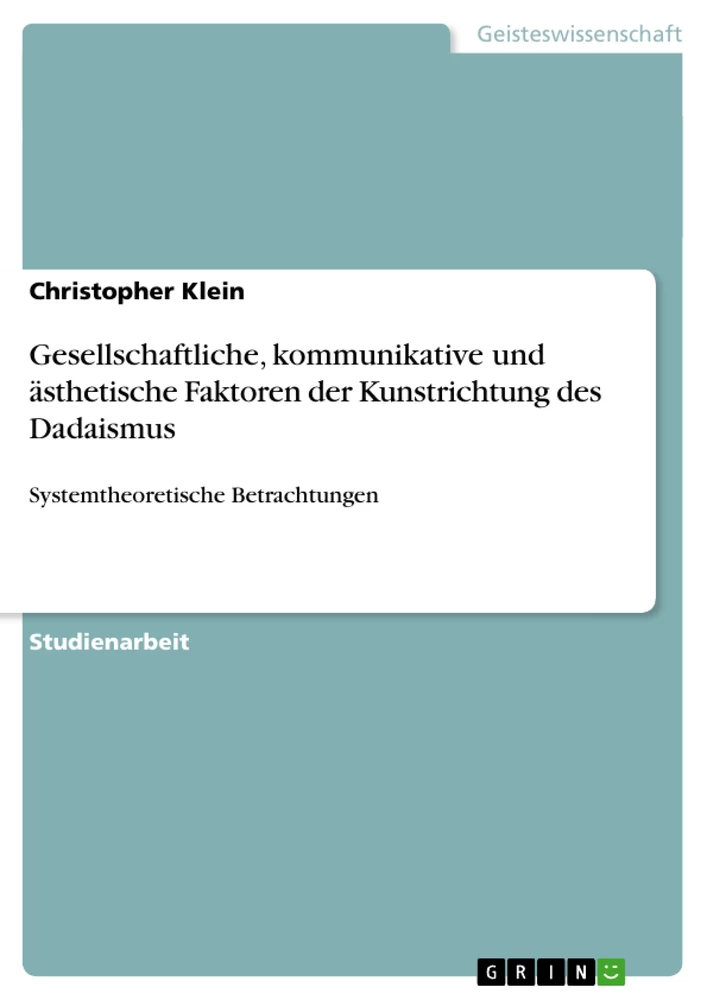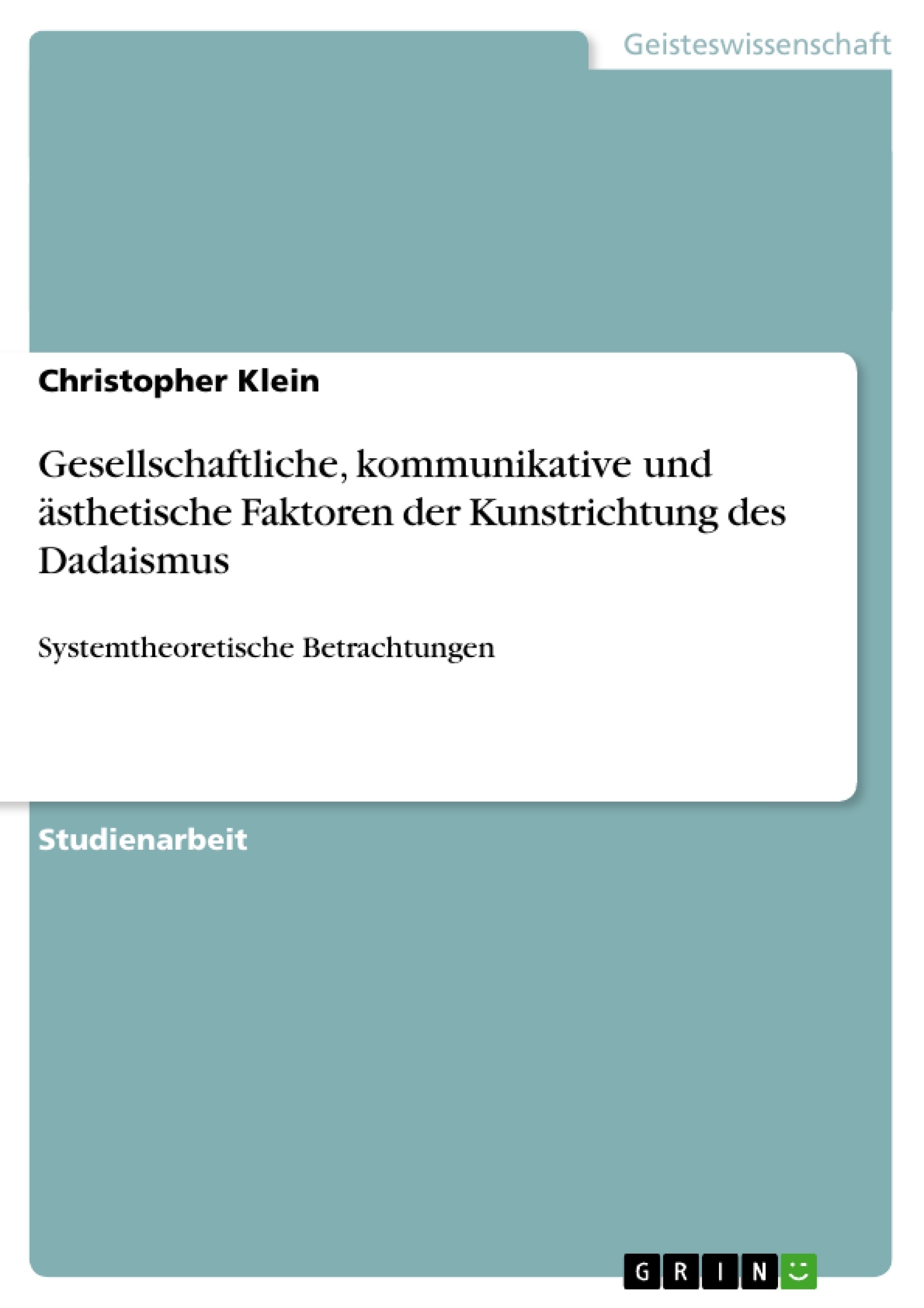1918 tritt Johannes Baader während einer Messe in der Stiftskirche in Berlin auf das Rednerpodest. Die Messe wird gestört unterbrochen und alle Anwesenden sind gespannt, was dieser Mann in schwarzem Anzug zu sagen hat. Baader erhebt seine Stimme und sagt: „Einen Augenblick! Ich frage Sie, was ist Ihnen Jesus Christus?“ Nach längerem Schweigen gibt er laut die Antwort: „Er ist Ihnen wurst!“1 Dass der Aktionskünstler und ‚Oberdada’ danach verhaftet wurde, wahr ihm wohl schon vorher klar und er sollte es schon gewöhnt gewesen sein, war dies nicht seine erste Aktion mit skandalösem Ausgang. Eine der Spezialitäten dadaistischer Gruppen waren unter anderem Auftritte solcher Art. Zu dieser Zeit provozierten künstlerische Strömungen wie der Dadaismus das Publikum bis zum Äußersten. Sie wurde bei den meisten Kunstrezipienten und Kritiker mehr als ‚Schmutz’ und ‚sinnloses Revoluzzertum’ abgetan, denn als Kunst wahrgenommen. Der Dadaismus ist in dieser Epoche die Spitze der modernen Kunstbewegung, die mit der Décadence über den italienischen Futurismus und den Expressionismus schon seit Ende des 19. Jahrhunderts Fuß gefasst hatte 2.
Was früher als sinnlos und Nicht-Kunst abgehandelt wurde, stellt sich von heutigen Standpunkten als sehr interessant dar. Die Auswirkungen des Dadaismus sind mannigfaltig, bis heute werden die Konzepte der damaligen Zeit aufgenommen, sei es durch Drip-Paintings von Jackson Pollock, Cut-Ups von William S. Borroughs3 oder die Collagen von David Carson4. Nimmt man Werke des Dadaismus wie Duchamps Ready-mades, die nur durch das Ausstellen in Museen zur Kunst avancierten, wird klar, wie der Kuns tbegriff auf ein theoretisches Niveau übertragen wurde. Gerade durch das Verweigern von Sinn kreierte diese Kunst Sinn, einen neuen, sublimen Sinn, so die These dieser Arbeit. [...]
==
1 Riha, Karl: Da Dada da war ist Dada da. Aufsätze und Dokumente. München/Wien: Carl Hanser Verlag 1980, S. 151.
2 Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Sechste Auflage. Hrsg. Von Wolfgang Beutin, Klaus Ehlert, Wolfgang Emmerich, Christine Kanz, Bernd Lutz, Volker Meid, Michael Opitz, Carola Opitz-Wiemers, Ralf Schnell, Peter Stein und Inge Stephan. Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler 2001. S. 342 - 429
3 Borroughs, William S.: Naked Lunch. Frankfurt am Main: Ullstein Verlag 1994.
4 Carson, David: The End of Print. The Grafik Design of David Carson. Hersg. Von Lewis Blackwell und David Carson. San Francisco: 2000 Chroncal Books LLC.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Die historische Avantgarde
- 1.1. Kurzer Abriss der historischen Avantgarde bis zum Expressionismus
- 1.2. Sinnstiftung und -negierung vom Expressionismus zum Dadaismus
- 1.3. Gesellschaftliche Bedingung
- 2. Kommunikation und Kunst
- 2.1. Kommunikative und komplexe Veränderung des Kunstwerks
- 2.2. Das Paradox des Dadaismus
- 2.3. Kommunikativer Anschluss
- 3. Kunstcodierung und Wahrnehmung
- 3.1. Rezipient
- 3.2. Funktion und Code
- 3.3. Zufall und Codierung
- 3.4. Wahrnehmung und Sinn
- 1. Die historische Avantgarde
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Kunstrichtung des Dadaismus und untersucht diese im Kontext systemtheoretischer Ansätze. Ziel ist es, die gesellschaftlichen, kommunikativen und ästhetischen Faktoren, die den Dadaismus prägten, zu analysieren und deren Auswirkungen auf den Kunstbegriff aufzuzeigen.
- Die historische Entwicklung des Dadaismus im Kontext der Avantgarde
- Die Rolle der Kommunikation in der Produktion und Rezeption dadaistischer Kunst
- Die ästhetische Dimension des Dadaismus und die Rezeption von Sinn und Unsinn
- Die Bedeutung des Kunstbegriffs im Kontext der Autopoiesis
- Die Relevanz des Dadaismus für die heutige Kunstwelt
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung stellt die historische und gesellschaftliche Situation des Dadaismus im Kontext der Kunstavantgarde vor und erläutert die Bedeutung des Dadaismus für die Entwicklung des Kunstbegriffs.
- 1. Die historische Avantgarde: Dieses Kapitel beleuchtet die Vorläufer des Dadaismus, insbesondere den Expressionismus, und analysiert die gesellschaftlichen Bedingungen, die zur Entstehung des Dadaismus führten.
- 2. Kommunikation und Kunst: Hier wird die Rolle der Kommunikation in der Produktion und Rezeption dadaistischer Kunst untersucht. Es wird analysiert, wie der Dadaismus das Kunstwerk als kommunikatives Medium nutzt und gleichzeitig das Kommunikationssystem destabilisiert.
- 3. Kunstcodierung und Wahrnehmung: Dieses Kapitel widmet sich der Rezeption dadaistischer Kunst und beleuchtet die Rolle der Codierung und Wahrnehmung in der Sinnproduktion. Es wird untersucht, wie Dadaismus den Kunstbegriff neu definiert und den Betrachter zur Selbstbeobachtung zwingt.
Schlüsselwörter
Dadaismus, Avantgarde, Kommunikation, Kunstbegriff, Systemtheorie, Autopoiesis, Rezeption, Ästhetik, Sinn, Unsinn, Codierung, Wahrnehmung, gesellschaftliche Bedingung, Kunstgeschichte, Moderne.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel des Dadaismus?
Der Dadaismus wollte durch Provokation, Sinnverweigerung und Skandale den traditionellen Kunstbegriff stürzen und die bürgerliche Gesellschaft aufrütteln.
Wer war Johannes Baader?
Baader war ein Aktionskünstler und selbsternannter "Oberdada", bekannt für provokante Aktionen wie die Störung von Gottesdiensten.
Was sind "Ready-mades"?
Bekannt durch Marcel Duchamp, sind dies Alltagsgegenstände, die allein durch ihre Platzierung im Museumskontext zu Kunstwerken erhoben werden.
Wie hängen Dadaismus und Kommunikation zusammen?
Dadaismus nutzt Kommunikation, um sie gleichzeitig zu destabilisieren. Durch den "Unsinn" wird ein neuer, sublimer Sinn auf theoretischem Niveau geschaffen.
Welchen Einfluss hat Dada auf die heutige Kunst?
Konzepte wie Collagen, Cut-ups oder Drip-Paintings (z. B. Jackson Pollock) lassen sich auf die radikalen Ansätze des Dadaismus zurückführen.
- Quote paper
- Christopher Klein (Author), 2005, Gesellschaftliche, kommunikative und ästhetische Faktoren der Kunstrichtung des Dadaismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36018