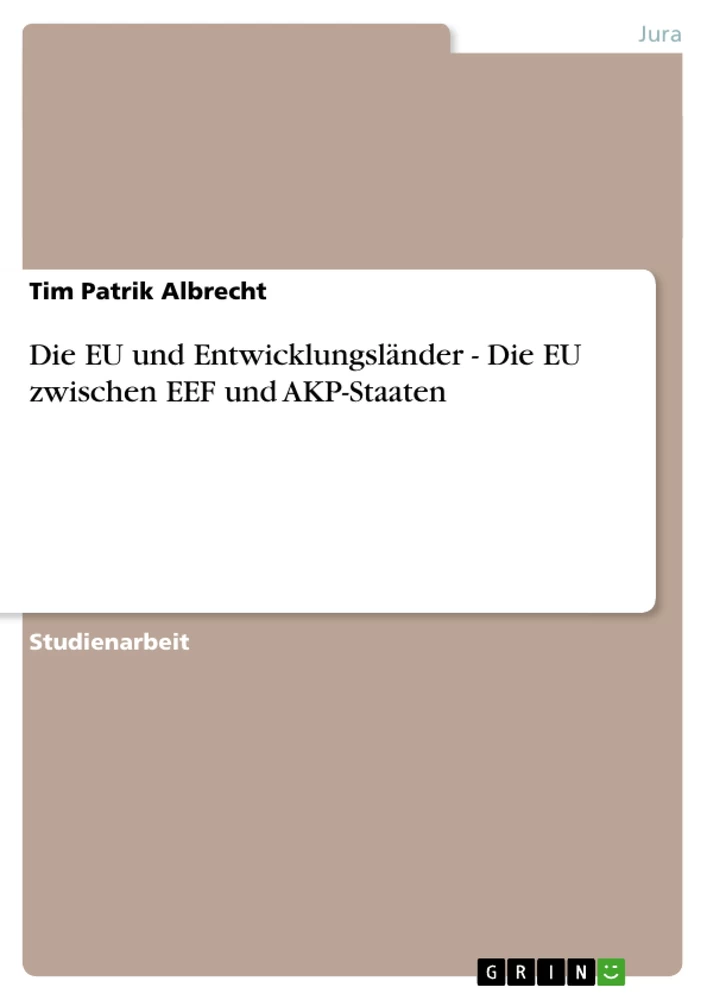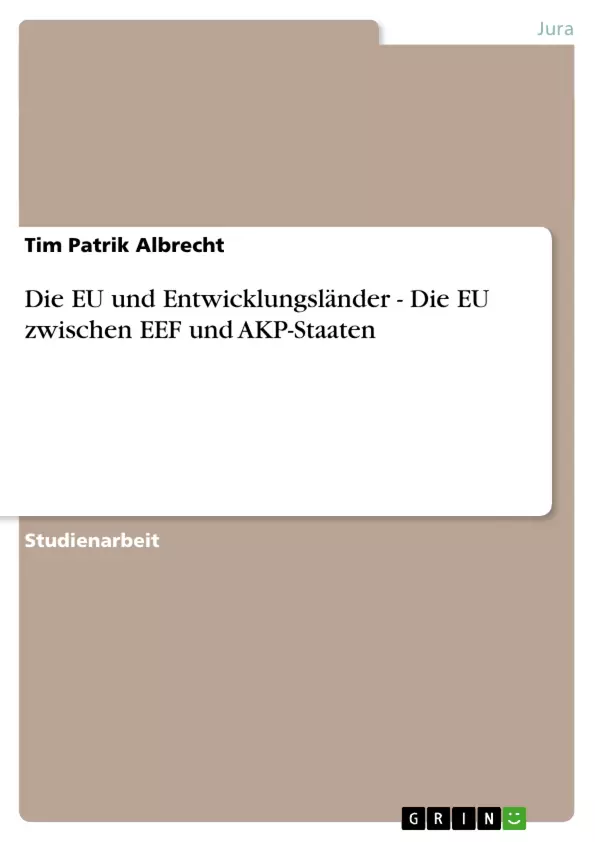„Als absolut arm gilt derjenige, der tägliche weniger als 1 US$ zur Verfügung hat“ Der Anteil der Weltbevölkerung, der diesem Kriterium entspricht, wird heute auf 21% geschätzt, d.h. 1,1 Mrd. Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Gegen die Ursachen der Armut und den aus ihr entspringenden Folgen soll die internationale Entwicklungshilfe wirken.
Die Flutkatastrophe vom 25.12.04 hat weite Teile Asiens zerstört, der Wiederaufbau und die Bekämpfung der ökologischen Folgen können ohne die Hilfe von Außen nicht bewirkt werden. Auch hier sind die sog. Industrienationen gefordert einen Betrag zu leisten.
Vor diesem Hintergrund soll die EU als Akteur in der internationalen Entwicklungspolitik und –hilfe dargestellt werden. Dazu wird zunächst eine Definition und Kriterien aufgezeigt die ein Land als Entwicklungsland kennzeichnen.
Aus einer ethisch-moralischen Verantwortung der Industrienationen heraus begründet sich die Entwicklungshilfe. Die Kolonialzeit und die damit verbundene Ausbeutung der Länder der heutigen Dritten Welt, sind mitverantwortlich für deren Rückstand in der Entwicklung. Weitere Ziele sind in den Vertragsgrundlagen der EU zu finden.
Eine Darstellung der Instrumente, die der EU zur Verfügung stehen, schließt sich daran an. Die juristischen Instrumente ergeben sich zum einen aus dem EG-Vertrag (unilaterales System) und zum anderen aus internationalen Abkommen wie z.B. Yaoundé-Abkommen (vertragliches System). Aus finanzieller Sicht gibt es drei Instrumente der Entwicklungshilfe, den Gemeinschaftshaushalt, den Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) und die Europäische Investitionsbank (EIB). Zusätzlich wird auf Formen regionaler Zusammenarbeit in der europäischen Entwicklungshilfe eingegangen.
Die neuen Mitglieder der EU, die im Rahmen der Ost-Erweiterung aufgenommen wurden, in die Entwicklungszusammenarbeit zu integrieren und die Flutkatastrophe in Asien sind Aufgaben, denen sich die EU in Zukunft stellen muss. Auch die Verfassung der EU, die zum Zeitpunkt der Seminararbeit noch formuliert wurde, enthält Reformansätze für die Entwicklungshilfe.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. ENTWICKLUNGSLÄNDER
- 2.1. DIE ÖKONOMISCHEN MERKMALE
- 2.2. DIE SOZIALEN MERKMALE
- 2.3. DIE POLITISCHEN MERKMALE
- 2.4. DIE ÖKOLOGISCHEN UND GESUNDHEITLICHEN MERKMALE
- 3. GRÜNDE UND ZIELE FÜR ENTWICKLUNGSHILFE
- 4. INSTRUMENTE DER EUROPÄISCHE ENTWICKLUNGSPOLITIK
- 4.1. DAS UNILATERALE SYSTEM
- 4.2. DAS VERTRAGLICHE SYSTEM
- 4.2.1. DIE YAOUNDÉ-ABKOMMEN
- 4.2.2. DIE LOMÉ-ABKOMMEN
- 4.2.3. DER COTONOU-VERTRAG
- 4.3. DIE FINANZINSTRUMENTE
- 4.3.1. DER GEMEINSCHAFTSHAUSHALT
- 4.3.2. DER EUROPÄISCHE ENTWICKLUNGSFONDS (EEF)
- 4.3.3. DIE EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK (EIB)
- 5. REGIONALE ZUSAMMENARBEIT
- 5.1. DAS MITTELMEER
- 5.2. ASIEN UND LATEINAMERIKA (ALA)
- 5.3. AFRIKA, KARIBIK UND PAZIFIK
- 6. ZUKUNFT, REFORM UND KRITIK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle der Europäischen Union (EU) in der internationalen Entwicklungspolitik und -hilfe zu beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf der Beziehung zwischen der EU und den Entwicklungsländern im Kontext der EEF (Europäischer Entwicklungsfonds) und den AKP-Staaten (Afrika, Karibik und Pazifik).
- Die ökonomischen, sozialen, politischen und ökologischen Merkmale von Entwicklungsländern
- Die Gründe und Ziele der Entwicklungshilfe
- Die Instrumente der Europäischen Entwicklungpolitik, einschließlich des unilateralen und vertragsbasierten Systems
- Die regionale Zusammenarbeit der EU mit Entwicklungsländern, insbesondere im Mittelmeerraum, in Asien und Lateinamerika sowie in Afrika, Karibik und Pazifik
- Die Zukunft, Reform und Kritik an der Europäischen Entwicklungshilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einführung in die Thematik und beleuchtet die Bedeutung der internationalen Entwicklungshilfe angesichts der Armut in der Welt. Kapitel 2 analysiert die charakteristischen Merkmale von Entwicklungsländern, wobei es sich mit ökonomischen, sozialen, politischen und ökologischen Aspekten auseinandersetzt. Kapitel 3 untersucht die ethischen und wirtschaftlichen Gründe für die Entwicklungshilfe und definiert deren Ziele. Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Instrumenten der Europäischen Entwicklungpolitik, darunter das unilaterale System sowie die verschiedenen Abkommen und Finanzinstrumente, wie den Europäischen Entwicklungsfonds (EEF). Kapitel 5 fokussiert auf die regionale Zusammenarbeit der EU mit Entwicklungsländern in verschiedenen Regionen wie dem Mittelmeerraum, Asien und Lateinamerika sowie Afrika, Karibik und Pazifik. Kapitel 6 diskutiert die zukünftigen Herausforderungen, Reformbedürfnisse und die Kritik an der Europäischen Entwicklungshilfe.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Entwicklungshilfe, Entwicklungsländer, EU, EEF, AKP-Staaten, regionale Zusammenarbeit, Wirtschaftspolitik, soziale Entwicklung, politische Stabilität, ökologische Nachhaltigkeit und Reform der Entwicklungshilfe. Die Analyse stützt sich auf wichtige Konzepte wie die Armutsbekämpfung, die nachhaltige Entwicklung, die Förderung von Demokratie und Menschenrechten sowie die Förderung von Wirtschaftswachstum und soziale Gerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptmerkmale eines Entwicklungslandes?
Entwicklungsländer zeichnen sich durch ökonomische (geringes Einkommen), soziale (hohe Analphabetenrate), politische (Instabilität) und ökologische Merkmale aus.
Was ist der Europäische Entwicklungsfonds (EEF)?
Der EEF ist das wichtigste Finanzinstrument der EU für die Entwicklungszusammenarbeit mit den AKP-Staaten (Afrika, Karibik, Pazifik).
Was regelt der Cotonou-Vertrag?
Der Cotonou-Vertrag ist ein internationales Abkommen zwischen der EU und den AKP-Staaten, das die Ziele der Armutsbekämpfung und der nachhaltigen Entwicklung festlegt.
Welche Rolle spielt die Europäische Investitionsbank (EIB)?
Die EIB unterstützt die Entwicklungshilfe durch die Vergabe von Darlehen für Investitionsprojekte in Partnerländern.
Was ist das unilaterale System der EU-Entwicklungspolitik?
Es handelt sich um einseitige Maßnahmen der EU, wie z.B. Handelspräferenzen für Entwicklungsländer, die im EG-Vertrag verankert sind.
- Quote paper
- Tim Patrik Albrecht (Author), 2004, Die EU und Entwicklungsländer - Die EU zwischen EEF und AKP-Staaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36044