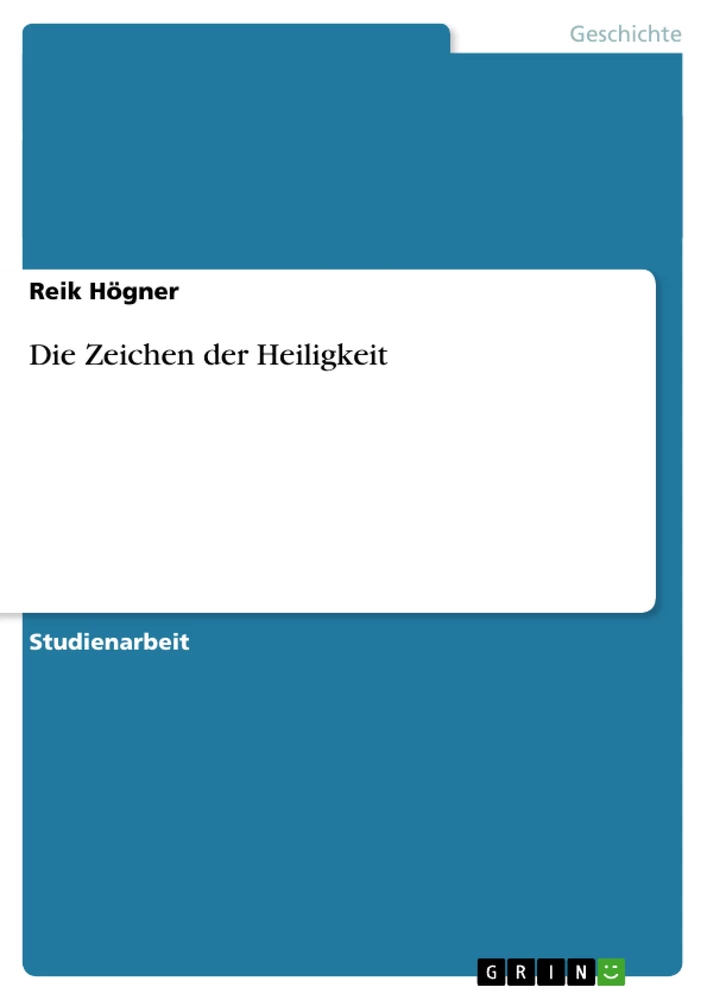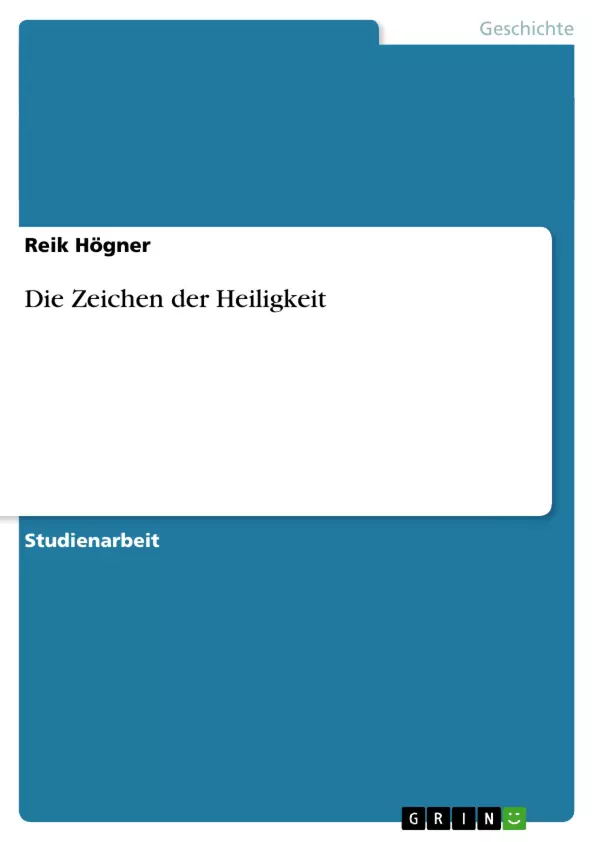Schon das frühe Christentum verehrte Heilige - zunächst die biblischen Gestalten. Im vierten Jahrhundert kam es aufgrund der Christenverfolgungen (Höhepunkt unter Kaiser Diocletian
284 – 305) zur Bewunderung einer neuen Gruppe. Das waren Menschen, die trotz der Verfolgung an ihrem Glauben bis zum Tod festhielten – die Märtyrer.
Das Christentum konnte sich schließlich („von oben“) durch Konstantin den Großen als Staatsreligion etablieren und in den nächsten Jahrhunderten festigen. Durch gesellschaftliche Veränderungen wurden nun stets andere Menschen zu Heiligen.
Die vorliegende Arbeit soll nun die Kennzeichen untersuchen, die im Mittelalter, ja schon in der frühchristlichen Kunst, den Verehrten beigefügt wurden. Der Heiligenschein nimmt eine besondere Rolle als übergeordnetes Attribut der Heiligkeit ein. Weiterhin soll beleuchtet werden, welche Attribute es seit wann gibt – lassen sie sich klassifizieren? Abschließend steht der Versuch die Frage zu beantworten, wie denn der Heilige überhaupt zu seinem künstlerischen Accessoire gekommen ist.
Die Forschungslage zu diesem Gebiet ist äußerst schwierig zu überblicken, die Entstehung Standardwerke, wie das Buch Joseph Brauns, liegen schon mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Viele heutige Schriften basieren auf dem alten Wissensstand. Eva Schurr greift neue Aspekte auf. Sie beschäftigt sich in ihrem Buch mit der Entwicklung der Attribute jedoch nur bis zum 8. Jahrhundert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Genereller Ausweis der Heiligkeit
- 2.1 Der Nimbus
- 2.2 Baldachinarchitektur
- 3. Die Attribute der Heiligen
- 3.1 Attribute in der christlichen bildenden Kunst des Mittelalters
- 3.1.1 Klassifizierung der Attribute
- 3.1.2 „Problematik Kleidung und physiognomische Eigenheiten“
- 3.2 Die Gattungsattribute oder allgemeine Attribute
- 3.3 Die individuellen oder persönlichen Attribute
- 3.1 Attribute in der christlichen bildenden Kunst des Mittelalters
- 4. Der Ursprung der Attribute, Beziehung zur Trägerfigur
- 4.1 Bedeutsames Ereignis
- 4.2 Wesen, heilsgeschichtliche Funktion
- 4.3 Äußerer Lebensumstand
- 4.4 Die „redenden“ Attribute
- 4.5 Auslegung der heiligen Schrift
- 5. Herausragendes zu den Attributen
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kennzeichen der Heiligkeit in der mittelalterlichen christlichen Kunst. Das Hauptziel ist es, die Entstehung und Verwendung von Heiligenattributen zu analysieren und deren Klassifizierung zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet auch den Ursprung der Attribute und deren Beziehung zu den dargestellten Heiligen.
- Die Entwicklung und Symbolik des Nimbus als Hauptattribut der Heiligkeit.
- Die Klassifizierung von Heiligenattributen in Gattungs- und individuelle Attribute.
- Der Ursprung der Attribute und deren Bezug zu den Lebensumständen, Handlungen und der theologischen Bedeutung der Heiligen.
- Die Rolle der Kunst bei der Darstellung und Verbreitung von Heiligenlegenden und -bildern.
- Die historische Entwicklung der Darstellung von Heiligkeit in der christlichen Kunst.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Verehrung von Heiligen im frühen Christentum, beginnend mit biblischen Figuren und der späteren Hinzunahme von Märtyrern. Sie erläutert den Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion unter Konstantin dem Großen und die anschließende Entwicklung der Heiligenverehrung im Mittelalter. Die Arbeit skizziert das Forschungsfeld und die Herausforderungen, die sich aus der verstreuten und teilweise veralteten Forschungsliteratur ergeben. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Kennzeichen, die im Mittelalter Heiligen in der Kunst beigefügt wurden, wobei der Heiligenschein als zentrales Attribut hervorgehoben wird. Die Arbeit stellt Fragen zur Klassifizierung der Attribute und deren Ursprung.
2. Genereller Ausweis der Heiligkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Nimbus und der Baldachinarchitektur als generellen Attributen der Heiligkeit. Der Nimbus, ursprünglich ein Zeichen für Hoheit und Göttlichkeit in der Antike, wird im frühen Christentum zunächst Christus zugeschrieben, später aber auf alle Heiligen ausgeweitet. Seine Form und Farbe variierten und enthielten zusätzliche Informationen über die dargestellte Person. Die Baldachinarchitektur, als Symbol des Himmels und der himmlischen Stadt, wird als weiterer genereller Ausweis der Heiligkeit diskutiert, wobei die Frage nach der Tragweite dieser Aussage offen bleibt.
Schlüsselwörter
Heiligenattribute, christliche Kunst, Mittelalter, Nimbus, Baldachin, Ikonographie, Heiligenschein, Märtyrer, Asketenheilige, Klassifizierung, Symbolik, Religionsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kennzeichen der Heiligkeit in der mittelalterlichen christlichen Kunst
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Kennzeichen der Heiligkeit in der mittelalterlichen christlichen Kunst, insbesondere die Entstehung, Verwendung und Klassifizierung von Heiligenattributen. Sie untersucht den Ursprung der Attribute und deren Beziehung zu den dargestellten Heiligen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Nimbus und der Baldachinarchitektur.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung und Symbolik des Nimbus, die Klassifizierung von Heiligenattributen (Gattungs- und individuelle Attribute), den Ursprung der Attribute im Bezug auf Lebensumstände, Handlungen und theologische Bedeutung der Heiligen, die Rolle der Kunst bei der Darstellung und Verbreitung von Heiligenlegenden und -bildern sowie die historische Entwicklung der Darstellung von Heiligkeit in der christlichen Kunst.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Genereller Ausweis der Heiligkeit (Nimbus und Baldachinarchitektur), Die Attribute der Heiligen (Klassifizierung, Gattungs- und individuelle Attribute), Der Ursprung der Attribute, Beziehung zur Trägerfigur (Bedeutsames Ereignis, Wesen, heilsgeschichtliche Funktion, Äußerer Lebensumstand, „redende“ Attribute, Auslegung der heiligen Schrift), Herausragendes zu den Attributen und Zusammenfassung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was sind die wichtigsten Heiligenattribute?
Ein zentrales Attribut ist der Nimbus (Heiligenschein), der ursprünglich ein Zeichen für Hoheit und Göttlichkeit war und im frühen Christentum zunächst Christus zugeschrieben wurde, später aber auf alle Heiligen ausgeweitet wurde. Die Baldachinarchitektur wird als weiteres generelles Attribut diskutiert, wobei die Tragweite dieser Aussage offen bleibt. Die Arbeit klassifiziert Attribute weiterhin in Gattungs- und individuelle Attribute.
Woher stammen die Attribute und wie stehen sie im Zusammenhang mit den Heiligen?
Der Ursprung der Attribute wird im Detail untersucht und bezieht sich auf bedeutsame Ereignisse im Leben des Heiligen, sein Wesen und seine heilsgeschichtliche Funktion, äußere Lebensumstände, „redende“ Attribute (die eine Geschichte erzählen) und die Auslegung der heiligen Schrift.
Welche Herausforderungen gab es bei der Recherche?
Die Einleitung erwähnt die Herausforderungen, die sich aus der verstreuten und teilweise veralteten Forschungsliteratur ergeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter beschrieben: Heiligenattribute, christliche Kunst, Mittelalter, Nimbus, Baldachin, Ikonographie, Heiligenschein, Märtyrer, Asketenheilige, Klassifizierung, Symbolik, Religionsgeschichte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung und Verwendung von Heiligenattributen zu analysieren und deren Klassifizierung zu beleuchten. Sie betrachtet auch den Ursprung der Attribute und deren Beziehung zu den dargestellten Heiligen. Ein Hauptziel ist das Verständnis der Kennzeichen der Heiligkeit in der mittelalterlichen christlichen Kunst.
- Citar trabajo
- Reik Högner (Autor), 2003, Die Zeichen der Heiligkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36091