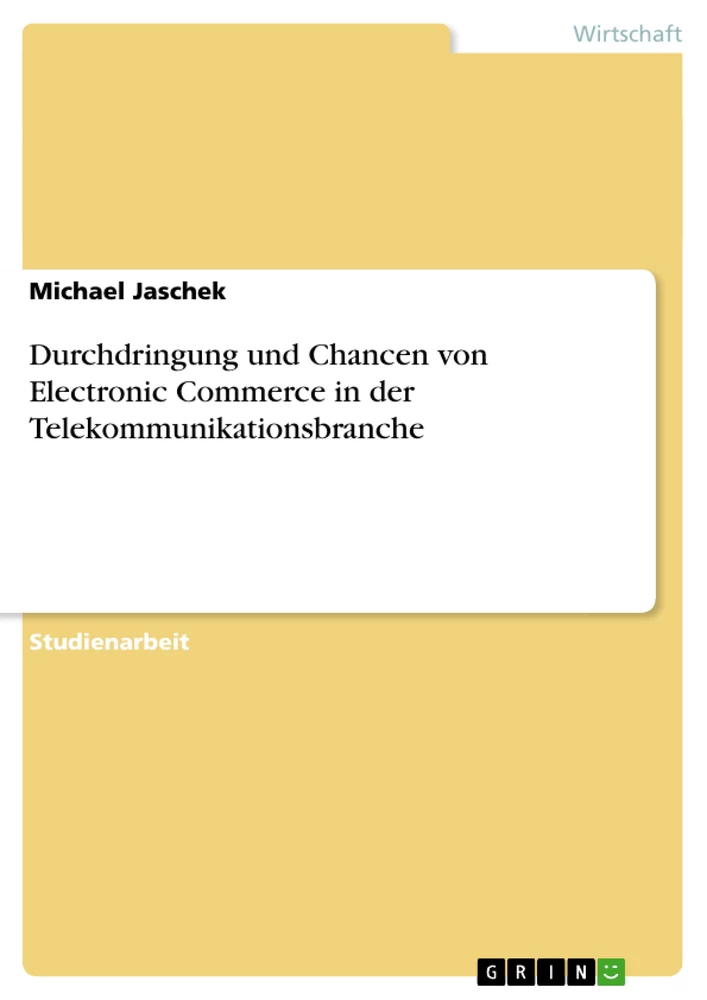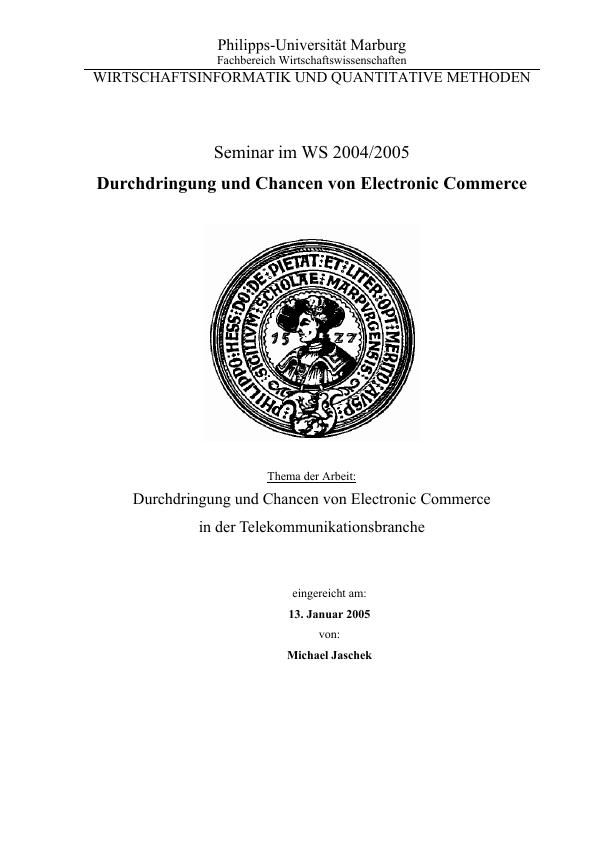Der Hightech-Markt im Telekommunikationsumfeld hat durch anhaltende Innovationen eine starke Dynamik entwickelt. Schnelle DSL-Anschlüsse, WLAN-Hotspots, Megapixel- Handys und UMTS sind nur einige der vielen Neuerungen, die zu einem anhaltenden Wachstum dieser Branche beitragen. In der Informationsgesellschaft hat neben dem Internet die Mobilfunktechnologie zunehmend durch die steigende Mobilität der Nutzer an Bedeutung gewonnen. Durch die Annäherung dieser Technologien ist der Mobile Commerce als neue Ausprägung des Electronic Commerce entstanden. Zwischen dem traditionellem Electronic Commerce und dem Mobile Commerce bestehen außer den vielen Gemeinsamkeiten jedoch auch signifikante Unterschiede. Diese sollen in der vorliegenden Arbeit beschrieben und analysiert werden. Nach der Begriffsabgrenzung im folgenden Kapitel werden in Kapitel 3 die hauptsächlich technischen Aspekte des Mobilfunks erläutert und der relevante Markt abgegrenzt. Kapitel 4 beschreibt anschließend die Durchdringung von Electronic Commerce im Mobilfunkmarkt und zeigt neben den Anwendungsgebieten die Unterschiede zum traditionellen Electronic Commerce auf. Ein Fallbeispiel rundet die Darstellung der bisherigen Marktentwicklung ab. In Kapitel 5 werden dann abschließend die Entwicklungsperspektiven des Mobile Commerce vor dem Hintergrund der technologischen Entwicklung beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung und Zielsetzung
- Definition und Anwendung von Electronic Commerce (EC)
- EC in der Telekommunikationsbranche
- Mobilfunkmarkt und Mobile Commerce (MC)
- Determinanten des Mobilfunkmarktes
- Mobilfunkstandards
- Wireless LAN, Bluetooth und IrDA
- Mobile Endgeräte (ME)
- Netzbetreiber in Deutschland
- Durchdringung des MC
- Wertnetzanalyse und Wertschöpfung im Mobilfunkmarkt
- MC-Geschäftsmodelle
- Informationelle Mehrwerte von MC-Geschäftsmodellen
- Anwendungsbereiche und Realisierung des MC
- Fallbeispiel: Die Kooperation von Jamba! und Debitel
- Chancen des MC
- Der Umbruch im Mobilfunkmarkt
- Ausschöpfung ungenutzter Potentiale des MC
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Durchdringung und Chancen von Electronic Commerce (EC), insbesondere Mobile Commerce (MC), in der Telekommunikationsbranche. Sie analysiert die technischen Determinanten des Mobilfunkmarktes und beschreibt die Entwicklung und Verbreitung von MC-Geschäftsmodellen. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede zwischen traditionellem EC und MC.
- Definition und Abgrenzung von EC und MC
- Technische Grundlagen und Entwicklung des Mobilfunkmarktes
- Durchdringung von MC im Mobilfunkmarkt und Analyse von Geschäftsmodellen
- Informationelle Mehrwerte von MC-Anwendungen
- Zukünftige Chancen und Entwicklungspotenziale von MC
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung und Zielsetzung: Die Arbeit untersucht die dynamische Entwicklung des Telekommunikationsmarktes, fokussiert auf den Einfluss von Innovationen wie DSL, WLAN und UMTS auf das Wachstum der Branche. Sie analysiert den Mobile Commerce (MC) als neue Form des Electronic Commerce (EC), unter Berücksichtigung der Unterschiede zu traditionellem EC und dessen Bedeutung im Kontext der zunehmenden Mobilität. Die Arbeit grenzt den relevanten Markt ab und beschreibt die Methodik zur Untersuchung der Durchdringung und Chancen von MC.
Definition und Anwendung von Electronic Commerce (EC): Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Electronic Business (EB) und EC. Es differenziert zwischen verschiedenen Definitionsansätzen und beschreibt EC als einen ganzheitlichen Leistungsaustauschprozess mittels elektronischer Netze. Der Fokus liegt auf EC in der Telekommunikationsbranche, unter Einbezug der verschiedenen Akteure (Administration, Business, Consumer) und der daraus resultierenden Geschäftsmodelle (B2B, B2C). Der Mobilfunkmarkt wird als wichtiger Teilbereich des Telekommunikationsmarktes eingeführt und seine Bedeutung im Kontext von MC hervorgehoben.
Determinanten des Mobilfunkmarktes: Dieses Kapitel beleuchtet die technischen Grundlagen des Mobilfunkmarktes. Es beschreibt Mobilfunkstandards, Technologien wie Wireless LAN, Bluetooth und IrDA, die Eigenschaften mobiler Endgeräte und die Rolle der Netzbetreiber in Deutschland. Diese Aspekte bilden die Grundlage für das Verständnis der Durchdringung und des Potenzials von MC.
Durchdringung des MC: Dieses Kapitel analysiert die Durchdringung von MC im Mobilfunkmarkt. Es untersucht die Wertnetzanalyse und Wertschöpfung im Mobilfunkmarkt, verschiedene MC-Geschäftsmodelle, die informationellen Mehrwerte dieser Modelle, Anwendungsbereiche und die Realisierung von MC. Ein Fallbeispiel illustriert die Marktentwicklung. Der Vergleich mit traditionellem EC hebt die Unterschiede und Besonderheiten von MC hervor.
Chancen des MC: Dieses Kapitel befasst sich mit den Zukunftsaussichten von MC. Es betrachtet den Umbruch im Mobilfunkmarkt und die Möglichkeiten, ungenutzte Potentiale von MC zu erschließen. Die Analyse stützt sich auf die vorherigen Kapitel und betont die Chancen, die sich aus der technologischen Entwicklung ergeben.
Schlüsselwörter
Electronic Commerce, Mobile Commerce, Telekommunikationsbranche, Mobilfunkmarkt, Geschäftsmodelle, Wertschöpfung, technologische Entwicklung, Marktpenetration, Informationelle Mehrwerte, UMTS.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Durchdringung und Chancen von Mobile Commerce im deutschen Mobilfunkmarkt
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Durchdringung und Chancen von Mobile Commerce (MC) im deutschen Telekommunikationsmarkt. Sie analysiert die technischen Grundlagen, die Entwicklung von MC-Geschäftsmodellen und deren informationelle Mehrwerte im Vergleich zu traditionellem Electronic Commerce (EC).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von EC und MC, die technischen Entwicklungen im Mobilfunkmarkt (inkl. Standards, Technologien wie WLAN, Bluetooth und IrDA, mobile Endgeräte und Netzbetreiber), die Durchdringung von MC, die Analyse verschiedener MC-Geschäftsmodelle und deren Wertschöpfung, sowie die zukünftigen Chancen und Entwicklungspotenziale von MC. Ein Fallbeispiel (Jamba! und Debitel) wird ebenfalls analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Problemstellung und Zielsetzung, Definition und Anwendung von EC, Determinanten des Mobilfunkmarktes, Durchdringung von MC (inkl. Wertnetzanalyse und Fallbeispiel), Chancen von MC und einem abschließenden Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung der jeweiligen Themen.
Was sind die wichtigsten Determinanten des Mobilfunkmarktes laut der Arbeit?
Zu den wichtigsten Determinanten zählen Mobilfunkstandards, Technologien wie Wireless LAN, Bluetooth und IrDA, die Eigenschaften mobiler Endgeräte und die Rolle der deutschen Netzbetreiber. Diese Faktoren beeinflussen maßgeblich die Entwicklung und Durchdringung von Mobile Commerce.
Wie wird die Durchdringung von Mobile Commerce analysiert?
Die Analyse der MC-Durchdringung umfasst die Untersuchung der Wertnetzanalyse und Wertschöpfung im Mobilfunkmarkt, die Beschreibung verschiedener MC-Geschäftsmodelle, die Bewertung der informationellen Mehrwerte dieser Modelle und die Betrachtung der Anwendungsbereiche und Realisierung von MC. Ein Fallbeispiel veranschaulicht die Marktentwicklung.
Welche Chancen für Mobile Commerce werden aufgezeigt?
Die Arbeit beleuchtet den Umbruch im Mobilfunkmarkt und die Möglichkeiten, ungenutzte Potentiale von MC zu erschließen. Der Fokus liegt auf den Chancen, die sich aus der technologischen Entwicklung ergeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Electronic Commerce, Mobile Commerce, Telekommunikationsbranche, Mobilfunkmarkt, Geschäftsmodelle, Wertschöpfung, technologische Entwicklung, Marktpenetration, informationelle Mehrwerte, UMTS.
Wie unterscheidet sich Mobile Commerce von traditionellem Electronic Commerce?
Die Arbeit hebt die Unterschiede zwischen traditionellem EC und MC hervor, indem sie die spezifischen Herausforderungen und Chancen von MC im Kontext der Mobilität und der technischen Gegebenheiten des Mobilfunkmarktes beleuchtet.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende, und Fachleute im Bereich Telekommunikation, Wirtschaftsinformatik und Marketing, die sich mit den Themen Electronic Commerce, Mobile Commerce und der Entwicklung des Mobilfunkmarktes auseinandersetzen.
- Citation du texte
- Diplom-Kaufmann Michael Jaschek (Auteur), 2005, Durchdringung und Chancen von Electronic Commerce in der Telekommunikationsbranche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36188