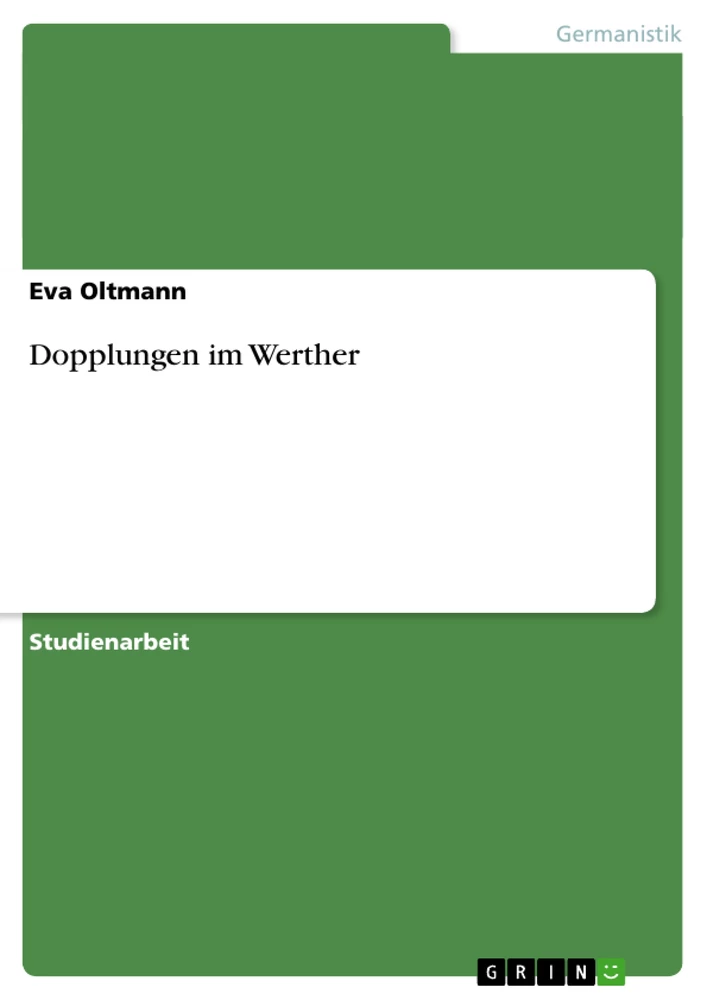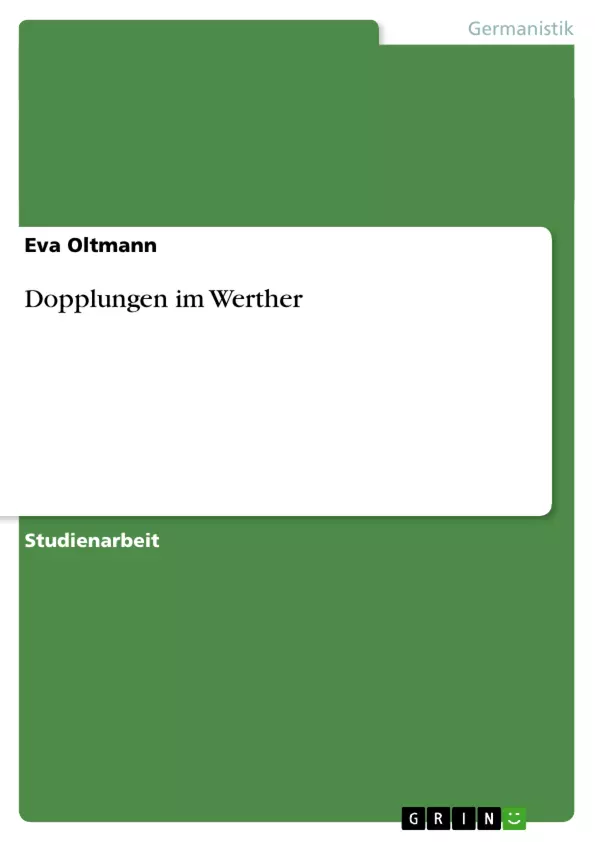Einleitung
„Die Leiden des jungen Werther” von Johann Wolfgang Goethe 1774 verfasst, ist ein vielseitig interpretiertes, facettenreiches Werk. Im Mittelpunkt steht die Geschichte eines jungen Mannes namens Werther, der sich in eine Frau verliebt, ohne jede Hoffnung auf eine Erfüllung dieser Liebe. Er leidet sehr darunter, wie auch unter gesellschaftlichen Zwängen und flüchtet sich in eine eigene scheinbar heile Welt, dort erschafft er sich in seinen Tagträumen ein eigenes Utopia. Nach und nach bemerkt er, dass diese Welt nicht real ist, dass seine Liebe nicht erfüllt werden kann und sieht seinen einzigen Ausweg im Freitod. Das Werk - ein Briefroman - ist in zwei Bücher aufgeteilt, wobei das erste Buch Werther in Hochstimmung zeigt1. Er geniest die Natur, er liest leidenschaftlich gern, er verliebt sich in Lotte. Dieses Buch enthält seine Briefe vom 4. Mai bis zum 10. September 1771 an einen Freund namens Wilhelm, dessen Antworten jedoch nur als Reaktion in Werthers Briefen zu erkennen sind.
Der zweite Teil umfasst die Briefe vom 20. Oktober 1771 bis zum Dezember 1772 und eine Schilderung der letzten Ereignisse durch den Herausgeber. Somit ist das Werk in zwei etwa gleich lange Teile zerlegt, und in diesen beiden Büchern spiegelt sich die auf - und absteigende Linie der Liebesbeziehung zwischen Werther und Lotte.2 Genau wie Werthers Laune, so ändert sich auch seine Umgebung.
Parallelgeschichten von anderen Personen mit ähnlichem Geschick unterstreichen Werthers eigenes Leiden und weisen auf dessen Ende hin. Auch Werthers veränderte Naturwahrnehmung und sein wechselnder Literaturgeschmack sind Fäden des komplexen Spinnennetzes, mit der sich die Struktur des Werkes am besten beschreiben lässt. Während die Fäden aus den glücklichen Tagen zum Zentrum des Netzes - der Liebe zu Lotte - hindeuten, so wie es auch die Geschicke der Menschen aus den Parallelgeschichten zu tun scheinen, scheinen die Fäden, die für die Verdunkelung von Werthers Welt und seiner Liebe stehen, jedoch davon wegzulaufen.
Diese Parallelgeschichten, Spiegelungen und Kontraste werden in dieser Arbeit näher untersucht und durchleuchtet.
---
1 Die Briefe stehen auch zueinander in spiegelnden Kontrasten. Vgl. hierzu Siepmann S. 83 – 87 die Struktur des Romans.
2 Vgl. Blessin S. 27 ; s. auch: Rumpf S. 24/25
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Das 2. Buch ist ein Negativ des 1. Buches
- Bauernbursche
- Schulmeistertochter
- Heinrich der Blumenpflücker
- Selbstmörderin
- Nussbäume
- Werther spiegelt seine Umwelt wider
- Werthers Laune ist von positiver Bestärkung durch andere Personen abhängig
- Literatur spiegelt Werthers Seelenzustand
- Natur beeinflusst Werther
- Kontraste im Werther
- Das 2. Buch ist ein Negativ des 1. Buches
- Schlusswort - Spiegelungen zwischen Werther und Goethe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Struktur und die Erzähltechnik in Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“. Ziel ist es, die Spiegelungen und Kontraste im Roman, insbesondere zwischen dem ersten und zweiten Buch, zu analysieren und deren Bedeutung für das Verständnis des Werkes aufzuzeigen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Parallelgeschichten und deren Funktion innerhalb der Gesamtkomposition.
- Das zweite Buch als Negativ des ersten Buches
- Die Spiegelung von Werthers innerem Zustand in seiner Umwelt
- Die Verwendung von Kontrasten als stilistisches Mittel
- Parallelgeschichten als Vertiefung der Haupthandlung
- Die Rolle der Natur und Literatur in Werthers Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt „Die Leiden des jungen Werthers“ als vielschichtig interpretierbares Werk. Sie stellt den Briefroman mit seiner Zweiteilung vor und hebt die auf- und absteigende Linie der Liebesbeziehung zwischen Werther und Lotte hervor. Die Parallelgeschichten anderer Personen und die Veränderungen in Werthers Naturwahrnehmung und Literaturgeschmack werden als zentrale Aspekte der Romanstruktur genannt, die in der Arbeit näher untersucht werden sollen.
Das 2. Buch ist ein Negativ des 1. Buches: Der zweite Teil des Romans wird als Gegenbild zum ersten Teil dargestellt. Der Kontrast wird anhand der Jahreszeiten (Sommer/Frühling im ersten, Herbst/Winter im zweiten Buch) verdeutlicht, wobei der Winter als Symbol des Todes interpretiert wird. Die Arbeit analysiert, wie positive Elemente des ersten Buches im zweiten Teil in ihr Gegenteil verkehrt werden. Die parallel laufenden Nebenhandlungen vertiefen die Haupthandlung und antizipieren Werthers Schicksal. Die "Spiegelung" als Erzähltechnik Goethes wird erläutert, die ein dichtes Netz aus Vergleichen knüpft.
Schlüsselwörter
Die Leiden des jungen Werthers, Goethe, Briefroman, Spiegelung, Kontrast, Parallelgeschichten, Natur, Literatur, Liebesbeziehung, Selbstmord, Jahreszeiten, Erzähltechnik.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes "Die Leiden des jungen Werthers"
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Vorschau auf eine wissenschaftliche Arbeit über Goethes "Die Leiden des jungen Werthers". Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Struktur und Erzähltechnik des Romans, insbesondere der Spiegelungen und Kontraste zwischen dem ersten und zweiten Buch.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Struktur von Goethes "Die Leiden des jungen Werthers", wobei insbesondere die Spiegelungen und Kontraste, vor allem zwischen dem ersten und zweiten Buch, im Mittelpunkt stehen. Weitere Schwerpunkte sind die Parallelgeschichten, die Rolle der Natur und Literatur in Werthers Entwicklung, die Verwendung von Kontrasten als stilistisches Mittel und die Funktion der Spiegelung als Erzähltechnik.
Wie ist der Roman nach der Analyse aufgebaut?
Der Roman wird in der Analyse als ein Werk mit zwei deutlich unterscheidbaren Teilen dargestellt. Das zweite Buch wird als ein "Negativ" des ersten Buches interpretiert, wobei Kontraste in den Jahreszeiten (Sommer/Frühling vs. Herbst/Winter), den Stimmungen und den Ereignissen hervorgehoben werden. Die Parallelgeschichten der Nebenfiguren werden als vertiefende Elemente der Haupthandlung betrachtet, die Werthers Schicksal vorwegnehmen.
Welche Rolle spielen Spiegelung und Kontrast in Goethes Roman?
Spiegelung und Kontrast sind zentrale analytische Kategorien. Die Arbeit untersucht, wie Goethes Erzähltechnik ein dichtes Netz aus Vergleichen und Gegenüberstellungen schafft. Das zweite Buch wird als Spiegelbild des ersten interpretiert, wobei positive Elemente des ersten Buches im zweiten Teil in ihr Gegenteil verkehrt werden. Diese Kontraste tragen wesentlich zum Verständnis des Werkes bei.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: "Die Leiden des jungen Werthers", Goethe, Briefroman, Spiegelung, Kontrast, Parallelgeschichten, Natur, Literatur, Liebesbeziehung, Selbstmord, Jahreszeiten und Erzähltechnik.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Spiegelungen und Kontraste im Roman "Die Leiden des jungen Werthers" zu analysieren und deren Bedeutung für das Verständnis des Werkes aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Romanstruktur und der Funktion der Parallelgeschichten innerhalb der Gesamtkomposition.
Wie wird das erste und zweite Buch des Romans in der Analyse verglichen?
Das zweite Buch wird als Gegenbild zum ersten Buch dargestellt, wobei der Kontrast anhand der Jahreszeiten (Sommer/Frühling vs. Herbst/Winter) und der Stimmung verdeutlicht wird. Positive Elemente des ersten Buches werden im zweiten Buch in ihr Gegenteil verkehrt. Die Analyse beleuchtet, wie diese Gegenüberstellung die Entwicklung der Handlung und Werthers psychischen Zustand beeinflusst.
- Quote paper
- Eva Oltmann (Author), 2004, Dopplungen im Werther, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36242