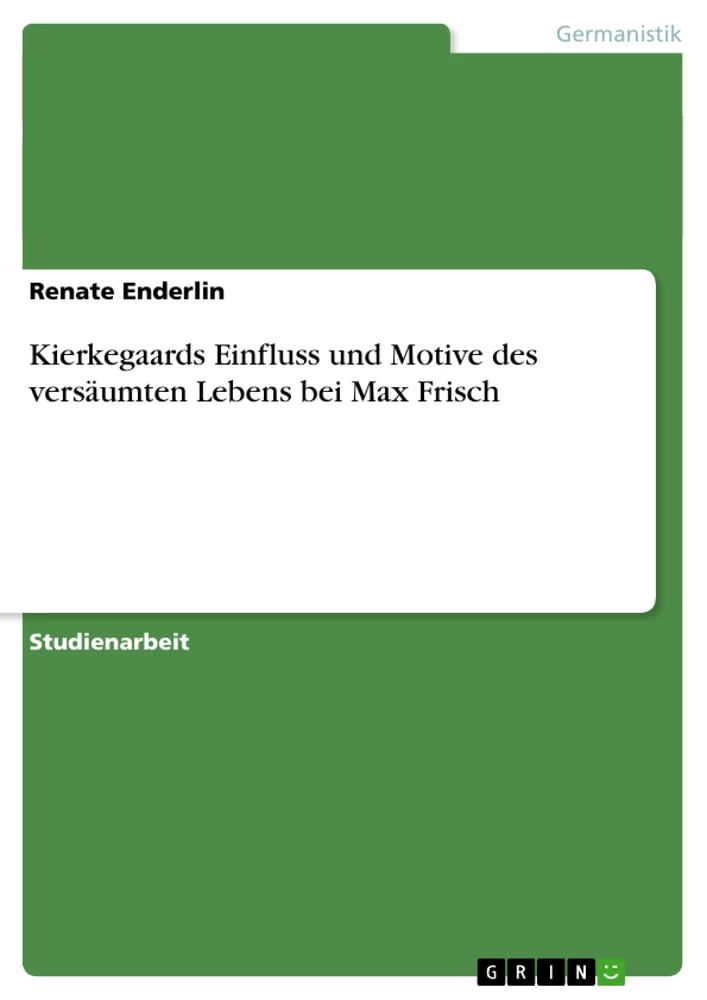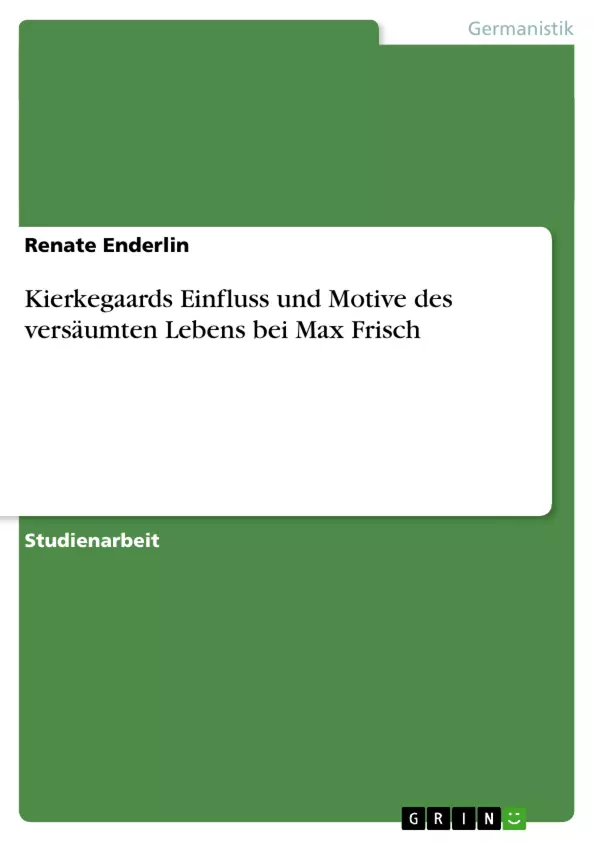Zwei Existenzmöglichkeiten nach Søren Kierkegaard, das ästhetische und das ethische Stadium werden in der Arbeit vorgestellt. Der Sprung ins Religiöse (das dritte Stadium bei Kierkegaard) wird dabei ausgeblendet, weil er in den Kategorien des versäumten Lebens nicht auftaucht und von Max Frisch (anders als bei Kierkegaard) nicht als Lösung präsentiert wird. In einem zweiten Schritt wird der Zusammenhang zwischen Schriftstellerexistenz, Künstlerdasein und Literatur dargestellt. Der zweite Teil nennt fünf Motive eines versäumten Lebens, die in einem dritten Teil in Bezug auf Max Frischs Romane „Mein Name sei Gantenbein“, „Homo faber“ und „Stiller“ behandelt werden. Dabei habe ich mich an der Dissertation von Kerstin Gühne-Engelmann orientiert. Abschließend versuche ich in einer kurzen Synopse der drei Romane, Gemeinsamkeiten zwischen den drei Protagonisten zu verdeutlichen.
Max Frisch hat das Motiv des versäumten Lebens in alle seine Romane verpackt. Das Thema hat ihn auch in seinem eigenen Leben beschäftigt. Einerseits hatte er den Wunsch, den Künstler in sich zu akzeptieren, andererseits quälte ihn das Gefühl, über der Schriftstellerei sein eigenes Leben zu versäumen. Der Dichter ist als Ästhet eben selber eine gefährdete Existenz, schwebt in Angst sein eigenes Leben, sich selbst zu verlieren.
Aber auch Menschen, die eine Flucht ins Lesen antreten und über den erzählten Geschichte ihre eigene Geschichte verpassen, sind in Gefahr völlig aus einem ethischen Leben zu verschwinden. Max Frisch vermittelt in seinen drei Romanen die Möglichkeit, dass ein Leben auch misslingen kann. Diese ernsthafte Vorstellung, dass es möglich ist, sein Leben zu versäumen, kann uns Leser wachrütteln, schockieren und motivieren, unser Verhalten zu überdenken. In der Reflexion ist der Sprung aus dem ästhetischen Leben noch nicht getan, nur ein erster Schritt. Es gilt also, die Bücher am Ende aus der Hand und sein Leben in die Hand zu nehmen. Nicht Reflexion über das Leben anderer oder abstrakte Träume, sondern ein erfülltes Leben wird angestrebt. Doch was heißt, sein Leben wirklich leben? Was ist ein erfülltes Leben? Es ist schwer, darauf eine befriedigende Antwort zu finden, denn wir können nicht einfach definieren, was ein wirkliches Leben ausmacht. Leichter gelingt es, in der Negation auszudrücken, was wir unter einem glücklichen, zufriedenen Leben verstehen, nämlich in der Antwort auf die Frage: Was heißt, sein Leben versäumen?
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Existenzmöglichkeiten bei Kierkegaard.
- 1.1 Ästhetisches Stadium.
- 1.2 Ethisches Stadium
- 1.3 Literatur und ein Schritt ins Ethische
- 2. Kategorien des versäumten Lebens
- 2.1 Erlebnisunfähigkeit..
- 2.2 Beziehungslosigkeit..
- 2.3 Zeitverlust...
- 2.4 Todesflucht
- 2.5 Lebensflucht.
- 3. Das Motiv des versäumten Lebens bei Max Frisch....
- 3.1 Erlebnisunfähigkeit – Wahrnehmungsfilter
- 3.1.1 Stiller
- 3.1.2 Faber
- 3.1.3 Gantenbein.
- 3.2 Beziehungslosigkeit - Scheitern in der Liebe
- 3.2.1 Stiller
- 3.2.2 Faber.
- 3.2.2 Gantenbein.
- 3.3 Verzerrte Zeiterfahrung – Verlust der Gegenwart..
- 3.3.1 Stiller
- 3.3.2 Faber..
- 3.3.3. Gantenbein..
- 3.5 Todesflucht - Angst vorm Alter.
- 3.5.1 Stiller
- 3.4.2 Faber.
- 3.4.3 Gantenbein....
- 3.5 Lebensflucht statt Lebenserkenntnis
- 3.5.1 Stiller
- 3.5.2 Faber.
- 3.5.3 Gantenbein..
- 4. Synopse: Stiller, Faber und Gantenbein.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Søren Kierkegaards Philosophie auf das Werk von Max Frisch, insbesondere im Hinblick auf das Motiv des versäumten Lebens. Der Fokus liegt auf der Analyse von drei Romanen Frischs: "Mein Name sei Gantenbein", "Homo faber" und "Stiller".
- Existenzphilosophische Konzepte Kierkegaards, insbesondere das ästhetische und ethische Stadium
- Die Kategorien des versäumten Lebens, die in der Arbeit vorgestellt werden: Erlebnisunfähigkeit, Beziehungslosigkeit, Zeitverlust, Todesflucht und Lebensflucht
- Die Darstellung dieser Kategorien anhand der Figuren in den Romanen von Max Frisch
- Die Verbindung zwischen Schriftstellerexistenz und dem Motiv des versäumten Lebens
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Protagonisten der drei Romane
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die philosophischen Konzepte von Søren Kierkegaard, insbesondere die Unterscheidung zwischen dem ästhetischen und dem ethischen Stadium. Es wird auch auf die Relevanz der Schriftstellerexistenz für das Thema des versäumten Lebens eingegangen.
Im zweiten Kapitel werden fünf Kategorien des versäumten Lebens definiert: Erlebnisunfähigkeit, Beziehungslosigkeit, Zeitverlust, Todesflucht und Lebensflucht. Diese Kategorien bilden den Rahmen für die Analyse der Romane von Max Frisch.
Kapitel drei widmet sich der Analyse der drei Romane: "Mein Name sei Gantenbein", "Homo faber" und "Stiller". Für jede Figur wird untersucht, wie sie sich in Bezug auf die zuvor definierten Kategorien des versäumten Lebens verhält.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Søren Kierkegaards Philosophie auf das Werk von Max Frisch, insbesondere mit dem Motiv des versäumten Lebens. Schlüsselbegriffe sind: ästhetisches Stadium, ethisches Stadium, Erlebnisunfähigkeit, Beziehungslosigkeit, Zeitverlust, Todesflucht, Lebensflucht, Schriftsteller, Max Frisch, "Mein Name sei Gantenbein", "Homo faber", "Stiller".
- Quote paper
- Renate Enderlin (Author), 2005, Kierkegaards Einfluss und Motive des versäumten Lebens bei Max Frisch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36285