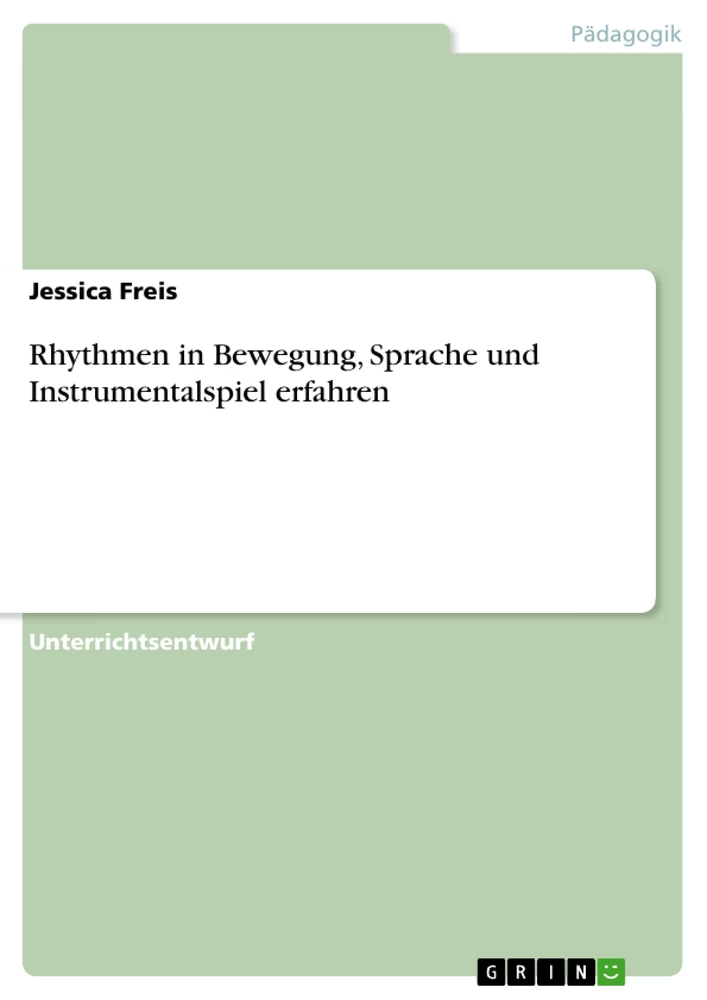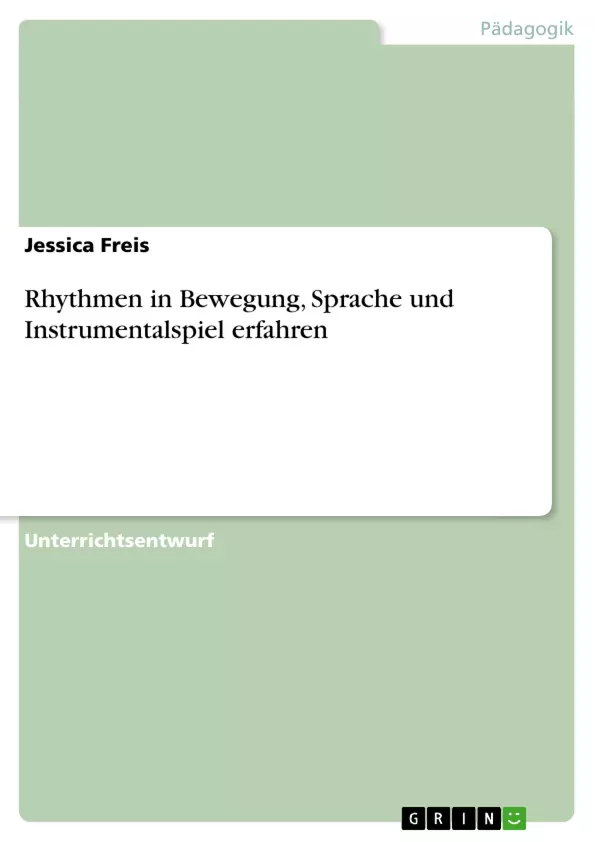Begründung des Themas und Richtlinienbezug
Im Vordergrund des Musikunterrichts steht momentan die Entwicklung der rhythmischen Fähigkeiten der Schüler. Über Bewegung, körpereigene Instrumente, Sprache und Instrumentalspiel wurden bislang verschiedene Zugangsweisen gegeben. Da das Gefühl für regelmäßig wiederkehrende Impulse noch nicht ausreichend ausgebildet ist, habe ich das Thema „Stomp“ als Anreiz zur Fortsetzung und Vertiefung des rhythmischen Spiels gewählt.
Im Sinne des Hessischen Kultusministeriums meint Musikmachen, „mit [...] Instrumenten und allerlei Gegenständen und Geräten Klänge hervorbringen und sie nach verschiedenen Gesichtspunkten und Regeln gestalten“ (7). Da der Bereich Rhythmik hier nicht explizit beschrieben wird, habe ich den Grundplan der Schule für Lernbehinderte in Nordrhein-Westfalen (Lernstufe 3) hinzugezogen. Demnach sollen die Schüler „einfache Eintaktrhythmen und auch stärker strukturierte rhythmische Gestalten von zwei Takten Länge ausführen können. Im Zusammenhang mit dem rhythmischen Musizieren soll der Schüler ein- und zweitaktige rhythmische Schemata – auf einer Linie notiert – lesen und abschreiben können“ (28).
Inhaltsverzeichnis
- Begründung des Themas und Richtlinienbezug
- Sachanalyse
- Rhythmus
- Notation
- Form
- Instrumentalspiel
- Lernvoraussetzungen
- Allgemeine Lernvoraussetzungen
- Individuelle Lernvoraussetzungen
- Lernziele
- Grobziel
- Feinziele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, die rhythmischen Fähigkeiten der Schüler durch die Komposition und das gemeinsame Spiel von Rhythmus-Pattern zu vertiefen. Der Fokus liegt auf der Verwendung von Küchenutensilien als Instrumente und der Anwendung traditioneller Notationsmethoden zur Fixierung und Interpretation von Musik.
- Vertiefung der rhythmischen Fähigkeiten
- Komposition von Rhythmus-Pattern
- Gemeinsames Musizieren mit Küchenutensilien
- Anwendung traditioneller Notation
- Entwicklung von rhythmischen Spieltechniken
Zusammenfassung der Kapitel
Begründung des Themas und Richtlinienbezug
Der Unterrichtsentwurf befasst sich mit der Förderung der rhythmischen Fähigkeiten der Schüler. Es wird die Relevanz des Themas ,,Stomp“ im Hinblick auf die Richtlinien des Hessischen Kultusministeriums und des Grundplans der Schule für Lernbehinderte in Nordrhein-Westfalen erörtert.
Sachanalyse
Die Sachanalyse beschäftigt sich mit den Begriffen Rhythmus, Notation, Form und Instrumentalspiel. Es wird die Bedeutung von Rhythmus-Pattern und deren Notation sowie die Anwendung von Alltagsmaterialien als Instrumente im Unterricht beleuchtet.
Lernvoraussetzungen
Die Lernvoraussetzungen der Schüler werden sowohl allgemein als auch individuell betrachtet. Es wird der Umgang mit Notation, spieltechnische Fähigkeiten und die individuellen Bedürfnisse und Stärken der Schüler erläutert.
Lernziele
Der Unterrichtsentwurf definiert ein Grobziel und mehrere Feinziele, die die Vertiefung der rhythmischen Fähigkeiten der Schüler durch die Komposition und das gemeinsame Spiel von Rhythmus-Pattern beschreiben.
Schlüsselwörter
Rhythmus, Rhythmus-Pattern, Notation, Küchenutensilien, Instrumentalspiel, Stomp, Bodypercussion, Lernbehinderung, Grobziel, Feinziele.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Musikprojekts "Stomp"?
Ziel ist die Vertiefung rhythmischer Fähigkeiten durch das Musizieren mit Alltagsgegenständen (Küchenutensilien) und die Entwicklung eigener Rhythmus-Pattern.
Welche Instrumente werden im Unterricht verwendet?
Statt klassischer Instrumente kommen Küchenutensilien und "körpereigene Instrumente" (Bodypercussion) zum Einsatz.
Wie wird Rhythmus in diesem Entwurf notiert?
Die Schüler lernen, einfache ein- und zweitaktige rhythmische Schemata auf einer Linie zu lesen, zu schreiben und umzusetzen.
Für welche Zielgruppe ist dieser Unterrichtsentwurf konzipiert?
Der Entwurf orientiert sich an den Richtlinien für Schulen für Lernbehinderte (Lernstufe 3) in Hessen und Nordrhein-Westfalen.
Welche feinmotorischen Ziele werden verfolgt?
Neben dem Rhythmusgefühl werden spezifische Spieltechniken und die Koordination von Bewegung und Klang gefördert.
- Citar trabajo
- Jessica Freis (Autor), 2004, Rhythmen in Bewegung, Sprache und Instrumentalspiel erfahren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36322