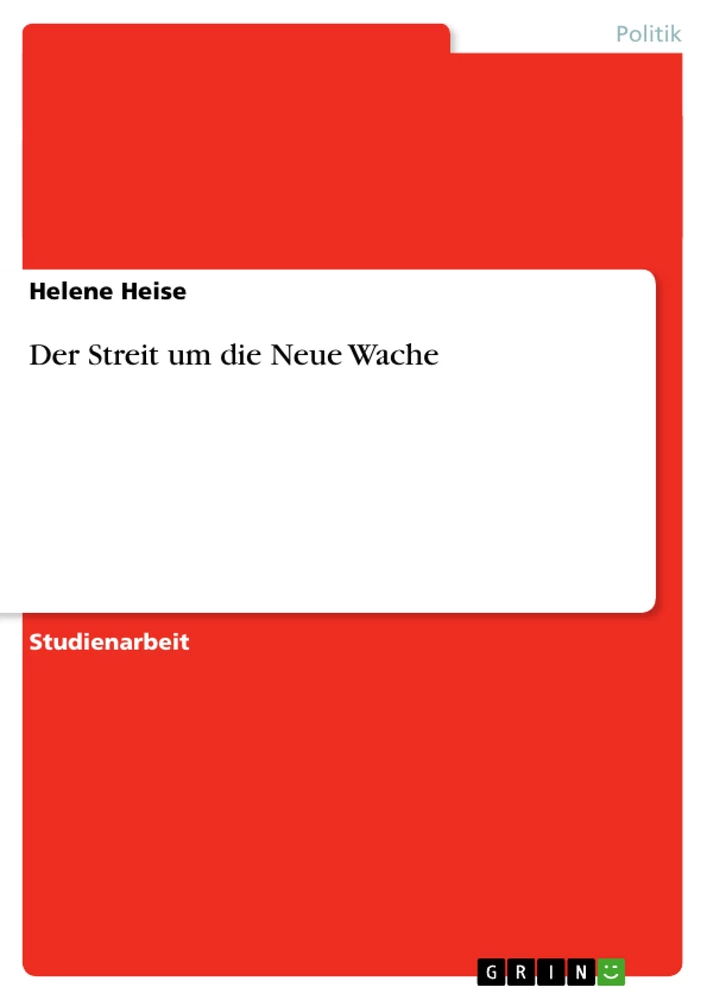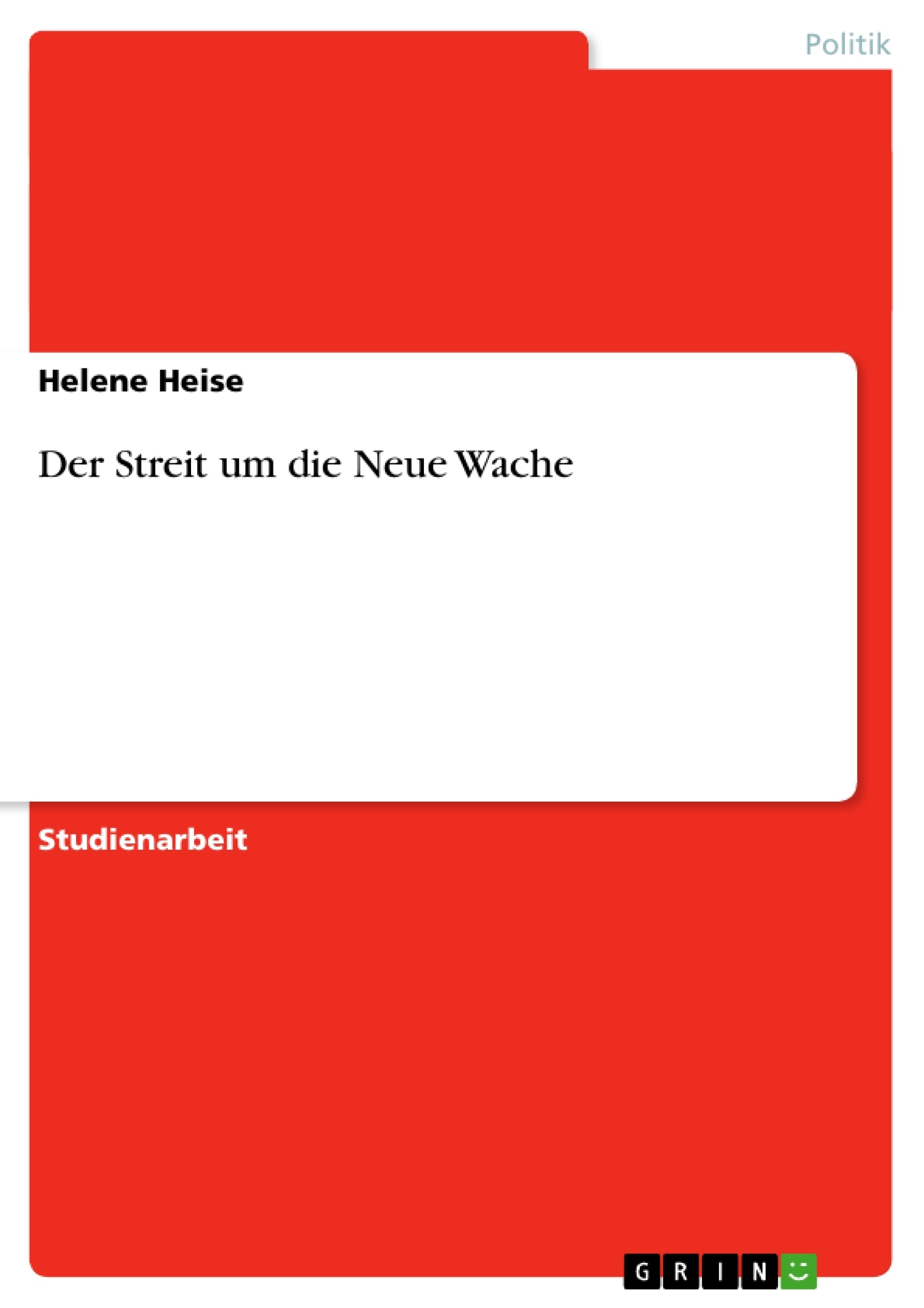Einleitung
Am 14. November 1993, dem Volkstrauertag, wurde die Neue Wache unter den Linden als „Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland“ für „die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“ eingeweiht. Im von Karl Friedrich Schinkel erbauten Nutzbau, der nach Entwürfen Heinrich von Tessenows in den 1930er-Jahren zur Gedenkstätte für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs umgestaltet worden war und danach der DDR als zentrales Mahnmal für die „Opfer von Faschismus und Militarismus“ gedient hatte, befand sich nun eine auf Lebensgröße „aufgeblasene“1 Skulptur der Künstlerin Käthe Kollwitz, die „Mutter mit totem Sohn“. Der Einweihung der Gedenkstätte war ein kurzer, aber heftiger Streit um ihre künstlerische Gestaltung und die Widmung vorausgegangen.
Die Debatte um die Neue Wache hatte einmal mehr die Deutung der NSVergangenheit zum Thema, wie dies in den 1980er-Jahren schon in vielen Diskussionen um Geschichte, Erinnerung und Gedenken stattgefunden hatte. Ob in der Diskussion um Helmut Kohls „Museumsgeschenke“, ein zentrales „Ehrenmal“ für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in Bonn, den 8. Mai 1985 oder dem Historikerstreit – immer wieder wurde die Geschichte zum Gegenstand innenpolitischer Auseinandersetzungen. In diesem Fall entzündete sich der Streit sowohl an dem durch die Umgestaltung der Neuen Wache ablesbaren Geschichtsbild wie an der Geschichte des Ortes selbst. Wiederholt wurde in Frage gestellt, ob die Neue Wache wegen der verschiedenen historischen Verwendungen als zentrale Gedenkstätte überhaupt geeignet sei. So hatte das Gebäude bereits vier verschiedenen politischen Systemen als Mahnmal oder Gedenkstätte gedient: Im Kaiserreich war sie Denkmal für die Befreiungskriege gewesen, in der Weimarer Republik Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, in der NS-Zeit wurde sie als „Reichsehrenma“ in politisch- militärische Inszenierungen und Aufmärsche einbezogen und die DDR widmete sie zur zentralen Gedenkstätte für beide Weltkriege und den zum Gründungsmythos der DDR hochstilisierten Anti-Faschistischen Widerstand der NS-Zeit um. Im Folgenden soll der Streit um die Neue Wache von 1993 untersucht werden. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, welches Geschichtsbild die verschiedenen Akteure der Debatte vertreten. Lässt sich dieses auch in den Vorschlägen zur Gestaltung der Neuen Wache ablesen? Und inwiefern kann dieses Geschichtsbild in Geschichtspolitik umgesetzt werden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Vorgeschichte des Ortes
- 3. Die Vorgeschichte der Debatte
- 4. Die Debatte
- 4.1 Themen und Akteure
- 4.2 Das Geschichtsbild und sein Ausdruck in der Gestaltung
- 4.3 Rückschlüsse auf die Geschichtspolitik beider Gruppen
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Streit um die Gestaltung und Widmung der Neuen Wache als zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1993. Im Mittelpunkt steht die Analyse der unterschiedlichen Geschichtsbilder der beteiligten Akteure und deren Ausdruck in den Gestaltungsvorschlägen. Die Arbeit beleuchtet, wie diese Geschichtsbilder in die Geschichtspolitik umgesetzt werden sollten und welche Rolle die Geschichte des Ortes selbst in der Debatte spielte.
- Das Geschichtsbild der beteiligten Akteure im Streit um die Neue Wache
- Der Einfluss der Vorgeschichte des Ortes auf die Debatte
- Der Zusammenhang zwischen Geschichtsbild, Gestaltung und Geschichtspolitik
- Die Rolle der Neuen Wache in verschiedenen politischen Systemen
- Der Vergleich mit anderen geschichtspolitischen Debatten der 1980er Jahre
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in den Streit um die Neue Wache als zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland ein. Sie beschreibt die Einweihung der Gedenkstätte am 14. November 1993 und die vorherige kontroverse Debatte um deren künstlerische Gestaltung und Widmung. Die Arbeit stellt die Debatte in den Kontext anderer geschichtspolitischer Auseinandersetzungen der 1980er Jahre und betont die Bedeutung der Deutung der NS-Vergangenheit. Die zentrale Fragestellung der Arbeit wird formuliert: Welche Geschichtsbilder vertraten die verschiedenen Akteure, wie spiegelten sich diese in den Gestaltungsvorschlägen wider, und wie konnten diese Geschichtsbilder in die Geschichtspolitik umgesetzt werden? Der methodische Ansatz, die Geschichte der Neuen Wache und die vorherigen geschichtspolitischen Debatten zu untersuchen, wird skizziert.
2. Die Vorgeschichte des Ortes: Dieses Kapitel beschreibt die Geschichte der Neuen Wache von ihrem Bau im Jahre 1816 bis 1993. Es zeigt, wie das Gebäude unter verschiedenen politischen Systemen – Kaiserreich, Weimarer Republik, NS-Zeit und DDR – unterschiedliche Funktionen als Mahnmal und Gedenkstätte hatte. Der Bau von Karl Friedrich Schinkel, ursprünglich als Wachlokal konzipiert, wurde als Denkmal für die Befreiungskriege genutzt, später als Ehrenmal für Gefallene des Ersten Weltkriegs umfunktioniert und schließlich von der NS-Diktatur und der DDR für eigene Propagandazwecke instrumentalisiert. Diese vielschichtige Geschichte des Gebäudes bildet den entscheidenden Hintergrund für die 1993 geführte Debatte um seine zukünftige Nutzung als zentrale Gedenkstätte.
3. Die Vorgeschichte der Debatte: Dieses Kapitel, obwohl nicht explizit benannt, wird implizit im Text behandelt und beleuchtet die geschichtspolitischen Debatten der 1980er Jahre als Vorläufer des Streits um die Neue Wache. Es wird hier auf den "Historikerstreit", die Diskussion um Helmut Kohls "Museumsgeschenke" und den 8. Mai 1985 eingegangen, um die Kontinuität und die bereits bestehenden Konflikte und Streitlinien zu verdeutlichen, die den Streit von 1993 prägten. Diese Vorgeschichte verdeutlicht, dass die Debatte um die Neue Wache nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern Teil eines größeren Prozesses der Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit ist.
4. Die Debatte: Dieses Kapitel analysiert die Debatte um die Neue Wache von 1993 detailliert. Es untersucht die beteiligten Akteure und deren jeweilige Geschichtsbilder, die sich in den Gestaltungsvorschlägen für die Gedenkstätte ausdrückten. Es wird der Einfluss dieser Geschichtsbilder auf die Geschichtspolitik beleuchtet, indem analysiert wird, wie die unterschiedlichen Interpretationen der Vergangenheit den Versuch einer nationalen Erinnerungskultur beeinflussten. Die Unterkapitel beleuchten die konkreten Aspekte der Debatte, wie beispielsweise die verschiedenen Themen und Positionen der Streitparteien und deren Einfluss auf die endgültige Gestaltung der Gedenkstätte.
Schlüsselwörter
Neue Wache, Gedenkstätte, Geschichtspolitik, Erinnerungskultur, NS-Vergangenheit, Geschichtsbild, Deutungskämpfe, Erinnerungspolitik, Bundesrepublik Deutschland, Identitätsbildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie "Die Neue Wache: Ein geschichtspolitischer Streit 1993"
Was ist der Gegenstand der Studie?
Die Studie analysiert den 1993 geführten Streit um die Gestaltung und Widmung der Neuen Wache als zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung der unterschiedlichen Geschichtsbilder der beteiligten Akteure und deren Einfluss auf die Gestaltungsvorschläge und die Geschichtspolitik.
Welche Themen werden in der Studie behandelt?
Die Studie behandelt die Vorgeschichte des Ortes (Neue Wache) und die Vorgeschichte der Debatte (inkl. Bezug zu anderen geschichtspolitischen Debatten der 1980er Jahre). Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Debatte selbst, einschließlich der beteiligten Akteure, deren Geschichtsbilder und deren Ausdruck in den Gestaltungsvorschlägen. Es wird der Zusammenhang zwischen Geschichtsbild, Gestaltung und Geschichtspolitik untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Vorgeschichte des Ortes (Neue Wache), Vorgeschichte der Debatte (implizit im Text behandelt), Die Debatte (mit Unterkapiteln zu Themen/Akteuren, Geschichtsbild und Gestaltung, sowie Rückschlüsse auf die Geschichtspolitik) und Schlussfolgerung.
Wie wird die Debatte um die Neue Wache analysiert?
Die Analyse der Debatte fokussiert auf die beteiligten Akteure und deren unterschiedliche Geschichtsbilder. Es wird untersucht, wie sich diese Geschichtsbilder in den konkreten Gestaltungsvorschlägen widerspiegelten und wie sie die Geschichtspolitik beeinflussten. Die Studie beleuchtet den Einfluss der Geschichte des Ortes auf die Debatte und setzt diese in den Kontext anderer geschichtspolitischer Auseinandersetzungen der 1980er Jahre.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Studie?
Schlüsselwörter sind: Neue Wache, Gedenkstätte, Geschichtspolitik, Erinnerungskultur, NS-Vergangenheit, Geschichtsbild, Deutungskämpfe, Erinnerungspolitik, Bundesrepublik Deutschland, Identitätsbildung.
Welche zentrale Fragestellung wird in der Studie bearbeitet?
Die zentrale Fragestellung lautet: Welche Geschichtsbilder vertraten die verschiedenen Akteure, wie spiegelten sich diese in den Gestaltungsvorschlägen wider, und wie konnten diese Geschichtsbilder in die Geschichtspolitik umgesetzt werden?
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Studie untersucht die Geschichte der Neuen Wache und die vorherigen geschichtspolitischen Debatten, um die Debatte von 1993 im Kontext zu betrachten und zu analysieren.
Welche Rolle spielt die Vorgeschichte der Neuen Wache?
Die vielschichtige Geschichte der Neuen Wache unter verschiedenen politischen Systemen (Kaiserreich, Weimarer Republik, NS-Zeit, DDR) bildet den entscheidenden Hintergrund für die Debatte von 1993. Die unterschiedlichen Funktionen des Gebäudes als Mahnmal und Gedenkstätte in der Vergangenheit werden als wichtige Einflussfaktoren analysiert.
Welche Bedeutung haben die geschichtspolitischen Debatten der 1980er Jahre?
Die geschichtspolitischen Debatten der 1980er Jahre (z.B. Historikerstreit, Kohls "Museumsgeschenke", 8. Mai 1985) werden als Vorläufer und Kontext für den Streit um die Neue Wache betrachtet. Sie zeigen die Kontinuität und bereits bestehenden Konflikte, die die Debatte von 1993 prägten.
- Citation du texte
- Helene Heise (Auteur), 2004, Der Streit um die Neue Wache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36329