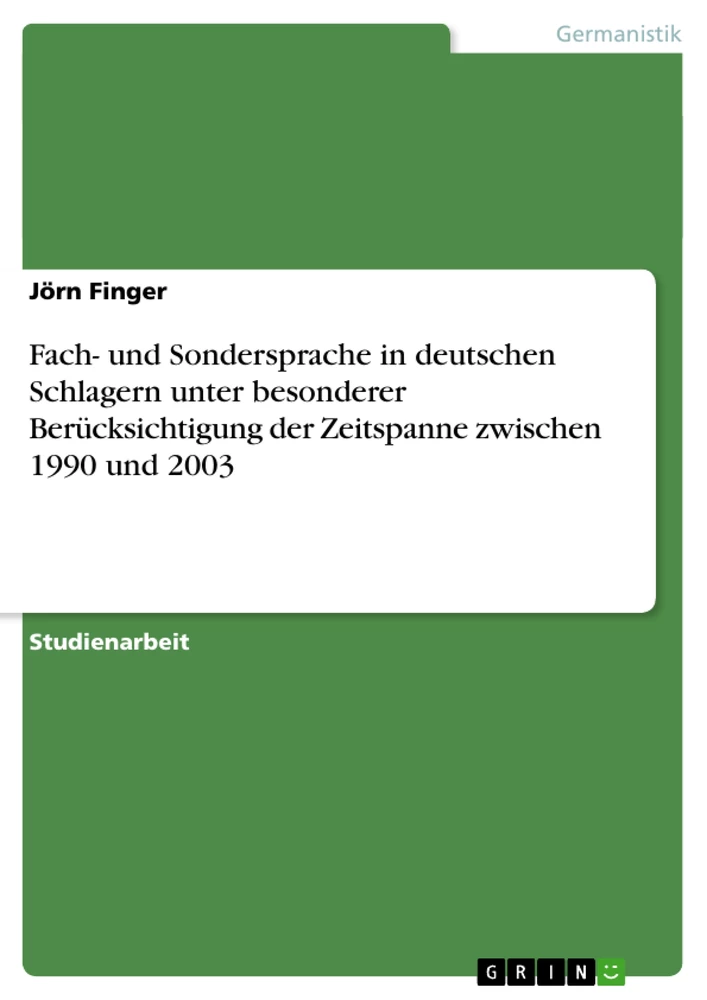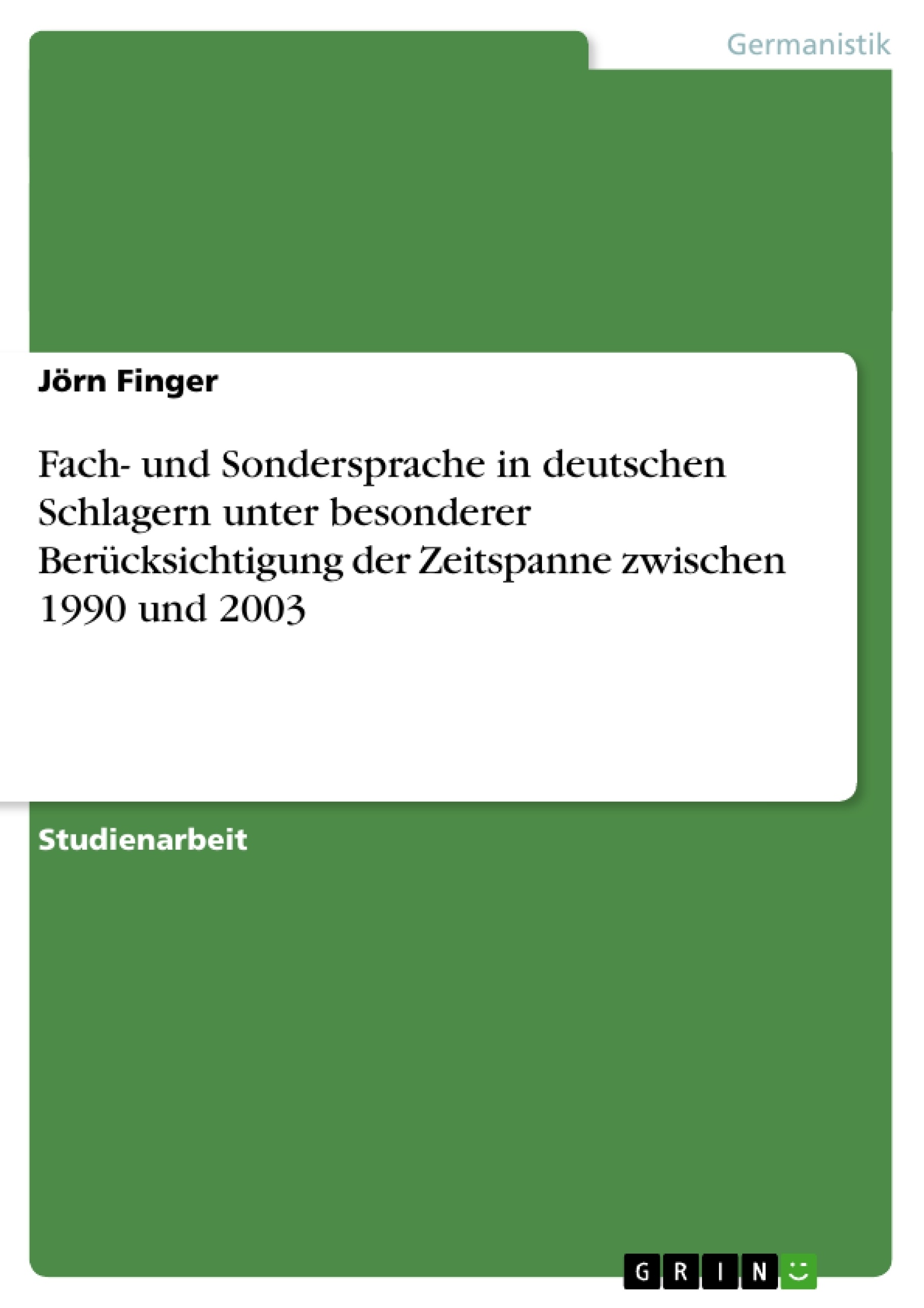Musik und Sprache sind in Deutschland zu einer gemeinsamen Einheit verschmolzen. Man kann sogar noch weiter gehen und sagen, dass in Deutschland Musik zum Leben mit dazugehört. Dieter Thomas Heck, einst Moderator der legendären „ZDF-Hitparade“, sprach in einem Interview sogar davon, dass in Deutschland Musik mit „zum Lebensstandart“ und deswegen „unverzichtbar“ sei. Musik verbindet Generationen und lässt stets an einem bestimmten Lebensgefühl teilhaben. Und genau diese Verbindung von Generationen, der Ausdruck eines bestimmten Lebensgefühls und die Vermittlung von Botschaften geschieht in der Musik über die Sprache. Sprache hat sich mehr und mehr in der Musik eine Verbreitungsform erschaffen, auf die viele Personen hören und sie zugleich auch bewusst wahrnehmen.
Als „Sprachrohr“ hat sich in Deutschland ebenfalls in den letzten Jahrzehnten der Deutsche Schlager entwickelt, da in den entsprechenden Liedern nicht auf englisch, sondern in Deutscher Sprache Botschaften, Liebesbekundungen und Friedensaufrufe erörtert werden. Während die englische Popmusik in Deutschland eher Jugendliche anspricht, so gibt es beim Deutschen Schlager einen generationsübergreifenden Zuhörerstamm, der zu einer Altersstruktur von fünf Jahren bis hundert Jahren führen kann.
Die Sprache im Deutschen Schlager hat sich im Laufe der einzelnen Jahrzehnte verändert, sich den in den einzelnen Dekaden politischen und gesellschaftlichen Ereignissen angepasst und auch neue Worte kreiert. Die vorliegende Arbeit soll diesen Sprachwandel in Deutschsprachiger Musik aufzeigen und bewerten. Deswegen wird zunächst eine historische Entwicklung aufgezeigt, um dann anhand von Beispielen den Sprachwandel und die sprachlichen Besonderheiten zu klären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des Begriffs „Schlager“
- Die sprachliche Entwicklung in Deutschen Schlagern in der Zeit von 1970 bis heute
- Titelbeispiel I: „Null-Null-Sieben“ - Olaf Henning
- Titelbeispiel II: „Dein Hexenhäuschen brennt“ - Michael Wendler
- Fazit und Schlussbewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der sprachlichen Entwicklung des Deutschen Schlagers von 1970 bis 2003. Sie untersucht die Veränderungen, die die Sprache in der deutschen Musik während dieser Zeit durchgemacht hat, und analysiert, wie diese Veränderungen mit politischen und gesellschaftlichen Ereignissen der jeweiligen Dekaden zusammenhängen.
- Die Entwicklung der Sprache im Deutschen Schlager von 1970 bis 2003
- Einfluss von politischen und gesellschaftlichen Ereignissen auf die Sprache des Schlagers
- Analyse von Titelbeispielen, die den Sprachwandel veranschaulichen
- Bedeutung der Sprache für die Vermittlung von Botschaften und Lebensgefühlen in der Musik
- Der Deutsche Schlager als „Sprachrohr“ der deutschen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Bedeutung von Musik und Sprache in der deutschen Gesellschaft dar und betont den Deutschen Schlager als Sprachrohr. Es wird auf die Bedeutung der Sprache für die Vermittlung von Botschaften und Lebensgefühlen hingewiesen, und der Sprachwandel im Deutschen Schlager wird als Gegenstand der Untersuchung vorgestellt.
- Definition des Begriffs „Schlager“: Dieses Kapitel liefert eine Definition des Begriffs „Schlager“ und diskutiert die Rolle des Textes im Schlager. Es wird auf die Entwicklung des Schlagers von „trivialen Texten“ hin zu witzigen, originellen und teilweise sogar anspruchsvollen sprachlichen Strukturen hingewiesen.
- Die sprachliche Entwicklung in Deutschen Schlagern von 1970 bis heute: Dieses Kapitel skizziert die sprachliche Entwicklung des Deutschen Schlagers von 1970 bis heute. Es werden die Einflüsse der jeweiligen Epochen auf die Sprache der Musik beleuchtet und anhand von Beispielen aus verschiedenen Dekaden veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Deutscher Schlager, Sprachwandel, Sprachliche Entwicklung, Musik und Sprache, Botschaften, Lebensgefühl, politische und gesellschaftliche Ereignisse, Textanalyse, Titelbeispiele, Sprachliche Besonderheiten.
- Citar trabajo
- Jörn Finger (Autor), 2004, Fach- und Sondersprache in deutschen Schlagern unter besonderer Berücksichtigung der Zeitspanne zwischen 1990 und 2003, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36378