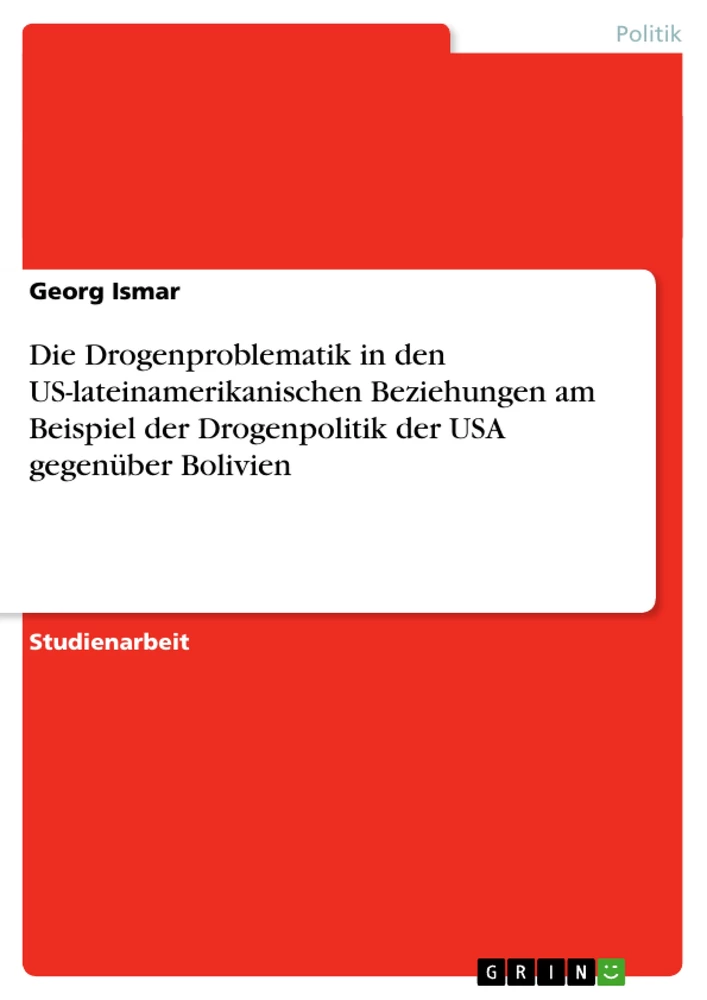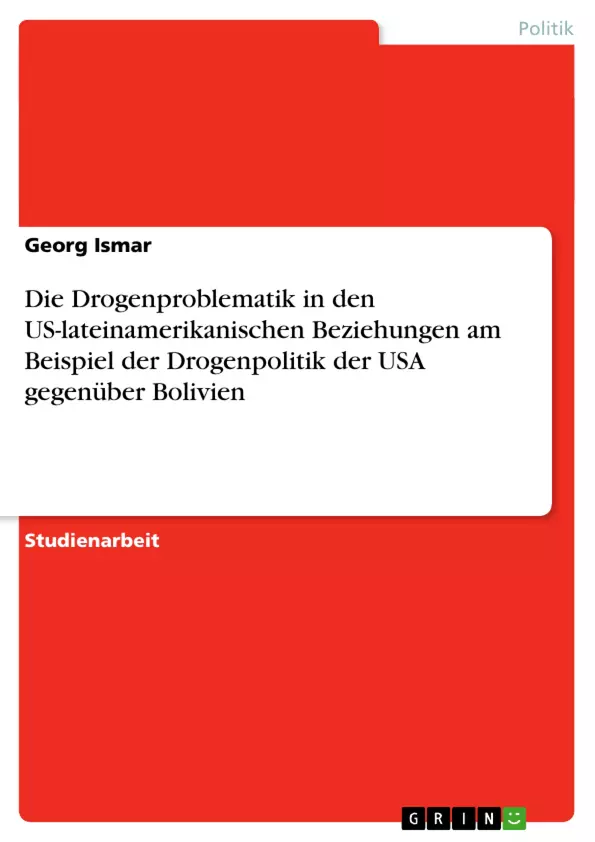Drogenkonsum, Drogenhandel und Drogenproduktion stellen eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts dar. Dabei verschwimmen zunehmend die Grenzen zwischen den Produzentenländern im Süden und den Drogenkonsumenten im Norden. So ist Pakistan mittlerweile der größte Heroinkonsument der Welt. Seit Ende der 80er Jahre versuchen die USA ihren war on drugs verstärkt in den Produzentenländern zu führen, um die Ursprünge der Drogenproblematik wirksamer bekämpfen zu können. Dieser martialische Ausdruck verdeutlicht, welchen Stellenwert die Drogenproblematik in der US-amerikanischen Gesellschaft hat und welcher Druck auf der jeweiligen Administration lastet, erfolgreich gegen die Expansion der Drogenökonomie zu kämpfen. Auf der anderen Seite sind Entwiklungsländer wie Bolivien erheblich von der Drogenproduktion abhängig. Ausgelöst durch den Kokaboom der 70er Jahre wurde die Kokawirtschaft für viele Bauern hier zu einer Überlebensgarantie, da die Kokapflanze einfach zu kultivieren ist, viermal im Jahr geerntet werden kann und ein Vielfaches der Einkünfte anderer agrarischer Produkte bringt. Durch die starke der Einflussnahme der USA geraten Länder wie Bolivien unter doppelten Druck. Einerseits müssen US-amerikanische Eradikationsforderungen in Bezug auf die Hektaranzahl an Kokapflanzungen erfüllt werden. Andererseits gilt es, innenpolitische Unruhen gerade unter der indigenen Bevölkerungsmehrheit aufgrund einer zu restriktiven Anti-Koka-Politik zu vermeiden. Hinzu kommen wirtschaftliche Aspekte. Es gibt weltweit keine zweite Volkswirtschaft, in der die Drogenproduktion eine ähnlich große sozioökonomische Bedeutung hat wie in Bolivien. In dieser Arbeit wird dieses Spannungsverhältnis in den US-bolivianischen Beziehungen aus historischer und aktueller Perspektive beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Drogenpolitik der USA gegenüber Bolivien
- 1. Historische Entwicklung der Koka-Problematik in Bolivien
- 1.1. Die Auswirkungen der Verwicklung der Militärdiktaturen in den Drogenhandel
- 1.2. Legitimation des traditionellen Kokaanbaus als Zugeständnis an die kulturelle Identität
- 1.3. Das Gesetz zur Regelung von Koka und kontrollierter Stoffe (Ley 1008)
- 2. Drogenpolitische Forderungen und Maßnahmen der USA in bezug auf Bolivien
- 2.1. Der „going to the source-Ansatz“ als Antwort auf das Ende des Ost-West-Konflikts
- 2.1.1. Kompensationsleistungen zur Unterstützung der alternativen Entwicklung
- 2.1.2. Auswirkungen der „going to the source“-Politik im militärischen Bereich
- 2.1.3. Aktuelle Entwicklungen der Andeninitiative der USA in Bolivien
- 3. Auswirkungen der US-Drogenpolitik und aktuelle drogenpolitische Zielsetzungen
- 3.1. Auswirkungen der Verweigerung der Certification in Bolivien im Jahre 1995
- 3.2. Cero Coca-Politik der Regierung Banzer/Quiroga
- 3.2.1. Innenpolitische Auswirkungen der Cero Coca-Politik
- 4. Alternativen in der Amerikanisch-Bolivianischen Anti-Drogen-Politik
- 4.1. Behinderung der Alternativen Entwicklung durch den Agrarprotektionismus der USA und der EU
- 4.2. Notwendigkeit der Unterstützung von Entwicklungsprogrammen in den Herkunftsgebieten der Kokabauern
- 4.3. Legalisierung der Kokapflanze als falsche Alternative
- III. Fazit und Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Drogenpolitik der USA gegenüber Bolivien und untersucht die Problematik der Kokakultivation in Bolivien im Kontext der US-amerikanischen Anti-Drogen-Strategie. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der Koka-Problematik in Bolivien, die drogenpolitischen Forderungen und Maßnahmen der USA und die Auswirkungen der US-Drogenpolitik auf Bolivien.
- Die historische Entwicklung der Koka-Problematik in Bolivien
- Die US-amerikanische Drogenpolitik und ihr "going to the source"-Ansatz
- Die Auswirkungen der US-Drogenpolitik auf Bolivien
- Die Rolle der alternativen Entwicklung in der Drogenbekämpfung
- Die innenpolitischen Auswirkungen der US-Drogenpolitik in Bolivien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Drogenproblematik im 21. Jahrhundert ein und erläutert die Bedeutung der US-amerikanischen Anti-Drogen-Strategie im globalen Kontext. Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Koka-Problematik in Bolivien und untersucht die Verflechtung der Militärdiktaturen in die Drogenökonomie. Es wird die Legitimation des traditionellen Kokaanbaus als Zugeständnis an die kulturelle Identität und die Einführung des Gesetzes zur Regelung von Koka und kontrollierter Stoffe (Ley 1008) analysiert.
Das dritte Kapitel widmet sich den drogenpolitischen Forderungen und Maßnahmen der USA in bezug auf Bolivien. Es wird der "going to the source"-Ansatz im Kontext des Endes des Ost-West-Konflikts vorgestellt und die Auswirkungen der US-amerikanischen Drogenpolitik im militärischen Bereich sowie die aktuellen Entwicklungen der Andeninitiative der USA in Bolivien beleuchtet. Das vierte Kapitel analysiert die Auswirkungen der US-Drogenpolitik auf Bolivien, insbesondere die Auswirkungen der Verweigerung der Certification im Jahre 1995 und die "Cero Coca"-Politik der Regierung Banzer/Quiroga. Die innenpolitischen Auswirkungen der "Cero Coca"-Politik werden ebenfalls untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Drogenpolitik, Koka-Problematik, US-Lateinamerikanische Beziehungen, Bolivien, "going to the source"-Ansatz, alternative Entwicklung, Certification, "Cero Coca"-Politik, Innenpolitik, Kokabauern, Drogenhandel, nationale Sicherheit, kulturelle Identität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der 'War on Drugs'?
Dies ist ein von den USA geprägter Begriff für eine martialische Anti-Drogen-Politik, die versucht, die Drogenproblematik direkt in den Produzentenländern (wie Bolivien) zu bekämpfen.
Warum ist der Kokaanbau für Bolivien so wichtig?
Die Kokapflanze ist einfach zu kultivieren, kann viermal jährlich geerntet werden und sichert vielen Bauern das Überleben, da sie lukrativer als andere agrarische Produkte ist.
Was bedeutet der 'going to the source'-Ansatz?
Dieser Ansatz der US-Drogenpolitik zielt darauf ab, die Produktion von Drogen direkt an ihrem Ursprung durch Vernichtung (Eradikation) der Pflanzen zu unterbinden.
Was war die 'Cero Coca'-Politik?
Es war eine restriktive Anti-Koka-Politik der bolivianischen Regierung Banzer/Quiroga, die unter starkem US-Druck stand und zu massiven innenpolitischen Unruhen führte.
Gibt es Alternativen zur Koka-Vernichtung?
Diskutiert werden Programme zur 'alternativen Entwicklung', die jedoch oft durch Agrarprotektionismus der USA und EU behindert werden.
- Citar trabajo
- Georg Ismar (Autor), 2002, Die Drogenproblematik in den US-lateinamerikanischen Beziehungen am Beispiel der Drogenpolitik der USA gegenüber Bolivien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36422