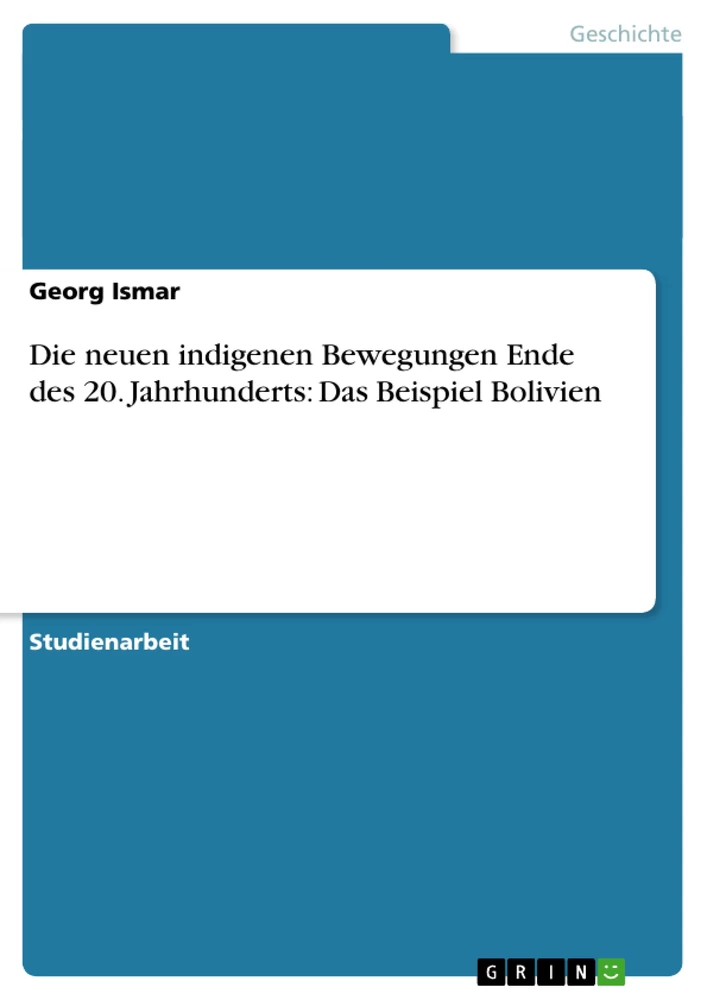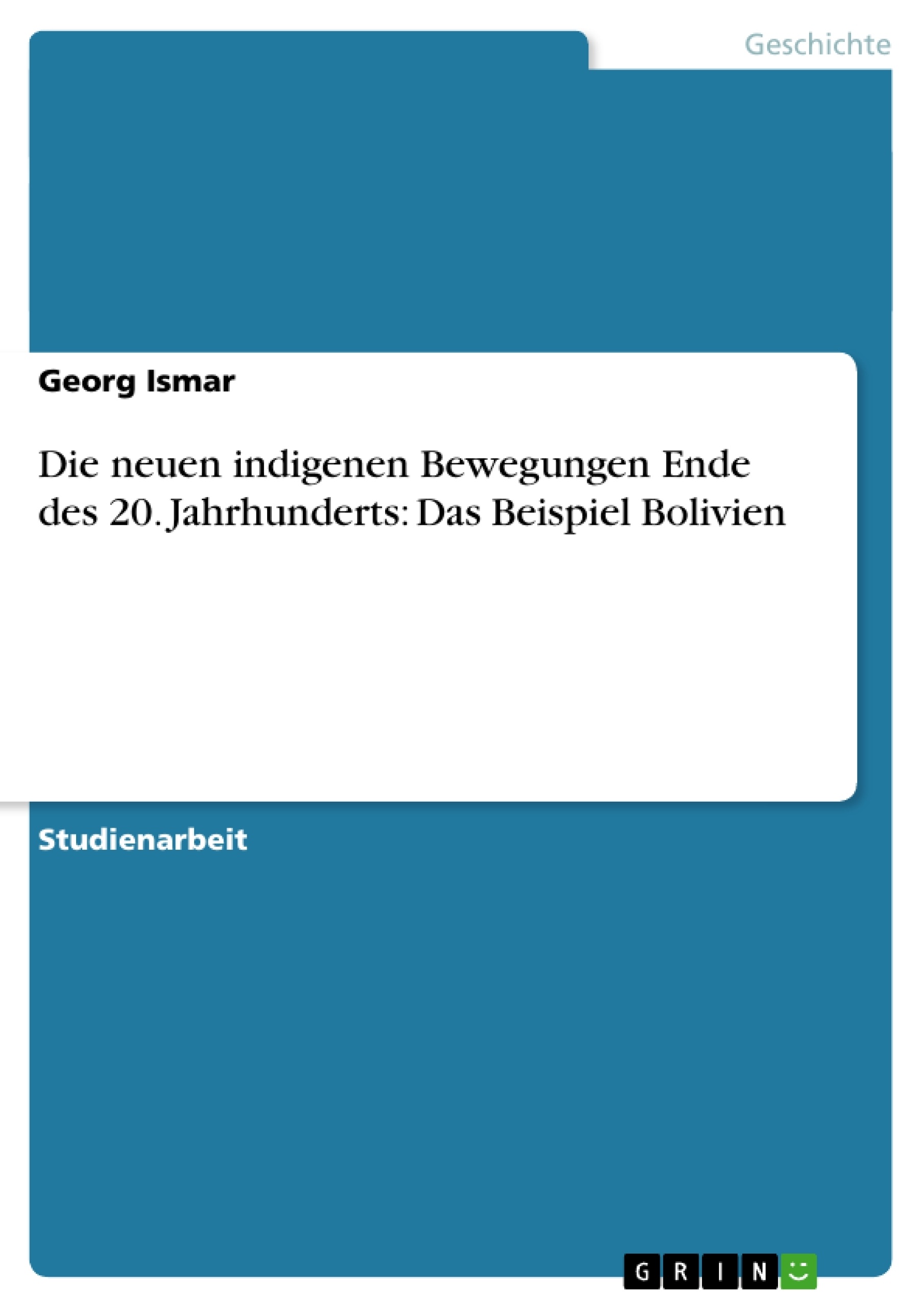Im Fall Boliviens ist seit dem Ende der Militärdiktaturen 1982 eine verstärkte Eigenständigkeit und Eigendynamik der indigenen Bewegungen zu beobachten. Seit der Revolution von 1952 waren sie von den herrschenden Eliten durch Assimilierung oder spezielle Bündnisse wie den pacto militar-campesino an einer eigenständigen Interessenvertretung gehindert worden. Mit der Kataristenbewegung zu Beginn der siebziger Jahre, der Gründung der Bauerngewerkschaft CSUTCB (Confederácion Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) 1979, der Entstehung indigene Interessen in den Vordergrund stellender Parteien wie der CONDEPA (Conciencia de Patria) und schließlich der verstärkten Artikulation der Forderungen nach Land und Rechten durch die indigenen Bewegungen des Tieflandes übten diese ethnischen Gruppen immer stärkeren Druck auf den Staat aus, teilweise begleitet von sozialen Unruhen. Die Antwort des Staates konnte in diesem Kontext nicht wie in der Vergangenheit aus einer Mischung von Igno-ranz, symbolischer Rhetorik und minimalen Zugeständnissen bestehen, sondern musste einen tiefgreifenden Wandel in die Wege leiten. Personal drückte sich dies mit der Berufung des Aya-mara Victor Hugo Cárdenas zum Vizepräsidenten 1993 aus. Auf der administrativen Ebene fand der gesellschaftliche Wandel seinen Ausdruck in der Absage an das Konzept der mestizaje, der Einführung des Ley de Particpación Popular zur Stärkung der lokalen Strukturen und Schaffung von mehr Partizipations- und Mitverantwortungsmöglichkeiten und in der Einführung eines mehrsprachigen Bildungssystems. Diese Arbeit analysiert neben der historischen Darstellung, wie es konkret zum Entstehen der neuen indigenen Bewegungen Anfang der achtziger Jahre kam. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich der unterschiedlichen Ansätze der indigenen Bevölkerung des Hochlandes und der Amazonasregion.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die neuen indigenen Bewegungen in Bolivien: Zwischen Konfrontation, Kooperation und interner Fragmentierung.
- 1. Das Verhältnis des Staates zu den indigen Bevölkerungsgruppen nach der Revolution von 1952
- 1.1. Vereinnahmung durch das MNR und das Militär.
- 1.2. Entstehung des Katarismo: Das Manifest von Tiwanaku 1973.
- 1.3. Die Gründung der Campesinogewerkschaft CSUTCB.…...
- 2. Die indigenen Bewegungen des Hochlandes: Zwischen Konfrontation und Pragmatismus
- 2.1. Die Rolle der Campesinogewerkschaft CSUTCB.
- 2.2. Diskrepanz zwischen Führung und Basis
- 2.3. Die Rolle indigener Parteien……......
- 2.3.1. Die Rolle der CONDEPA
- 2.4. Neue Bewegungen indigener Gruppen im Hochland Tieflandes und ihre Forderung nach Tierra und Dignidad.
- 3. Ruf nach dem Staat als Protektor: Die indigenen Bewegungen des
- 3.1. Die Gründung des Dachverbandes CIDOB..
- 3.2. Der Marsch für Territorium und Würde nach La Paz………………………..\n
- 3.3. Die Rolle des 500. Jahrestages der Eroberung Amerikas
- 4. Eine Sonderform indigener Bewegungen: Die Cocaleros des Chapare.
- 4.1. Konsequenzen des unregulierten Vordringens des Kokaanbaus
- 4.2. Ethnizität und kulturelle Eigenheiten als Instrumente zur Durchsetzung ökonomischer Interessen.
- 5. Die Reaktion des Staates..........\n
- 5.1. Die Vizepräsidentschaft von Victor Hugo Cárdenas
- 5.2. Das Ley de Participación Popular...
- 5.2.1. Die Bedeutung des LPP für die indigenen Völker.
- 5.2.2. Allgemeine Kritik am LPP.
- 5.2.3. Die Reaktion der indigenen Gruppen: Zwischen Konfrontation und Zustimmung
- Die Rolle des Staates im Umgang mit den indigenen Bevölkerungsgruppen nach der Revolution von 1952.
- Die Entstehung und Entwicklung des Katarismo und die Gründung der Campesinogewerkschaft CSUTCB.
- Die spezifischen Herausforderungen und Strategien der indigenen Bewegungen im Hochland und im Tiefland.
- Die Rolle des Ley de Participación Popular (LPP) als staatliche Antwort auf die Forderungen der indigenen Bevölkerung.
- Der Sonderfall der Cocaleros und ihre Instrumentalisierung von Ethnizität und Kultur zur Durchsetzung ökonomischer Interessen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entstehung der neuen indigenen Bewegungen in Bolivien, die Ende des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Sie analysiert die verschiedenen Ursachen und Entwicklungen, die zur Mobilisierung der indigenen Bevölkerung führten und betrachtet dabei die unterschiedlichen Ansätze und Strategien der indigenen Gruppen des Hochlandes und des Tieflandes.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung beleuchtet den Wandel in der bolivianischen Gesellschaft hin zu einem multiethnischen und plurikulturellen Staat, der in der Verfassungsreform von 1994 seinen Ausdruck fand. Die Arbeit stellt die Frage, wie es zu diesem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel kam und welche Ursachen auf Makro- und Mikroebene dazu führten.
II. Die neuen indigenen Bewegungen in Bolivien: Zwischen Konfrontation, Kooperation und interner Fragmentierung
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der neuen indigenen Bewegungen in Bolivien. Es untersucht die verschiedenen Faktoren, die zu ihrem Auftreten führten, wie z.B. die Entwicklung der Bildung, die Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten und der wachsende Einfluss von Akteuren aus dem Ausland. Außerdem werden die unterschiedlichen Ansätze der indigenen Bevölkerung des Hochlandes und der Amazonasregion miteinander verglichen.
Schlüsselwörter
Indigene Bewegungen, Bolivien, Katarismo, CSUTCB, CONDEPA, Landrechte, Partizipation, Ethnizität, Kultur, Ley de Participación Popular, Cocaleros, Mestizaje, Globalisierung, Konfrontation, Kooperation.
Häufig gestellte Fragen
Was war der "pacto militar-campesino" in Bolivien?
Ein Bündnis zwischen dem Militär und den Bauern, das dazu diente, die indigene Bevölkerung politisch zu kontrollieren und zu assimilieren.
Wer war Victor Hugo Cárdenas?
Er war 1993 der erste Aymara-Indigene, der zum Vizepräsidenten Boliviens ernannt wurde, was einen symbolischen Wandel in der Politik markierte.
Was ist das "Ley de Participación Popular" (LPP)?
Ein Gesetz zur Stärkung lokaler Strukturen, das indigenen Gemeinschaften mehr Mitspracherechte und finanzielle Mittel auf kommunaler Ebene einräumte.
Was forderten die indigenen Bewegungen des Tieflandes?
Sie kämpften vor allem für Landrechte ("Tierra") und Würde ("Dignidad") sowie gegen die Zerstörung ihres Lebensraumes im Amazonasgebiet.
Welche Rolle spielten die Cocaleros?
Die Kokabauern instrumentalisierten ihre kulturelle Identität, um ökonomische Interessen gegen staatliche Regulierungen und die US-Drogenpolitik zu verteidigen.
- Arbeit zitieren
- Georg Ismar (Autor:in), 2003, Die neuen indigenen Bewegungen Ende des 20. Jahrhunderts: Das Beispiel Bolivien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36423