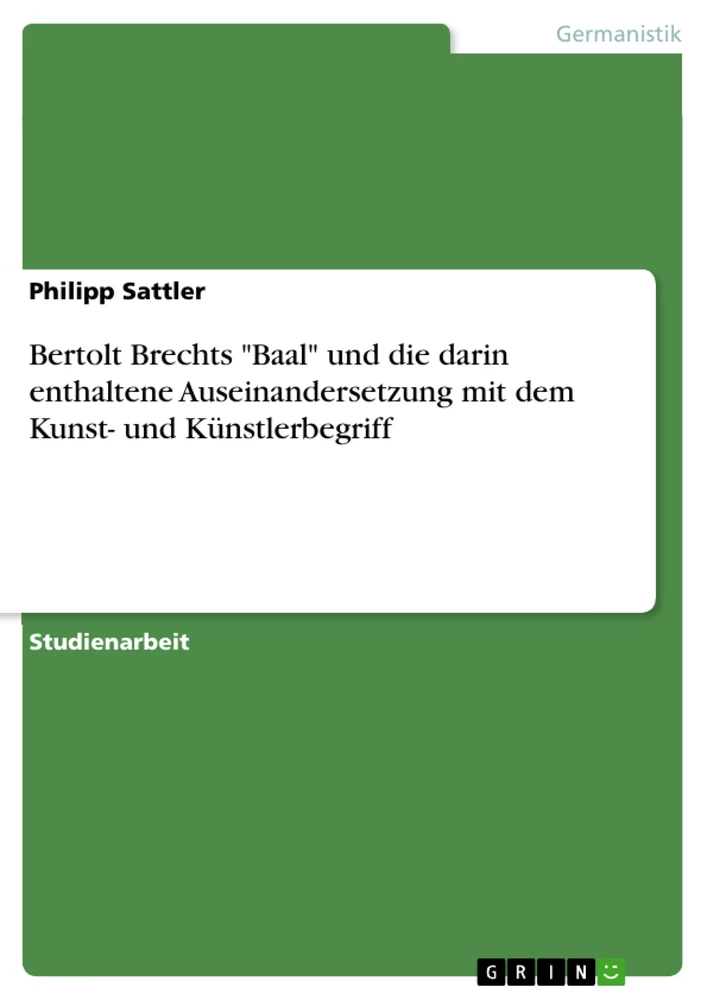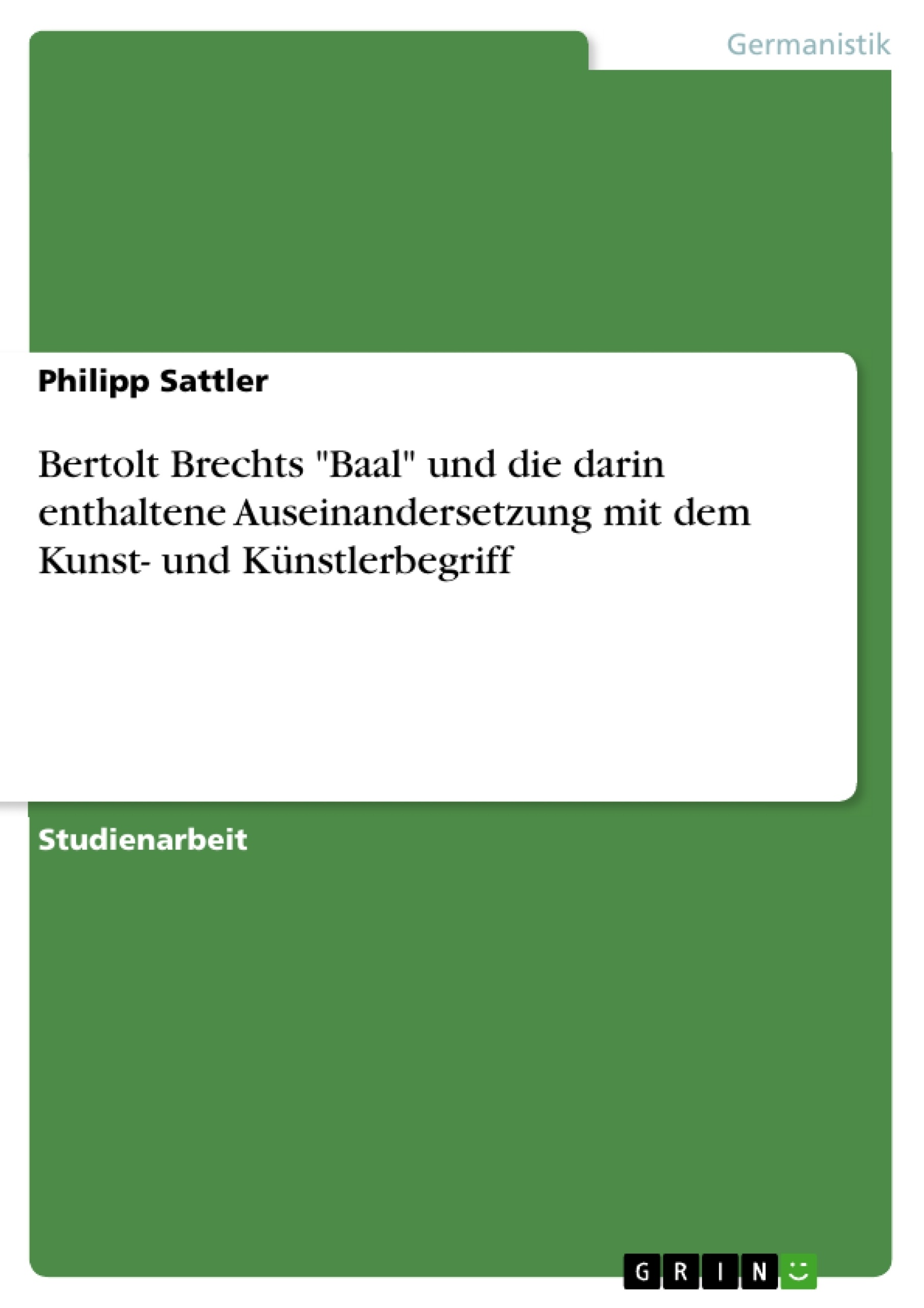In dieser Hausarbeit wird das erste von Brechts Dramen unter die Lupe genommen und auf einen bisher nicht berücksichtigten Kunstbegriff in Brechts Werk untersucht. Anhand von einschlägiger und neuester Forschungsliteratur versucht die Arbeit zu klären, ob und inwiefern die von Erdmut Wizisla festgestellte Nähe Brechts zur Avantgarde in seinem ersten Drama eine Rolle gespielt hat. Hierbei stehen zwei Aspekte im Mittelpunkt. Zum einen die Stellung der Hauptfigur Baal gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft und zum anderen die Kunstvorstellungen Baals und ihre Verbindung zur Kunstvorstellung der Avantgarde. Die Ergebnisse sollen anhand für die Fragestellung ergiebiger Textstellen erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundmotive
- Entgegen der christlich-jüdischen Tradition
- Über das Individuum hinaus
- Baals Naturerleben
- Bruch mit dem Expressionismus
- Nähe zum expressionistischen Drama
- Dichterbild in Baal
- Avantgardistische Elemente in Baal
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Proseminararbeit analysiert Bertolt Brechts „Baal“ und untersucht, inwiefern das Drama eine Auseinandersetzung mit dem Kunst- und Künstlerbegriff, insbesondere im Kontext der Avantgarde, darstellt. Dabei wird die Hauptfigur Baal, seine Beziehung zur bürgerlichen Gesellschaft und seine künstlerischen Ansichten im Hinblick auf die avantgardistischen Strömungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts betrachtet.
- Brechts Auseinandersetzung mit dem Kunst- und Künstlerbegriff in „Baal“
- Die Beziehung zwischen Baals Kunstvorstellungen und den Konzepten der Avantgarde
- Baals Ablehnung der bürgerlichen Gesellschaft und seine Suche nach Freiheit und Anerkennung
- Die Rolle des Expressionismus in Brechts Drama „Baal“
- Baals Individualismus und seine Überwindung des traditionellen Begriffs des Individuums
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den theoretischen Rahmen für die Analyse von Brechts „Baal“ dar. Sie beleuchtet Brechts Verbindung zur Avantgarde und die Bedeutung des Expressionismus im Werk. Kapitel 2 untersucht die Grundmotive des Dramas, insbesondere Baals Ablehnung der christlich-jüdischen Tradition und seine Überwindung des traditionellen Begriffs des Individuums. Kapitel 3 betrachtet den Bruch mit dem Expressionismus und beleuchtet die Nähe Brechts zum expressionistischen Drama sowie die Darstellung des Dichterbildes in „Baal“. Kapitel 4 untersucht die avantgardistischen Elemente im Werk. Der letzte Abschnitt, das Fazit, wird in dieser Zusammenfassung nicht berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen in Brechts „Baal“ sind die Auseinandersetzung mit dem Kunst- und Künstlerbegriff, Avantgarde, Expressionismus, Individualismus, bürgerliche Gesellschaft, christlich-jüdische Tradition, Freiheit, Anerkennung, und das Dichterbild.
- Quote paper
- Philipp Sattler (Author), 2011, Bertolt Brechts "Baal" und die darin enthaltene Auseinandersetzung mit dem Kunst- und Künstlerbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/364462