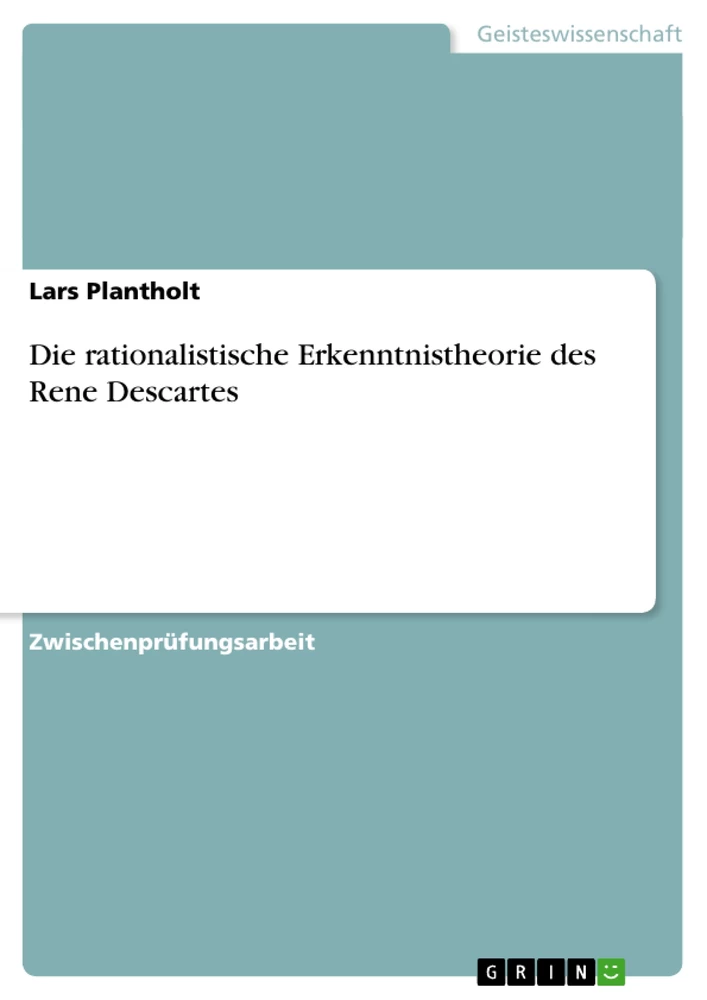Mit Rene Descartes verbindet man nicht nur den Satz cogito, ergo sum und den Beginn der neuzeitlichen Philosophie. Im Besonderen gilt er als der Philosoph, der den Fragestellungen der Erkenntnistheorie auf dem als Rationalismus bezeichneten Wege zu einer universellen Antwort verhelfen wollte. Jene Problematik, die - vereinfacht - die Fragen aufwirft, welches das tatsächliche Verhältnis von Mensch und Welt sei, und welches die Möglichkeiten, Bedingungen und Grenzen der Erkenntnis seien1, waren für Descartes auch von maßgeblich praktischem Interesse. In vielseitigem Sinne Wissenschaftler und der scholastischen Tradition abgeneigt, war es sein Bestreben, allen Wissenschaften eine rational begründete sichere Basis und Methode zur Erkenntnisgewinnung zu verschaffen.
Auf den ersten Blick erscheint ein solches Unterfangen gegenüber empiristischen Theorien weniger nachvollziehbar. Zwar war die skeptische Auffassung, daß allein die sinnliche Wahrnehmung keine Gewißheit über Natur und Verhältnis von erkennendem Subjekt und erkanntem Objekt ermöglicht, schon seit der Antike begründet vertreten worden. Jedoch hat es erkennbar den außergewöhnlicheren Anschein, wenn der Lösungsversuch die Möglichkeit der sicheren Erkenntnis durch Sinneswahrnehmung nachhaltig verneint und vielmehr auf den Gebrauch der Vernunft als probates Mittel gründet. Es wird sichtbar, daß es Ziel dieser Arbeit sein soll, darzulegen, wie dieser besondere Lösungsversuch bei Descartes aussah, und welche Probleme dieser mit sich führt. Dabei wird vorab knapp auf die Frage einzugehen sein, wie seine Zielvorstellung und seine Auffassung von sicherer Erkenntnis sich auf die von ihm entwickelte Methode zur Gewinnung solcher auswirkte. Diese Methode soll anschließend an Hand der hierfür als zentral erachteten Passagen der cartesianischen Argumentation, namentlich dem ‚methodischen Zweifel‘, der ‚Hypothese des malin génie‘, dem ‚ersten Prinzip‘ und der ‚Gottesbeweise‘ des Descartes verfolgt und untersucht werden.
==
1 Vgl. Gabriel, Gottfried: Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Von Descartes zu Wittgenstein, Paderborn u.a. 1993, S. 20ff.; Artikel ‚Erkenntnistheorie‘, in: Metzler
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Descartes' Erkenntnisziel und Methode
- Intuitiv erkannte Axiome
- Der methodische Zweifel
- Die Hypothese des malin génie
- Die Bedeutung des cogito
- Die Gottesbeweise
- Kritik und Kartesischer Zirkel
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der rationalistischen Erkenntnistheorie von René Descartes und analysiert seine Suche nach einer universellen, rational begründeten Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Welt sowie den Möglichkeiten, Bedingungen und Grenzen der Erkenntnis. Descartes strebte nach einer sicheren Basis und Methode zur Erkenntnisgewinnung für alle Wissenschaften, die auf der Vernunft basiert und „unerschütterliche und wahre Urteile“ hervorbringt.
- Descartes' Erkenntnisziel und Methode
- Der methodische Zweifel und die Rolle der Intuition
- Die Hypothese des malin génie und die Bedeutung des cogito
- Die Gottesbeweise und ihre Kritik
- Die Problematik des kartesischen Zirkels
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der rationalistischen Erkenntnistheorie ein und stellt Descartes als den Wegbereiter der neuzeitlichen Philosophie dar. Sie beleuchtet seine Zielsetzung, allen Wissenschaften eine sichere und rational begründeten Basis zu verschaffen. Die skeptische Auffassung, dass die sinnliche Wahrnehmung keine Gewissheit über die Welt und das Verhältnis zwischen erkennendem Subjekt und erkanntem Objekt liefern kann, wird als Ausgangspunkt für Descartes' Überlegungen dargestellt.
- Descartes' Erkenntnisziel und Methode: Dieses Kapitel analysiert Descartes' Anspruch auf eine sichere und objektiv gültige Erkenntnis, die auf der Vernunft basiert. Das Kriterium für wahre Urteile liegt in der Evidenz, der subjektiven Unbezweifelbarkeit und der unmittelbaren Einsicht in den beurteilten Sachverhalt. Descartes verweist dabei auf die Mathematik als Vorbild für eine solche sichere Erkenntnis, da sie auf „reinen und einfachen Objekten“ basiert, die nicht von der unsicheren Erfahrung beeinflusst werden.
- Intuitiv erkannte Axiome: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wie Evidenz erreicht werden kann und auf welche Sachverhalte sie sich bezieht. Descartes betont die Bedeutung der Intuition als Quelle von „mühelosem und deutlich bestimmtem Begreifen“, die zu grundlegenden Einsichten oder Axiomen führt. Diese Einsichten sind voraussetzungslos und bilden die Grundlage für deduktive Folgerungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen der rationalistischen Erkenntnistheorie, wie der Evidenz, der Intuition, dem methodischen Zweifel, dem cogito, den Gottesbeweisen und dem kartesischen Zirkel. Sie analysiert Descartes' Streben nach einer sicheren und rational begründeten Erkenntnis, die auf der Vernunft basiert und die Grenzen der sinnlichen Wahrnehmung überschreitet. Die Arbeit beleuchtet die Problematik der Begründung von Wissen und die Frage, ob eine sichere Erkenntnis überhaupt möglich ist.
- Quote paper
- Lars Plantholt (Author), 2002, Die rationalistische Erkenntnistheorie des Rene Descartes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36485