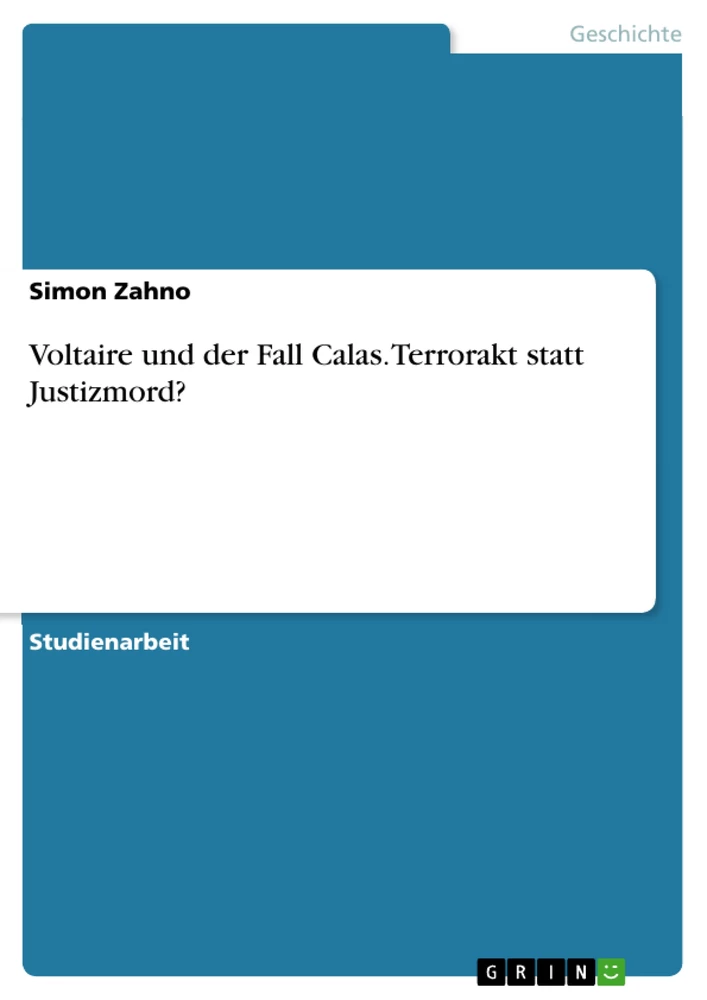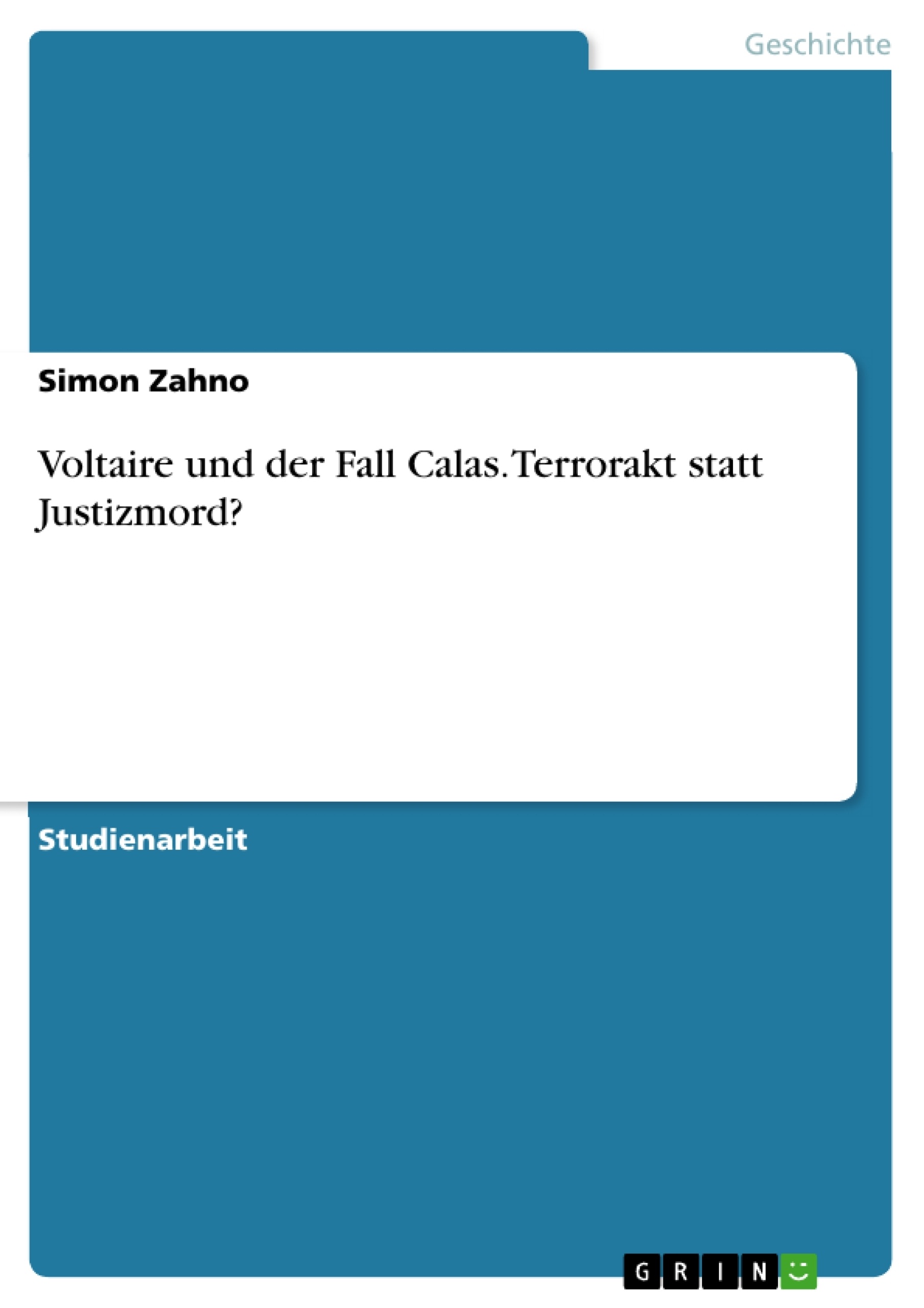Am 10. März 1762 wurde der Tuchhändler Jean Calas in Toulouse gerädert. Diese Hinrichtungsart war besonders brutal, fast unmenschlich brutal. Denn das Ziel dieser Art der Exekution war nicht nur der blosse Tod des Verurteilten. Vor seinem Tod sollte ihm noch so viel Schmerz wie möglich zugefügt werden.
Dieses grausame Schauspiel fand nicht etwa im Hinterhof eines Gefängnisses statt. Die Richter wählten dafür einen öffentlichen Platz in Toulouse. Der Grund dafür war einfach. An Jean Calas sollte ein Exempel statuiert werden. Jeder Bürger der Stadt sollte das Schrecken der Hinrichtung sehen, damit im Volk eine Furcht oder sogar Angst entsteht. Eine Angst davor, auf die gleiche Weise zu enden wie Calas. Natürlich waren nicht alle Bürger bedroht. Nur diejenigen die ein gewisses Verbrechen begingen, mussten den Tod durch das Rädern fürchten. Aber welches Vergehen wurde dem Familienvater überhaupt zur Last gelegt? Nun offiziell war es der angebliche Mord an seinem Sohn. Inoffiziell war er ein Protestant in einem durch und durch katholischen Königreich.
Eine solche Diskriminierung von Andersgläubigen war für einen Mann in Frankreich nicht mit seiner Philosophie zu vereinbaren. Voltaire setzte sich mit seinen aufgeklärten Schriften für mehr Toleranz ein und kritisierte öffentlich die Kirche als Institution in Frankreich. Als er vom Fall in Toulouse hörte, setzte er sich mit der Publikation von Briefen und Traktaten für die Rehabilitierung des Hingerichteten und seiner Familie ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Fragestellung und Thesen
- Aufbau und Methodik der Arbeit
- Historischer Kontext
- Das Leben Voltaires
- Der Fall Calas
- Die Hugenotten in Frankreich
- Der Fall Calas als Akt des staatlichen Terrors
- Definition von Terror
- Anwendung der Terrordefinition auf den Fall Calas
- Quellenkritik
- Quellenanalyse
- Ein öffentliches Anliegen
- Die Rückständigkeit Frankreichs
- Den König und die Richter zum Handeln zwingen
- Den Verstand gebrauchen
- Ergebnisse
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Fall Calas aus der Perspektive des staatlichen Terrors. Sie beleuchtet Voltaires Rolle in diesem Kommunikationsprozess und analysiert, wie er die kommunikative Dimension eines Terroraktes für seine Ziele nutzte. Die Arbeit zielt darauf ab, zu verstehen, wie Voltaire die französische Krone zur Rehabilitierung Calas zwang und wie er die kommunikative Komponente des Terroraktes zur Deeskalation der Gewalt einsetzte.
- Der Fall Calas als Akt des staatlichen Terrors
- Die Rolle Voltaires in der Kommunikation um den Fall Calas
- Voltaires Strategie zur Deeskalation der Gewalt im Fall Calas
- Die kommunikative Dimension des Terroraktes
- Die Rehabilitierung Jean Calas
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Fragestellung und die Thesen. Sie stellt die Hauptakteure, Voltaire und den Fall Calas, sowie den historischen Kontext vor, um den Leser mit den wichtigsten Informationen vertraut zu machen. Anschließend wird der Fall Calas als möglicher Terrorakt definiert, indem verschiedene Definitionen von Terror herangezogen werden. Darauf folgt die Analyse ausgewählter Briefe von Voltaire, die er im Zuge der Wiederherstellung der Ehre der Familie Calas schrieb. Diese Analyse konzentriert sich auf vier Punkte, mit denen es Voltaire gelungen ist, seine Forderungen durchzubringen. Zum Schluss wird die Fragestellung beantwortet und ein Fazit gezogen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen staatlicher Terror, Kommunikation, Rehabilitierung, Toleranz, Philosophie, Hugenotten, Französische Revolution, Voltaire, Calas, Briefe, Quellenanalyse.
- Arbeit zitieren
- Simon Zahno (Autor:in), 2017, Voltaire und der Fall Calas. Terrorakt statt Justizmord?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365246