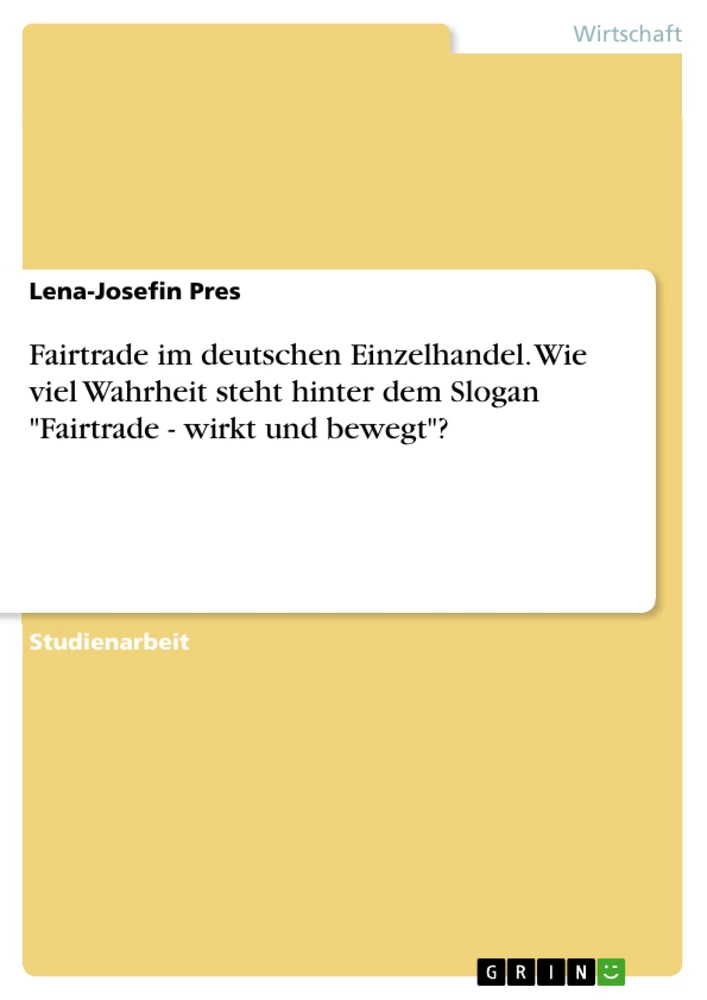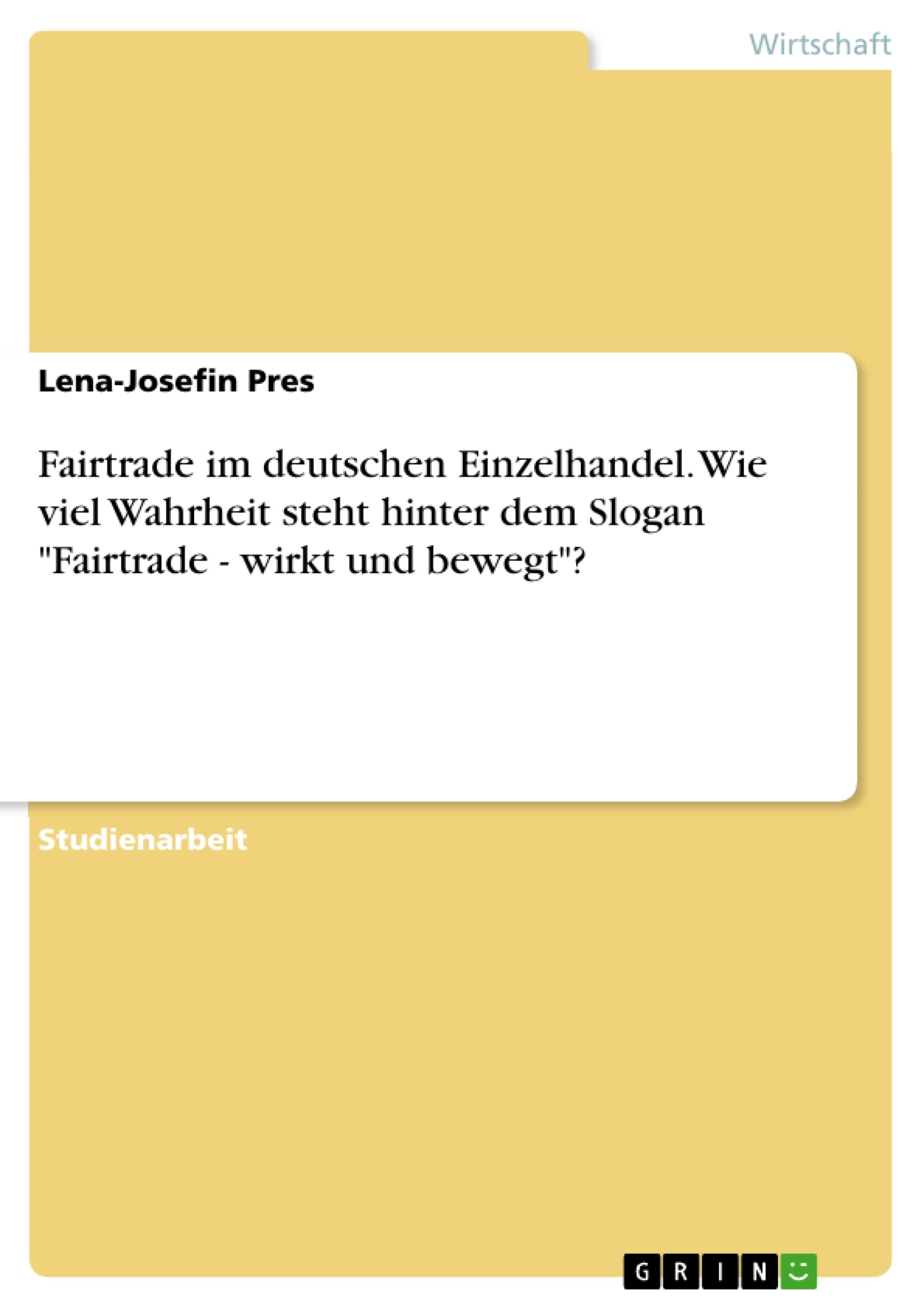Globaler Handel ist sowohl in der deutschen als auch der europäischen Welt bereits Standard. Ein Standard, der günstige Preise und unbegrenzte Möglichkeiten für Konsumenten mit sich bringt. Wir sind es gewöhnt, Obst und Gemüse jederzeit, auch außerhalb der Saison, erwerben zu können. Diese Entwicklung des Global Sourcings resultiert aus dem stetig wachsenden Preiskampf, in welchem Unternehmen sich ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern wollen.
Das Prinzip ist simpel: Die Produktion von Gütern und Dienstleistungen wird dorthin verlegt, wo die Arbeits- und Unterhaltskosten gering sind. „Im Alltag benutzen wir für diese uneingeschränkte Öffnung des Marktes über alle Kontinente und Ländergrenzen hinweg das Wort ‚Globalisierung‘.“ Die südlichen Länder sind in der Primärproduktion und dem Rohstoffverkauf tätig, wohingegen die nördlichen Länder den Schwerpunkt auf Dienstleistungen setzen. Diese Arbeitsteilung findet heute im internationalen Rahmen und in verstärkter Ausprägung statt.
In diesem Zuge wurden die Missstände der Arbeitsbedingungen für Plantagen- und Fabrikarbeiter bekannt: unzureichende Löhne, Kinderarbeit und Diskriminierung. Unter dem Begriff „Fairtrade“ haben es sich nationale und internationale Organisationen auf die Agenda geschrieben, Konsumenten auf die Folgen der Globalisierung aufmerksam zu machen sowie entsprechende Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Maßnahmen, um das Ungleichgewicht zwischen den entwickelten und den weniger entwickelten Länder auszugleichen und um den globalen Handel in einen fairen Handel zu wandeln. Doch was ist fairer Handel?
Inhaltsverzeichnis
- Fairtrade wirkt und bewegt?
- Marktentwicklung in Deutschland
- Das Fairtrade-System
- Praxisbeispiel: Lidl
- Kritik
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Fairtrade im deutschen Einzelhandel. Sie untersucht die Entwicklung des Fairtrade-Systems, seine Funktionsweise und seine Relevanz für den Konsumenten. Außerdem wird das Praxisbeispiel Lidl beleuchtet und die Kritik am Fairtrade-System analysiert.
- Entwicklung des Fairtrade-Systems
- Funktionsweise des Fairtrade-Systems
- Relevanz von Fairtrade für den Konsumenten
- Praxisbeispiel Lidl
- Kritik am Fairtrade-System
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 beleuchtet die Bedeutung von Fairtrade im Kontext der Globalisierung und des Preiskampfes im Einzelhandel. Es stellt die Notwendigkeit von fairen Handelsbedingungen und die Bedeutung von Gütesiegeln für den Konsumenten in den Vordergrund.
- Kapitel 2 analysiert die Entwicklung des deutschen Einzelhandels und zeigt die wachsende Bedeutung von Global Sourcing und den Einfluss des Preiskampfes auf die Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern.
- Kapitel 3 erläutert das Fairtrade-System im Detail und stellt die zentralen Prinzipien und Standards vor.
- Kapitel 4 analysiert das Praxisbeispiel Lidl und zeigt, wie der Discounter das Fairtrade-System implementiert und welche Herausforderungen dabei entstehen.
Schlüsselwörter
Fairtrade, Globalisierung, Einzelhandel, Preiskampf, Gütesiegel, CSR, Lidl, Kritik, Nachhaltigkeit, Konsumentenverhalten.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Global Sourcing“ im Einzelhandel?
Global Sourcing bezeichnet den weltweiten Einkauf von Rohstoffen und Produkten dort, wo sie am günstigsten produziert werden können. Dies führt oft zu niedrigen Preisen für Konsumenten, aber auch zu problematischen Arbeitsbedingungen in südlichen Ländern.
Was ist das Ziel des Fairtrade-Systems?
Fairtrade zielt darauf ab, das Ungleichgewicht im Welthandel auszugleichen. Durch garantierte Mindestpreise und Prämien sollen die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Plantagen- und Fabrikarbeitern nachhaltig verbessert werden.
Wie setzt Lidl Fairtrade in der Praxis um?
Lidl integriert Fairtrade-Produkte in sein Sortiment, um soziale Verantwortung (CSR) zu zeigen. Die Arbeit analysiert, wie ein Discounter diese Standards implementiert und welche Herausforderungen dabei im Preiskampf entstehen.
Welche Kritik gibt es am Fairtrade-System?
Kritiker hinterfragen oft, wie viel des Aufpreises tatsächlich bei den Produzenten ankommt und ob die Zertifizierungen ausreichen, um strukturelle Probleme wie Kinderarbeit oder Diskriminierung vollständig zu lösen.
Warum sind Gütesiegel für Konsumenten wichtig?
Gütesiegel bieten Orientierung in einem unübersichtlichen globalen Markt. Sie signalisieren dem Käufer, dass bestimmte soziale und ökologische Standards bei der Herstellung des Produkts eingehalten wurden.
- Citation du texte
- Lena-Josefin Pres (Auteur), 2016, Fairtrade im deutschen Einzelhandel. Wie viel Wahrheit steht hinter dem Slogan "Fairtrade - wirkt und bewegt"?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365272