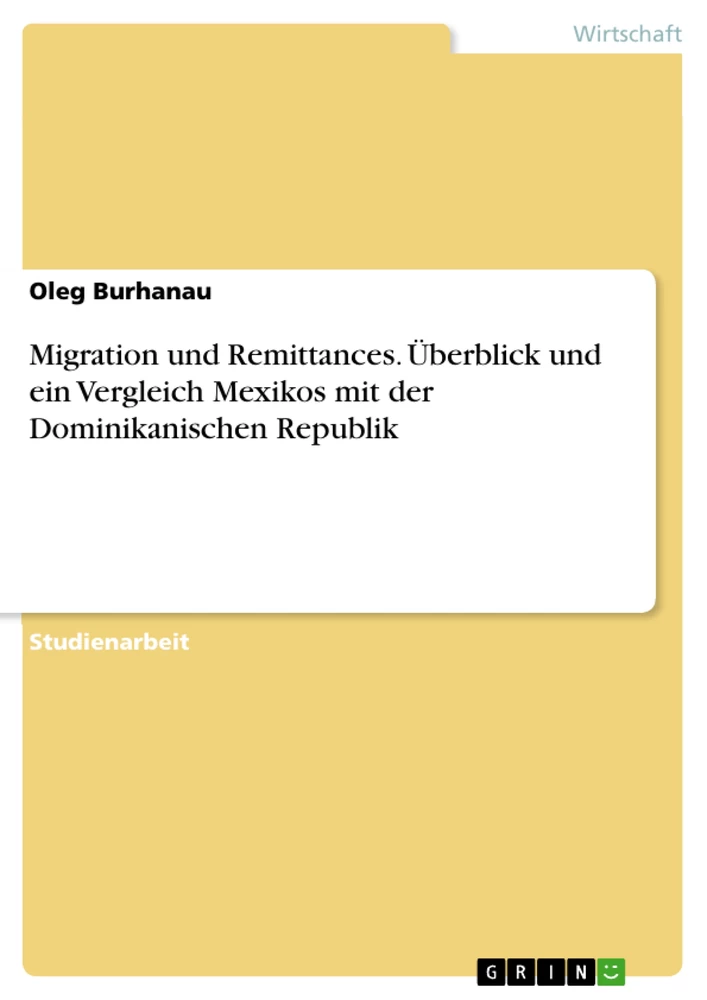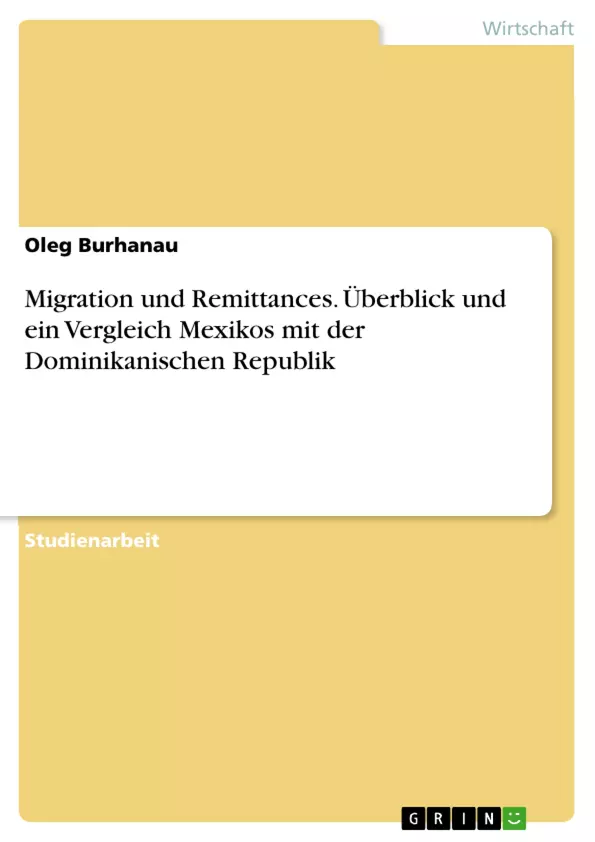Die Überweisungen im Ausland lebender Bürger (remittences, weiterführend: Remittances) in Entwicklungsländer erreichten 2012 nach Angaben der Weltbank eine riesige Summe von 401 Milliarden US-Dollar (USD). Die Tendenz zeigt weiter nach oben. Remittances sind heute höher als die gesamten öffentlichen Entwicklungshilfen, nur der Betrag der ausländischen Direktinvestitionen ist höher. Während die absolute Zahl in Indien 2015 die 70 Mrd. USD überschreitet, machen die Überweisungen in kleineren Ländern einen wesentlichen Teil des Bruttoinlandsproduktes (BIP) (z.B. 47% in Tadschikistan) aus.
Lange Zeit wurde die Migration und ihre Auswirkungen auf die Zielländer untersucht. In jüngster Vergangenheit, vor allem im Hinblick der jährlich steigenden Remittances, stehen die Herkunftsländer, insbesondere Entwicklungsländer, im Blickpunkt des Interesses. Es ist wenig verwunderlich, dass sich viele Wissenschaftler mit der Thematik der Remittances und deren Einfluss auf die Entwicklung beschäftigen. Auf politischer Ebene werden Remittances als eine neue Entwicklungsressource einkommensschwacher Haushalte betrachtet, während globalisierungskritische Sozialwissenschaftler den Anstieg der Remittances als Resultat fehlgeleiteter neo-liberaler Politiken sehen. Im Verlaufe dieser Ausarbeitung soll ein Blick auf die beiden Standpunkte geworfen werden und neuere, pluralistische Herangehensweisen vorgestellt werden. Am Beispiel Lateinamerikas und der Karibik (fortan: Lateinamerika) soll gezeigt werden, wieso gerade dieser Region eine besondere Rolle zukommt und welches Potential den Remittances bei der Entwicklung zugesprochen wird. Obwohl der potentielle positive Einfluss der Remittances auf die Entwicklung kaum noch bestritten werden kann, gibt es immer noch große regionale und grenzüberschreitende Unterschiede. In einem letzten Teil soll ein Blick auf eines der größten Empfängerländer (Mexiko) der Remittances geworfen und mit einem kleinen, benachbarten Staat verglichen werden (Dominikanische Republik). Dabei gilt es zu zeigen, dass die Heterogenität der Länder eine wichtige Rolle bei der Bewertung des Einflusses der Remittances spielen sollte. Da Migration logischerweise eine Voraussetzung für Remittances bildet, wird auch auf diese im Verlauf dieser Ausarbeitung detaillierter eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Migration und Remittances
- Entwicklung der Migration
- Migration am Beispiel Lateinamerika
- Remittances
- Remittances am Beispiel Lateinamerika
- Migration und Remittances in Mexiko
- Migration und Remittances in der Dominikanischen Republik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung untersucht das Phänomen der Remittances, insbesondere im Kontext von Entwicklungsländern. Sie beleuchtet die historischen Entwicklungen und die aktuelle Bedeutung von Remittances als neue Entwicklungsressource, wobei sowohl positive als auch kritische Perspektiven aufgezeigt werden. Dabei wird die besondere Rolle Lateinamerikas als Auswanderungsregion hervorgehoben und der potenzielle Einfluss von Remittances auf die Entwicklung dieser Region betrachtet.
- Entwicklung der Migration und deren Einfluss auf Herkunftsländer
- Bedeutung von Remittances als Entwicklungsressource
- Positive und kritische Perspektiven auf Remittances
- Lateinamerika als Auswanderungsregion und die Rolle von Remittances
- Vergleich von Mexiko und der Dominikanischen Republik als Empfängerländer
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Bedeutung von Remittances für Entwicklungsländer dar und zeigt die aktuelle Debatte über deren Einfluss auf die Entwicklung. Es wird auf die steigenden Überweisungen im Ausland lebender Bürger und deren Bedeutung im Vergleich zu anderen Finanzierungsformen hingewiesen.
Migration und Remittances
Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Migration und die Rolle von Remittances in diesem Zusammenhang. Es werden verschiedene Theorien und Perspektiven auf die Migration und ihre Auswirkungen auf Herkunftsländer diskutiert, wobei sowohl optimistische als auch pessimistische Ansätze betrachtet werden.
Migration am Beispiel Lateinamerika
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Migrationsbewegung in Lateinamerika und die Rolle von Remittances für diese Region. Es wird auf die Ursachen der Migration, die Bedeutung der Remittances für die Wirtschaft und die Herausforderungen für die Entwicklung eingegangen.
Remittances
Dieses Kapitel definiert Remittances und beleuchtet deren Bedeutung als Finanzierungsquelle für Entwicklungsländer. Es werden die verschiedenen Formen von Remittances und deren Einfluss auf die Empfängerländer vorgestellt.
Remittances am Beispiel Lateinamerika
Dieses Kapitel analysiert die Rolle von Remittances in Lateinamerika und deren Einfluss auf die Entwicklung der Region. Es werden verschiedene Studien und Statistiken herangezogen, um die Auswirkungen von Remittances auf die Wirtschaft, die Armut und die soziale Entwicklung zu beleuchten.
Migration und Remittances in Mexiko
Dieses Kapitel beleuchtet die Migrationsbewegung und die Remittances in Mexiko, einem der größten Empfängerländer von Überweisungen. Es werden die wichtigsten Migrationsrouten und die Rolle von Remittances für die mexikanische Wirtschaft betrachtet.
Migration und Remittances in der Dominikanischen Republik
Dieses Kapitel untersucht die Migrationsbewegung und die Remittances in der Dominikanischen Republik, einem kleinen, benachbarten Staat Mexikos. Es wird ein Vergleich zwischen den beiden Ländern gezogen, um die Heterogenität der Länder und deren Einfluss auf die Auswirkungen von Remittances zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Ausarbeitung sind Migration, Remittances, Entwicklungsländer, Lateinamerika, Mexiko, Dominikanische Republik, Armut, Entwicklung, Wirtschaft, soziale Entwicklung, Push-Faktoren, Pull-Faktoren, Brain-Drain, Entwicklungshilfe, Globalisierung, Neoliberalismus.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Remittances?
Remittances sind Geldüberweisungen von Migranten, die im Ausland leben und arbeiten, an ihre Familien oder Gemeinschaften in ihren Herkunftsländern.
Wie hoch ist das globale Volumen der Remittances?
Laut Weltbank erreichten die Überweisungen in Entwicklungsländer bereits im Jahr 2012 eine Summe von 401 Milliarden US-Dollar, wobei die Tendenz weiter steigend ist.
Welche Rolle spielen Remittances für das BIP kleinerer Länder?
In einigen Ländern machen Remittances einen wesentlichen Teil des Bruttoinlandsproduktes aus, wie zum Beispiel in Tadschikistan, wo sie bis zu 47 % des BIP erreichen können.
Was sind die Unterschiede zwischen Mexiko und der Dominikanischen Republik bei Remittances?
Mexiko ist eines der weltweit größten Empfängerländer. Der Vergleich mit der Dominikanischen Republik zeigt jedoch, dass die Heterogenität der Länder eine wichtige Rolle bei der Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen spielt.
Wie werden Remittances politisch bewertet?
Politisch werden sie oft als neue Entwicklungsressource für arme Haushalte gesehen. Kritiker hingegen betrachten den Anstieg als Resultat fehlgeleiteter neoliberaler Politiken.
- Quote paper
- Oleg Burhanau (Author), 2016, Migration und Remittances. Überblick und ein Vergleich Mexikos mit der Dominikanischen Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365336