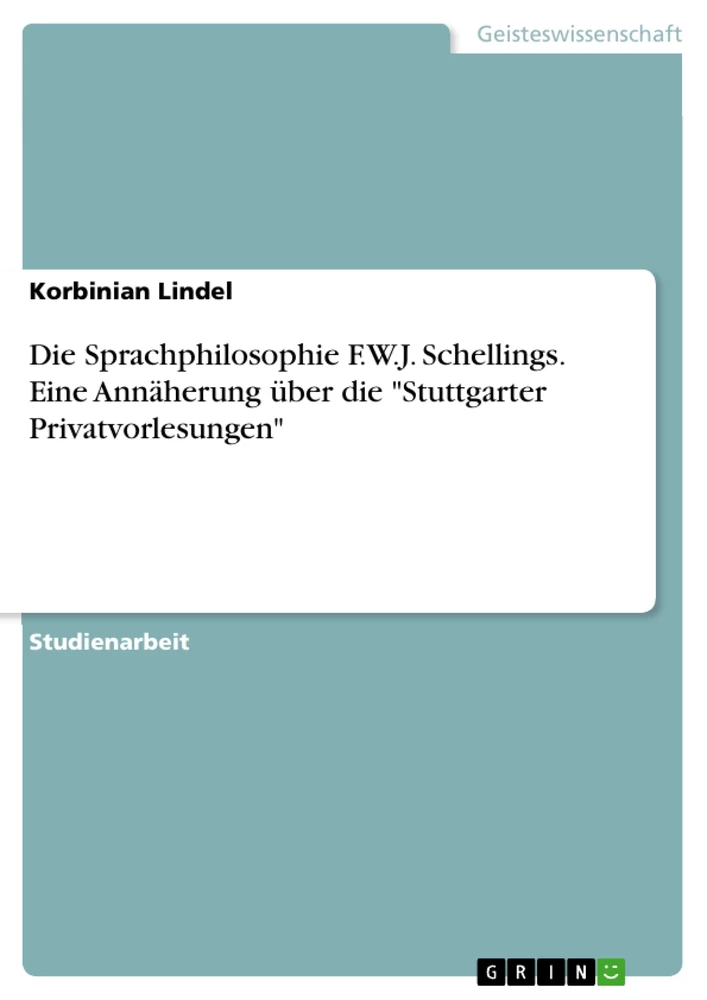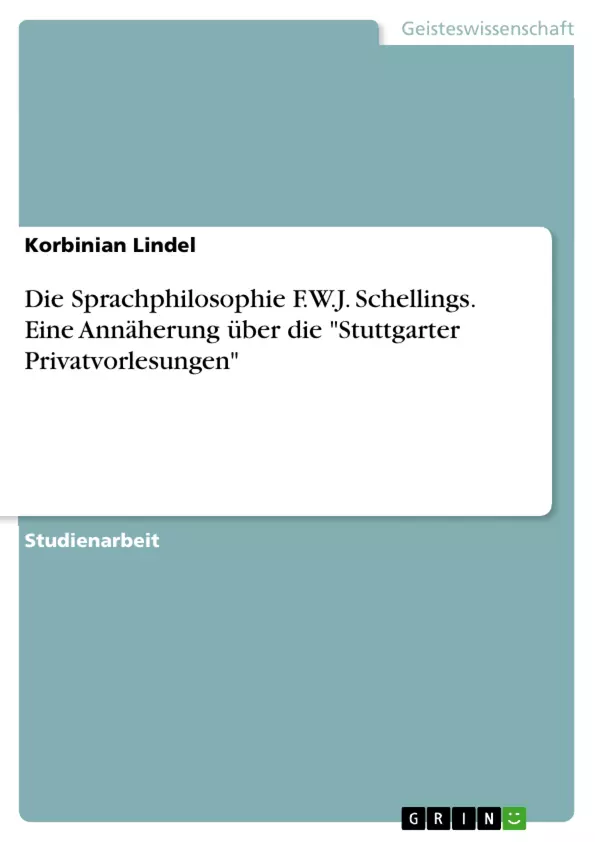Eine wesentliche Innovation des Deutschen Idealismus liegt in der Entwicklung einer neuartigen philosophischen Ausdrucksweise. In ihrer Sprachverwendung verdankt die idealistische Philosophie den Autoren der Jenaer Frühromantik und deren Gedankengut prägende Anregungen. Aus diesem ersten Romantikerkreis auf deutschem Boden erwächst ein poetologisches Schrifttum, in dem das Ideal eines metaphorisch-etymologisierenden, bis zur Hermetik neigenden Sprechens hochgehalten und eine regelrechte Poetik der Unverständlichkeit entworfen wird.
In seinem Aufsatz "Über die Unverständlichkeit" (1800) will Friedrich Schlegel den Verstehensakt als einen prinzipiell unabschließbaren Prozess begriffen wissen und richtet an Schriftsteller wie Leser normativ die Forderung: „Eine klassische Schrift muß nie ganz verstanden werden können. Aber die welche gebildet sind und sich bilden, müssen immer mehr draus lernen wollen.“
Nachhaltig von der romantischen Denkungsart beeinflusst, bedienen sich die Idealisten einer Sprache, die Mehrdeutigkeiten nicht meidet, sondern vielmehr gezielt mit Begriffen arbeitet, die einen universalen Deutungsanspruch auf so disparate Teilbereiche der menschlichen Kultur und Erfahrungswelt wie Geschichte, Natur, Religion, auf die Ontogenese eines Individuums oder die Phylogenese der gesamten Menschheit erheben. Einen dieser philosophischen Kernbegriffe auf eine einzige dieser Sinndimensionen festzuschreiben, ihn ausschließlich einem bestimmten Gegenstand oder Gegenstandsbereich zuzuordnen, würde sein signifikatives Potential bei weitem nicht ausschöpfen.
So sieht sich die vorliegende Arbeit vor das Problem gestellt, eine Interpretation des Schellingschen Wort-Konzepts, über das Schelling in den Stuttgarter Privatvorlesungen reales und ideales Prinzip miteinander verbindet, liefern zu wollen und sich doch dabei bewusst ist, dass nur mögliche Lesarten plausibilisiert, aber keine finale Deutung in Aussicht gestellt werden kann. Im Rahmen dieser Möglichkeiten sollen zwei Interpretationsvorschläge eingebracht werden, die eine metaphysisch-epistemologische beziehungsweise eine linguistische Herangehensweise an das Phänomen der Sprache, wie es sich in der Philosophie Schellings präsentiert, durchspielen.
Inhaltsverzeichnis
- Sprachdenken und ästhetische Theorie um 1800
- Zur Poetik der Polysemie im Deutschen Idealismus
- Schellings 'Sprachphilosophie' im Spiegel der Forschung
- Sprache als Handlungsakt in Schellings Kunstphilosophie
- Das Wort als metaphysisches Konzept in den Stuttgarter Privatvorlesungen
- Die Analogie von Sprache und Identitätsphilosophie
- Die Selbstentäußerung Gottes durch das gesprochene Wort
- Soteriologie des Wortes
- Das Wort als heuristisches Instrument einer empirischen Linguistik
- Spracharbeit und Sprachbewusstsein der Romantiker
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Sprachphilosophie F.W.J. Schellings und analysiert diese anhand seiner „Stuttgarter Privatvorlesungen“. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie Schelling das Verhältnis von Sprache und Realität in seinen philosophischen Überlegungen verortet.
- Die Rolle der Sprache in der ästhetischen Theorie des Deutschen Idealismus
- Die Bedeutung des Wortes als metaphysisches Konzept in Schellings Philosophie
- Das Verhältnis von Sprache und Kunst in Schellings Werk
- Die sprachphilosophischen Aspekte in Schellings Kunstphilosophie
- Der Einfluss der Romantik auf Schellings Sprachphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Sprachdenken und ästhetische Theorie um 1800 - Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung einer neuartigen philosophischen Ausdrucksweise im Deutschen Idealismus, die durch die Jenaer Frühromantik geprägt wurde. Es wird auf die Bedeutung von metaphorischem Sprachgebrauch und die Poetik der Unverständlichkeit bei Friedrich Schlegel eingegangen. Außerdem wird gezeigt, wie Schelling in seinen Schriften Mehrdeutigkeiten gezielt einsetzt und seinen philosophischen Kernbegriffen eine universelle Deutungsfähigkeit verleiht.
- Kapitel 2: Das Wort als metaphysisches Konzept in den Stuttgarter Privatvorlesungen - Dieses Kapitel analysiert die zentrale Rolle des Wortes in Schellings Philosophie, insbesondere in den „Stuttgarter Privatvorlesungen“. Es werden die Analogien zwischen Sprache und Identitätsphilosophie sowie die Selbstentäußerung Gottes durch das gesprochene Wort untersucht. Die Soteriologie des Wortes wird als eine weitere Facette der sprachphilosophischen Argumentation Schellings betrachtet.
- Kapitel 3: Das Wort als heuristisches Instrument einer empirischen Linguistik - Dieses Kapitel betrachtet die Sprachphilosophie Schellings aus einer linguistischen Perspektive und analysiert, wie das Wort als heuristisches Werkzeug für die empirische Sprachwissenschaft eingesetzt werden kann.
- Kapitel 4: Spracharbeit und Sprachbewusstsein der Romantiker - Dieses Kapitel untersucht den Einfluss der Romantik auf Schellings Sprachphilosophie und befasst sich mit dem Sprachbewusstsein der Romantiker, das von einem besonderen Fokus auf die Sprache und ihre Bedeutung geprägt war.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Sprachphilosophie, F.W.J. Schelling, Stuttgarter Privatvorlesungen, Deutscher Idealismus, Frühromantik, Poetik der Polysemie, Metapher, Metonymie, Kunstphilosophie, Mythos, Logosmystik, Sprache als Handlungsakt, spracharbeit, Sprachbewusstsein, Romantik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Schellings Sprachphilosophie?
Schelling betrachtet Sprache nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern als metaphysisches Konzept, das reales und ideales Prinzip verbindet. Seine Sprache ist oft metaphorisch und polysem (mehrdeutig).
Was sind die „Stuttgarter Privatvorlesungen“?
In diesen Vorlesungen (1810) entwickelte Schelling wichtige Aspekte seiner Identitätsphilosophie und erläuterte die Rolle des Wortes als Akt der Selbstentäußerung Gottes.
Wie beeinflusste die Romantik Schellings Denken?
Schelling war eng mit dem Jenaer Romantikerkreis verbunden. Von ihnen übernahm er die Vorliebe für metaphorisches Sprechen und die Idee, dass eine klassische Schrift nie ganz verstanden werden kann.
Was bedeutet „Soteriologie des Wortes“ bei Schelling?
Es beschreibt die erlösende Funktion der Sprache, in der das Göttliche durch das Wort in die Welt tritt und so die Trennung zwischen Geist und Natur überbrückt wird.
Welche Rolle spielt die Kunst in Schellings Sprachdenken?
Für Schelling ist Kunst die höchste Form der Sprache. In der Kunstphilosophie wird das Wort zum Handlungsakt, der das Unendliche im Endlichen darstellt.
- Quote paper
- Korbinian Lindel (Author), 2017, Die Sprachphilosophie F.W.J. Schellings. Eine Annäherung über die "Stuttgarter Privatvorlesungen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365356