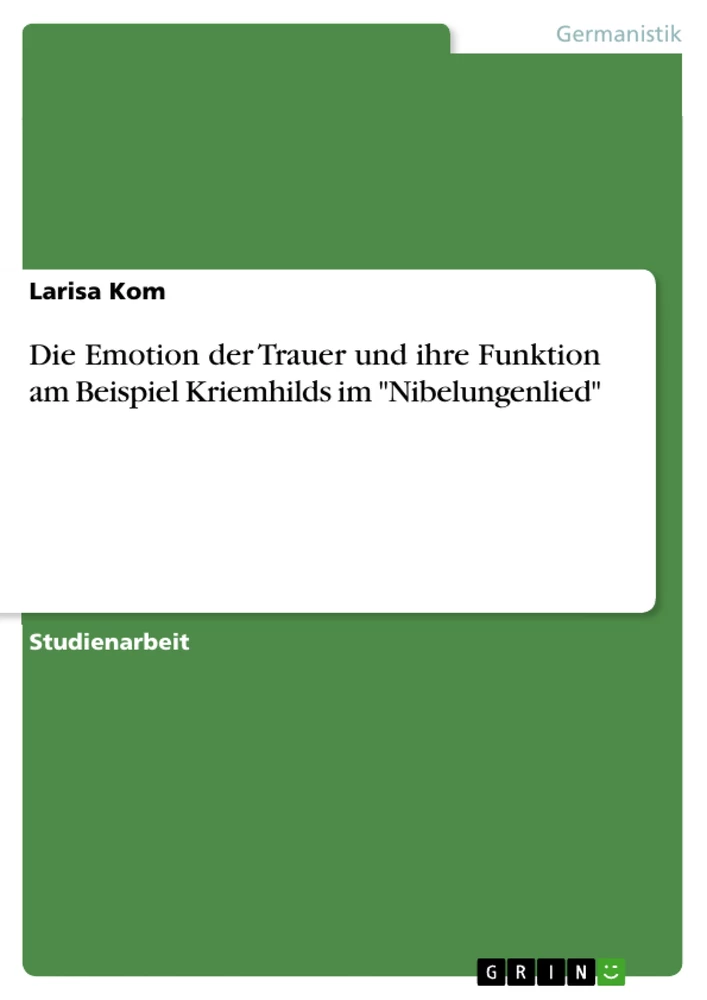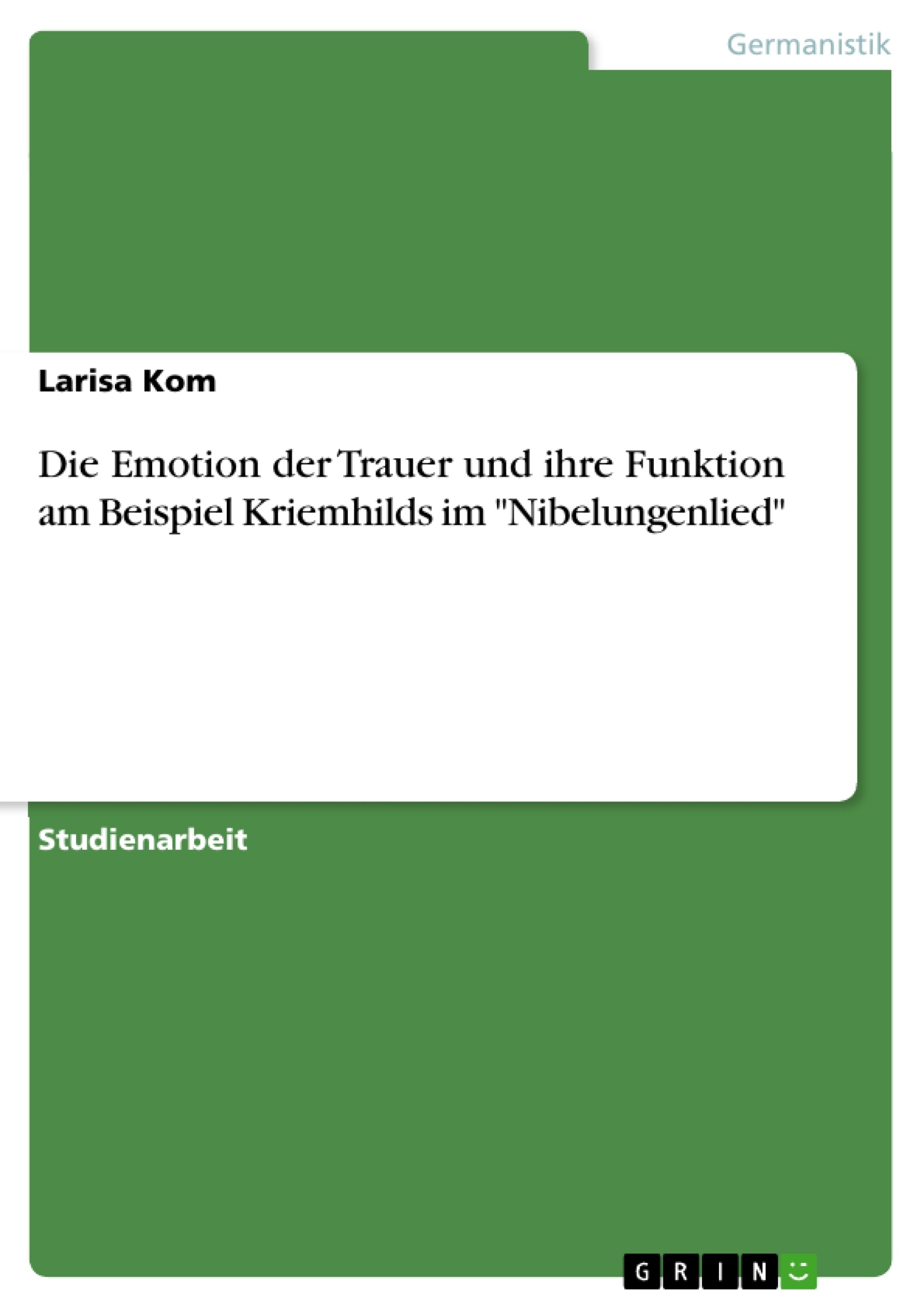Die Arbeit behandelt das Thema der Funktion von Emotionalität im Mittelalter. Dabei bezieht sich die Arbeit speziell auf die Trauer, da diese Art der Emotion im "Nibelungenlied" eindrucksvoll dargestellt wird. Im Heldenepos "Nibelungenlied" nimmt Kriemhild eine zentrale Position ein. Nachdem Siegfried im Wald ermordet wird und von den Mördern vor die Kemenate der Königin Kriemhild gelegt wird, beginnt die Trauer Kriemhilds. Diese Trauer und das Klagen um den ermordeten Siegfried sind von eindrücklicher Gestalt.
Die Arbeit wird zunächst geleitet von der Frage, ob die Trauer Kriemhilds von unkontrollierter Emotionalität oder doch von Affektkontrolle geprägt ist. Die Texte "Empörung, Tränen, Zerknirschung" von Gerd Althoff und "Das Nibelungenlied. Widersprüche höfischer Gewaltreglementierung" von Peter Czerwinski sollen zu einer Klärung der Fragestellung beitragen. Wenn tatsächlich festgestellt werden sollte, dass die Trauer Kriemhilds nicht einem bloßen Gefühlsausbruch gleichzusetzen ist, könnte ihrer Trauer eine Funktion zu Grunde liegen. Daher wird schließlich auf die Fragestellung eingegangen, welche Funktion die Trauer Kriemhilds aufweist. In einem anschließenden Fazit soll über die wichtigsten Ergebnisse ein knapper Überblick gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Trauer Kriemhilds - unkontrollierte Emotionalität?
- 3. Die Funktion der Trauer Kriemhilds
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion von Emotionalität, speziell Trauer, im mittelalterlichen Kontext anhand der Darstellung Kriemhilds im Nibelungenlied. Sie hinterfragt, ob Kriemhilds Trauer als unkontrollierter Gefühlsausbruch oder als kontrollierte Handlung zu verstehen ist und beleuchtet die soziale Funktion dieser Emotion im mittelalterlichen Gesellschaftssystem.
- Die Darstellung von Trauer im mittelalterlichen Heldenepos
- Untersuchung der kontrollierten vs. unkontrollierten Emotionalität im Mittelalter
- Die soziale Funktion von ritualisierten Emotionen
- Der Einfluss von Performanz und Akustik auf die Kommunikation im Mittelalter
- Die Bedeutung von Vertrauen und Verbindlichkeit in der mittelalterlichen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Forschungsfrage nach der Funktion von Trauer im Nibelungenlied, speziell am Beispiel Kriemhilds. Sie benennt die zentralen Forschungsquellen und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf Aventiure 17, in der Siegfrieds Tod und Kriemhilds Trauer eindrucksvoll dargestellt werden. Die Arbeit untersucht, ob Kriemhilds Trauer als unkontrollierte Emotionalität oder als kontrollierte Handlung zu interpretieren ist und welche soziale Funktion diese Trauer im mittelalterlichen Kontext hat.
2. Die Trauer Kriemhilds - unkontrollierte Emotionalität?: Dieses Kapitel analysiert Kriemhilds Trauerreaktion auf den Tod Siegfrieds in Aventiure 17 des Nibelungenlieds. Es hinterfragt, ob die dargestellte Emotionalität als unkontrollierter Gefühlsausbruch oder als gezielte Emotionskontrolle zu interpretieren ist. Die Arbeit berücksichtigt den Kontext des mittelalterlichen Lebens, in dem mündliche Kommunikation und Performanz eine zentrale Rolle spielten, im Gegensatz zur heutigen schriftlichen Fixierung. Es wird diskutiert, wie die fehlende Institutionalisierung des Rechts und das daraus resultierende Vertrauen als Basis der Gesellschaft die Interpretation von Emotionen beeinflussen. Die Kapitel bezieht sich auf die Werke von Althoff und Czerwinski, um die Bedeutung von ritualisiertem Verhalten und symbolischer Kommunikation im Mittelalter zu beleuchten.
3. Die Funktion der Trauer Kriemhilds: Dieses Kapitel befasst sich mit der Funktion von Kriemhilds Trauer. Aufbauend auf der Analyse der vorhergehenden Kapitel wird argumentiert, dass die Trauer nicht als bloßer Gefühlsausbruch, sondern als ritualisierte Verhaltensweise mit einer sozialen Funktion zu verstehen ist. Die rituelle Darstellung von Trauer diente der Herstellung von Sicherheit und Ordnung in einer Gesellschaft, die stark auf Vertrauen und mündliche Absprachen angewiesen war. Emotionen wie Tränen wurden als symbolische Mittel eingesetzt, um den Ernst und die Dringlichkeit einer Bitte zu betonen. Das Kapitel zeigt, wie die kontrollierte Darstellung von Emotionen zur Stabilität und zum sozialen Zusammenhalt beitrug.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Kriemhild, Trauer, Emotion, Mittelalter, Emotionalitätskontrolle, Performanz, Akustik, soziale Funktion, Ritual, Vertrauen, höfische Gesellschaft, symbolische Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Nibelungenlied: Kriemhilds Trauer - Emotion und Funktion im Mittelalter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Darstellung von Kriemhilds Trauer im Nibelungenlied. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob ihre Trauer als unkontrollierter Gefühlsausbruch oder als kontrollierte Handlung zu verstehen ist und welche soziale Funktion diese Emotion im mittelalterlichen Kontext hatte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse von Kriemhilds Trauer als kontrollierte oder unkontrollierte Emotionalität, ein Kapitel zur Funktion dieser Trauer und ein Fazit. Die Analyse konzentriert sich insbesondere auf Aventiure 17, in der Siegfrieds Tod und Kriemhilds Trauer beschrieben werden.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Funktion von Emotionalität, speziell Trauer, im mittelalterlichen Kontext. Sie hinterfragt die Natur von Kriemhilds Trauer und beleuchtet ihre soziale Funktion innerhalb des mittelalterlichen Gesellschaftssystems. Dabei werden Aspekte der mündlichen Kommunikation, Performanz und des Vertrauens in der mittelalterlichen Gesellschaft berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung von Trauer in mittelalterlichen Heldenepochen, die Unterscheidung zwischen kontrollierter und unkontrollierter Emotionalität im Mittelalter, die soziale Funktion ritualisierter Emotionen, den Einfluss von Performanz und Akustik auf die mittelalterliche Kommunikation und die Bedeutung von Vertrauen und Verbindlichkeit in der mittelalterlichen Gesellschaft.
Wie wird Kriemhilds Trauer im zweiten Kapitel analysiert?
Kapitel 2 analysiert Kriemhilds Trauerreaktion auf Siegfrieds Tod. Es untersucht, ob ihre Emotionalität als unkontrollierter Ausbruch oder als gezielte Emotionskontrolle zu interpretieren ist, berücksichtigt den Kontext des mittelalterlichen Lebens mit mündlicher Kommunikation und Performanz und diskutiert den Einfluss der fehlenden Rechtsinstitutionalisierung und des damit verbundenen Vertrauens auf die Interpretation von Emotionen. Es bezieht sich auf die Werke von Althoff und Czerwinski.
Welche Funktion wird Kriemhilds Trauer im dritten Kapitel zugeschrieben?
Kapitel 3 argumentiert, dass Kriemhilds Trauer nicht als bloßer Gefühlsausbruch, sondern als ritualisierte Verhaltensweise mit sozialer Funktion zu verstehen ist. Die rituelle Darstellung von Trauer diente der Herstellung von Sicherheit und Ordnung in einer Gesellschaft, die auf Vertrauen und mündliche Absprachen angewiesen war. Kontrollierte Emotionsdarstellung trug zur Stabilität und zum sozialen Zusammenhalt bei.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nibelungenlied, Kriemhild, Trauer, Emotion, Mittelalter, Emotionalitätskontrolle, Performanz, Akustik, soziale Funktion, Ritual, Vertrauen, höfische Gesellschaft, symbolische Kommunikation.
Auf welche Quellen stützt sich die Arbeit?
Die Arbeit benennt zwar nicht explizit alle Quellen, bezieht sich aber im zweiten Kapitel auf die Werke von Althoff und Czerwinski im Zusammenhang mit ritualisiertem Verhalten und symbolischer Kommunikation im Mittelalter. Die Hauptquelle ist natürlich das Nibelungenlied selbst, insbesondere Aventiure 17.
- Citation du texte
- Larisa Kom (Auteur), 2013, Die Emotion der Trauer und ihre Funktion am Beispiel Kriemhilds im "Nibelungenlied", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365364