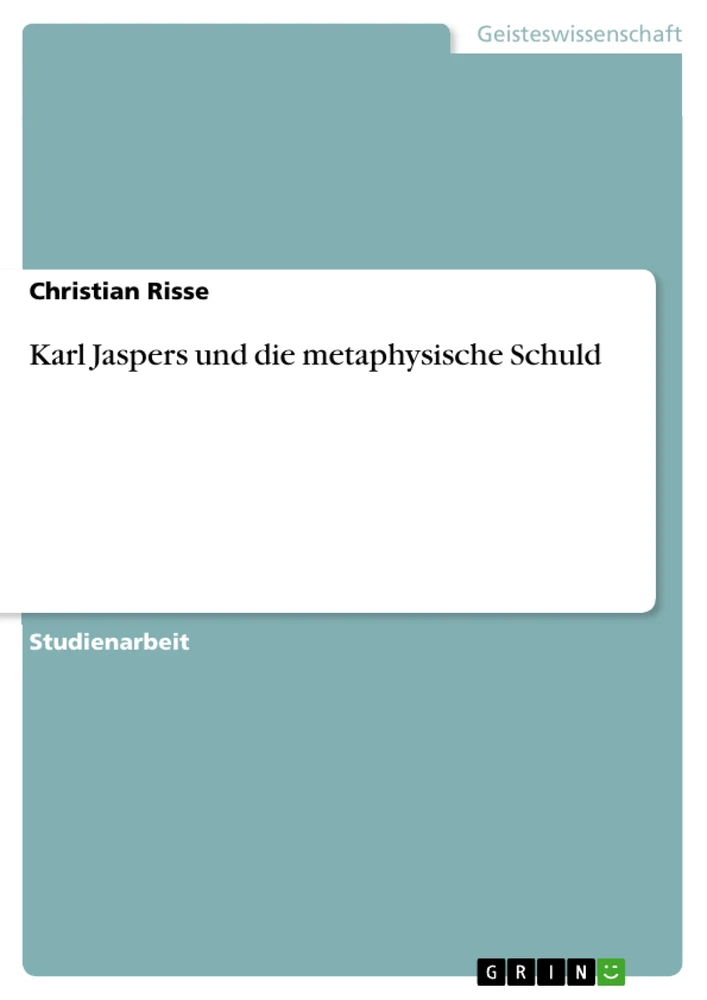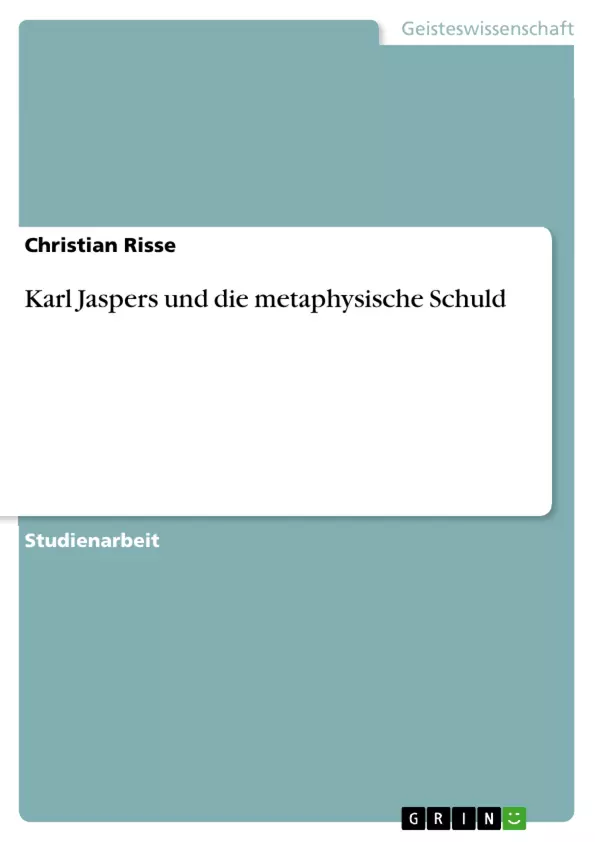In dieser Arbeit soll Jaspers' Begriff der metaphysischen Schuld näher untersucht und seine Argumentation auf Schlüssigkeit überprüft werden.
Im Jahre 1946 verfasste der Philosoph Karl Jaspers unter dem direkten Einfluss der Zeit des Nationalsozialismus, des verlorenen zweiten Weltkrieges und der folgenden Vorwürfe der Alliierten, wie auch der gesamten Welt „Die Schuldfrage“. In diesem Werk setzt er sich mit den Taten der Nationalsozialisten und der Rolle der deutschen Bevölkerung, nicht nur als aktiv Handelnde, sondern auch mit seiner Verantwortung als Mitwisser, Mitläufer und nur allzu oft schlicht Nicht-Verhinderer der Untaten auseinander. Im Zuge dessen führt Jaspers vier verschiedene Arten von Schuld ein, unter anderem den Begriff der metaphysischen Schuld.
Im Kontext dieses Begriffs argumentiert Jaspers einerseits zum Teil mit explizit religiösen Begriffen, etwa, wenn er als richtende Instanz dieser Schuld Gott angibt, andererseits benutzt er philosophische Begriffe, wie den der Metaphysik. Problematisch werden seine Ausführungen, wenn bei näherer Betrachtung deutlich wird, dass Jaspers religiöse, philosophische und ethische Begriffe zum Teil ohne nähere Erläuterung in verschiedenen Kontexten verwendet und dabei nicht voneinander abgrenzt oder näher definiert. An zahlreichen Stellen erscheint seine Argumentation eher schwach und diffus, dennoch erhebt er den Anspruch mit seinen Ausführungen zur Schuldfrage auch die deutsche Gesellschaft zu einer Reflexion und zu einer Veränderung zu bewegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Karl Jaspers, seine Philosophie und seine Ansichten zur Metaphysik
- Antidogmatische, antiabsolutistische und pluralistische Denkhaltung
- Philosophie und Wissenschaft
- Transzendenz und Grenzsituationen
- Philosophischer Glaube und Scheitern
- Ethik und Moral
- Metaphysische und andere Arten von Schuld
- Kritik am Konzept der metaphysischen Schuld
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Karl Jaspers' Konzept der metaphysischen Schuld, das er in seinem Werk „Die Schuldfrage“ im Kontext der Taten der Nationalsozialisten und der Rolle der deutschen Bevölkerung entwickelt. Ziel ist es, Jaspers' Argumentation auf Schlüssigkeit zu überprüfen und die konzeptionellen Schwächen seines Begriffs der metaphysischen Schuld aufzuzeigen.
- Jaspers' Philosophie und seine Ansichten zur Metaphysik
- Das Konzept der metaphysischen Schuld bei Jaspers
- Kritik an Jaspers' metaphysischer Schuld
- Transzendenz und Scheitern in Jaspers' Philosophie
- Das Spannungsverhältnis zwischen Religion und Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel skizziert die Grundzüge von Karl Jaspers' Philosophie und seinem Verständnis von Metaphysik, um eine Basis für das Verständnis seiner Philosophie rund um Schuld und den Umgang mit dieser zu schaffen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf seiner antidogmatischen, antiabsolutistischen und pluralistischen Denkhaltung sowie seinen Ansichten zu Philosophie und Wissenschaft, Transzendenz und Grenzsituationen, philosophischem Glauben und Scheitern sowie Ethik und Moral.
Das zweite Kapitel erläutert die verschiedenen Schuldkonzepte, die Jaspers in der Schuldfrage entwickelt, mit besonderem Fokus auf die moralische und die metaphysische Schuld. Jaspers' Argumentation, die zum Teil explizit religiöse Begriffe verwendet und philosophische Begriffe wie den der Metaphysik einbezieht, wird näher beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte dieser Arbeit sind: metaphysische Schuld, Karl Jaspers, Philosophie, Transzendenz, Grenzsituationen, Scheitern, religiöser Glaube, philosophischer Glaube, Ethik, Moral, Schuldfrage, Nationalsozialismus, deutsche Bevölkerung.
- Citation du texte
- Christian Risse (Auteur), 2017, Karl Jaspers und die metaphysische Schuld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365439