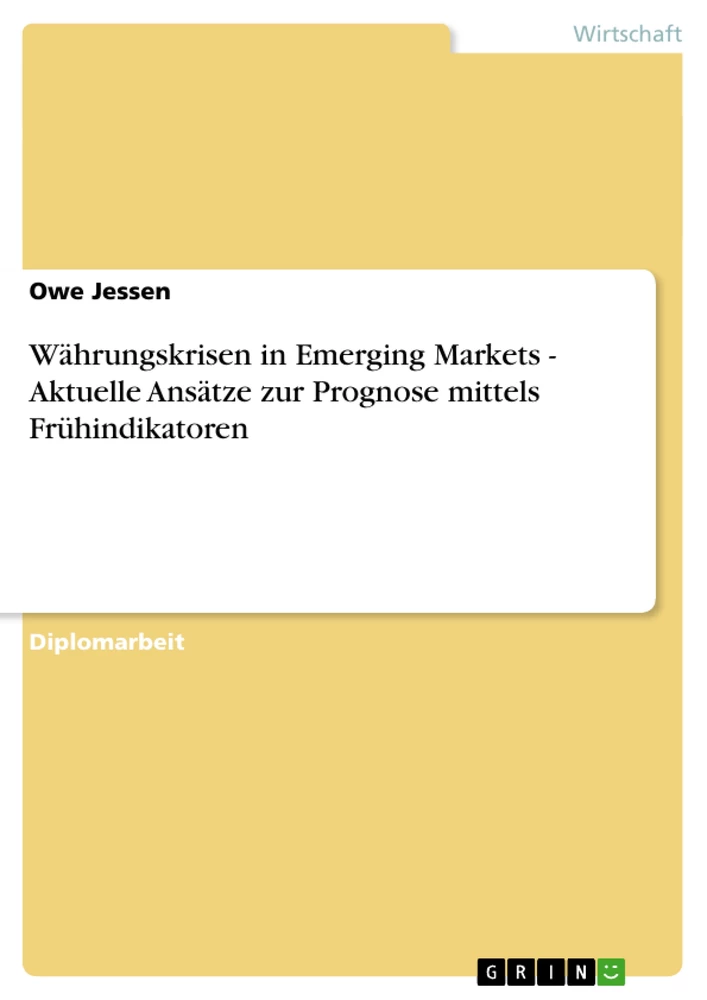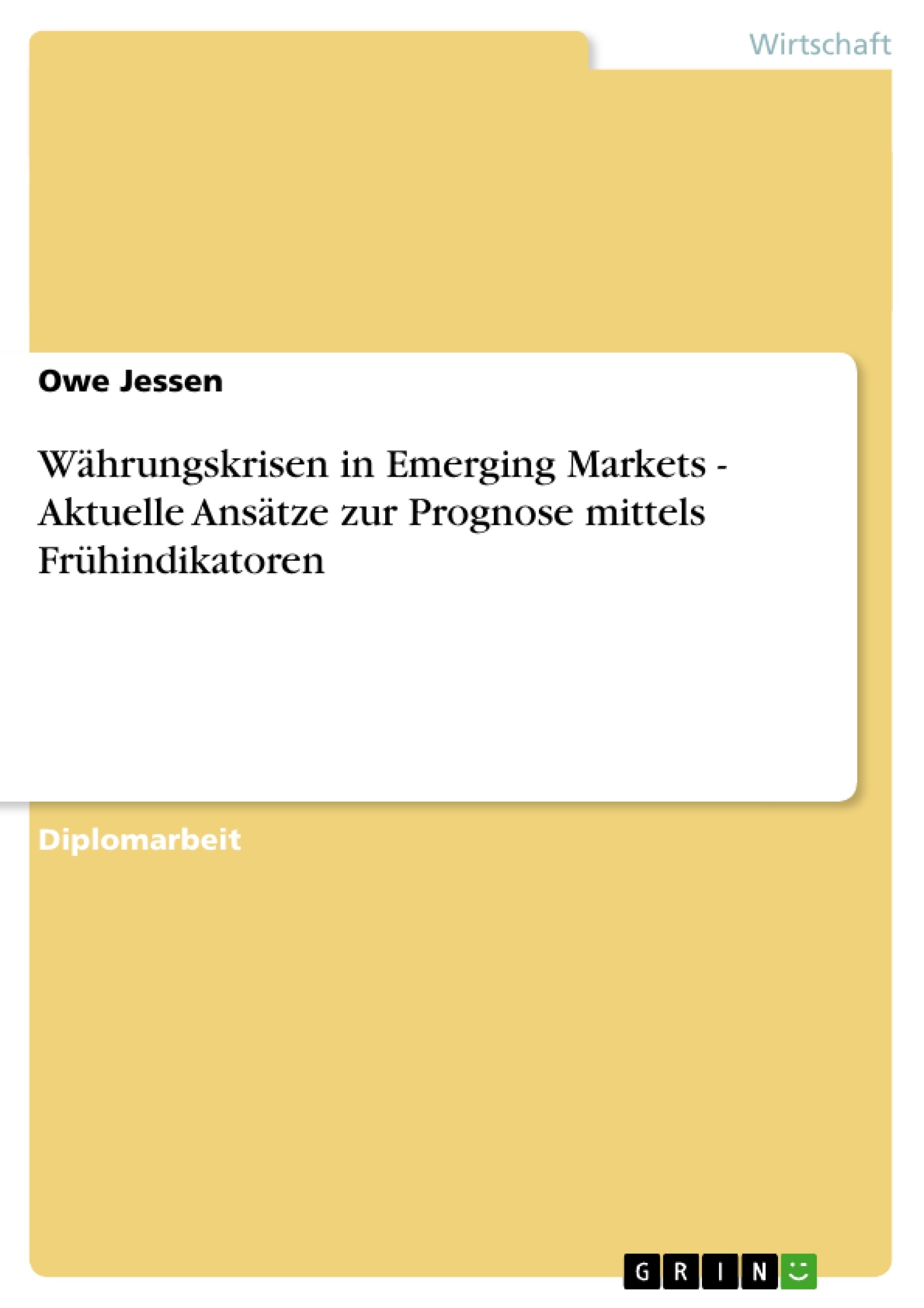Ziel der Arbeit ist es, den aktuellen Stand in der Erforschung von Währungskrisen und ihrer Prognose mittels Frühindikatoren darzustellen. Aufbauend hierauf wird ein eigener Krisenwarnindex konstruiert und seine Ergebnisse bewertet.
Als Währungskrisen werden in dieser Arbeit Zeiträume verstanden, in denen Währungen unter spekulativen Druck kommen. Verteidigt die Zentralbank in solchen Fällen den Wechselkurs, schwinden die Devisenreserven und die Zinsen steigen. Ist die Spekulation erfolgreich, wertet die Währung deutlich ab, bei Ländern mit Festwechselkurssystemen erfolgt ein Realignment bzw. eine Aufgabe des Systems. Es werden also nicht nur Episoden betrachtet, bei denen es zu einer tatsächlichen Abwertung kommt, sondern auch solche, bei denen spekulative Attacken erfolgreich abgewehrt werden.1
Für die Konstruktion eines Krisenindex, der aus Frühindikatoren konstruiert wird, ist das Verständnis der Ursachen von Währungskrisen notwendig. Daher sollen in Kapitel 2 die drei wesentlichen Erklärungsansätze dargestellt werden, um die geeigneten Schlüsse für die Auswahl der Indikatoren zu erhalten, die erklärenden Einfluß auf Krisen haben. Im Abschnitt 2.1 wird das Zahlungsbilanzkrisen-Modell dargestellt, im Abschnitt 2.2 werden Politikeinflüsse untersucht und im Abschnitt 2.3 das Phänomen, daß gleichzeitig in verschiedenen Ländern Krisen auftreten. Das Kapitel schließt mit Überlegungen, welche Indikatoren aufgrund der theoretischen Überlegungen als Frühindikatoren geeignet sind.
Anhand der Ansätze von Kaminsky u. a. (1998), Frankel und Rose (1996), Sachs u. a. (1996) und Eliasson und Kreuter (2001) werden im Kapitel 3 verschiedene Möglichkeiten diskutiert, einen Krisenindex zu konstruieren. Zunächst werden die einzelnen Modelle dargestellt und bewertet, um im Abschnitt 3.5 die Schlußfolgerungen für die eigene empirische Anwendung zu ziehen.
Auf der Grundlage der Ergebnisse der ersten beiden Kapitel wird im Kapitel Kapitel 4 ein eigener Krisenindex konstruiert. Im Abschnitt 4.1 wird ein Krisensignal berechnet, das im Sinne der o. g. Definition der Währungskrise den Abwertungsdruck auf eine Währung mißt. Dieses Krisensignal wird in Abschnitt 4.2 zur Schätzung eines Index von Frühindikatoren verwendet. Im Abschnitt 4.3 werden die Ergebnisse dieses Krisenindex bewertet.
Am Schluß werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefaßt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie der Währungskrise
- 2.1. Erste Generation der Zahlungsbilanzkrisen-Modelle
- 2.1.1. Das Modell
- 2.1.2. Erweiterungen des Modells.
- 2.2. Das Modell der zweiten Generation
- 2.3. Ansteckung.
- 2.3.1. Ansteckung und multiple Gleichgewichte
- 2.3.2. Transmissionskanäle der Ansteckung
- 2.4. Schlußfolgerungen für die empirische Anwendung
- 3. Ansätze zur Krisenprognose
- 3.1. Der Signal-Ansatz
- 3.1.1. Darstellung
- 3.1.2. Ergebnisse
- 3.2. Probit-Modell
- 3.2.1. Darstellung
- 3.2.2. Ergebnisse .
- 3.3. Cross-Section-Modell
- 3.3.1. Darstellung
- 3.3.2. Ergebnis
- 3.4. Kontinuierlicher Krisensignalwert als zu erklärende Variable .
- 3.4.1. Darstellung
- 3.4.2. Ergebnisse .
- 3.5. Schlußfolgerungen für die empirische Anwendung
- 4. Empirische Anwendung
- 4.1. Berechnung eines Krisensignals.
- 4.2. Konstruktion des Krisenwarnindex
- 4.2.1. Schätzung des Modells
- 4.2.2. Prognose des Krisenwarnindex
- 4.3. Ergebnisse
- 4.3.1. Grafische Analyse
- 4.3.2. Güte der Regression
- 4.3.3. Analyse der identifizierten Regressoren
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Währungskrisen in Emerging Markets und untersucht aktuelle Ansätze zur Prognose mittels Frühindikatoren. Die Arbeit hat zum Ziel, die theoretischen Grundlagen von Währungskrisen aufzuzeigen und verschiedene Prognosemethoden zu analysieren und empirisch zu überprüfen. Dabei steht die Entwicklung eines Frühindikators im Vordergrund, der die Wahrscheinlichkeit einer Währungskrise in Emerging Markets prognostizieren kann.
- Theorie der Währungskrise
- Modelle zur Prognose von Währungskrisen
- Entwicklung eines Frühindikators
- Empirische Anwendung des Frühindikators
- Schlussfolgerungen und Ausblick
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema Währungskrisen in Emerging Markets und stellt die Relevanz der Prognose mittels Frühindikatoren heraus. Kapitel zwei behandelt die theoretischen Grundlagen von Währungskrisen und stellt verschiedene Modelle zur Erklärung von Krisen vor. Dabei werden die ersten und zweiten Generationen der Zahlungsbilanzkrisen-Modelle sowie das Konzept der Ansteckung erläutert. Kapitel drei analysiert verschiedene Ansätze zur Krisenprognose, einschließlich des Signal-Ansatzes, des Probit-Modells und des Cross-Section-Modells. Kapitel vier stellt die empirische Anwendung der entwickelten Methode zur Prognose von Währungskrisen vor. Der Fokus liegt auf der Konstruktion eines Frühindikators und der Analyse der Ergebnisse. Abschließend bietet Kapitel fünf eine Zusammenfassung der Ergebnisse und einen Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Währungskrisen in Emerging Markets, Frühindikatoren, Krisenprognose, Zahlungsbilanzkrisen, Ansteckungseffekte, empirische Analyse, Modellentwicklung, Frühindikatoren-Entwicklung, Emerging Markets, Finanzmärkte, Wirtschaftspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel eines Krisenwarnindex für Währungskrisen?
Ziel ist es, durch die Analyse von Frühindikatoren den spekulativen Druck auf eine Währung rechtzeitig zu erkennen, bevor es zu einer massiven Abwertung oder dem Zusammenbruch des Wechselkurssystems kommt.
Was unterscheidet die erste von der zweiten Generation der Zahlungsbilanzkrisen-Modelle?
Modelle der ersten Generation fokussieren auf inkonsistente Fundamentaldaten, während die zweite Generation die Rolle von Erwartungen und multiplen Gleichgewichten betont, die Krisen auch ohne fundamentale Schwäche auslösen können.
Wie wird "Ansteckung" im Kontext von Finanzkrisen definiert?
Ansteckung (Contagion) beschreibt das Phänomen, dass eine Krise in einem Land auf andere Länder übergreift, oft durch Handelsverflechtungen oder eine Neubewertung von Risiken durch Investoren.
Welche methodischen Ansätze zur Krisenprognose werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert den Signal-Ansatz (Kaminsky), Probit-Modelle sowie Cross-Section-Modelle zur statistischen Vorhersage von Krisenwahrscheinlichkeiten.
Welche Rolle spielen Emerging Markets in dieser Untersuchung?
Emerging Markets stehen im Fokus, da sie aufgrund ihrer wirtschaftlichen Struktur und oft fixen Wechselkurssysteme besonders anfällig für plötzliche Kapitalabflüsse und spekulative Attacken sind.
- Quote paper
- Owe Jessen (Author), 2003, Währungskrisen in Emerging Markets - Aktuelle Ansätze zur Prognose mittels Frühindikatoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36551