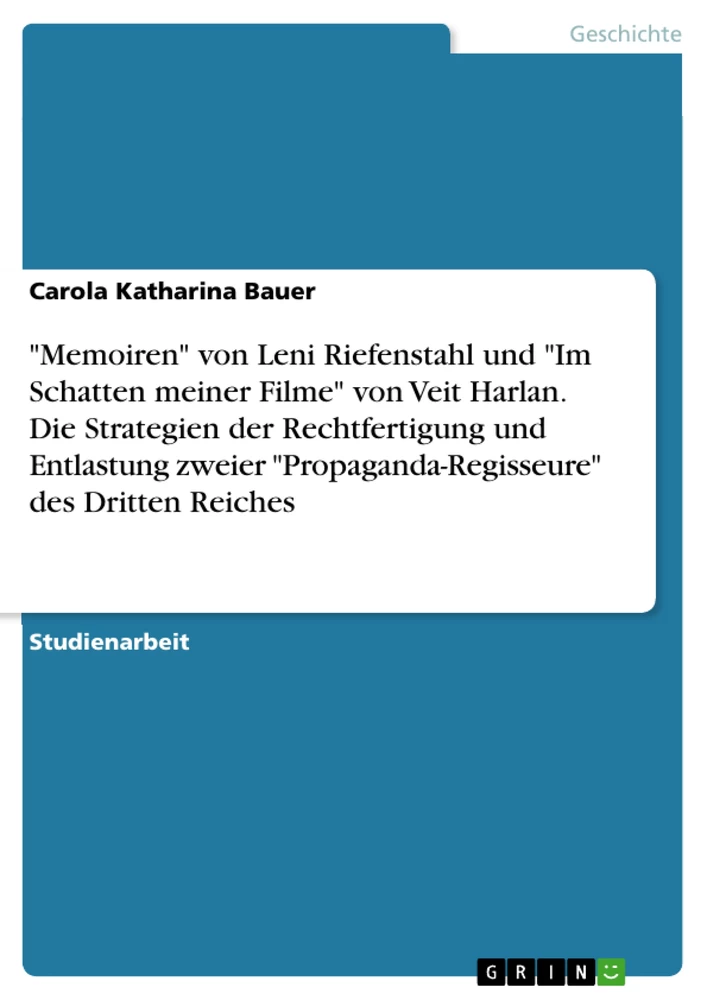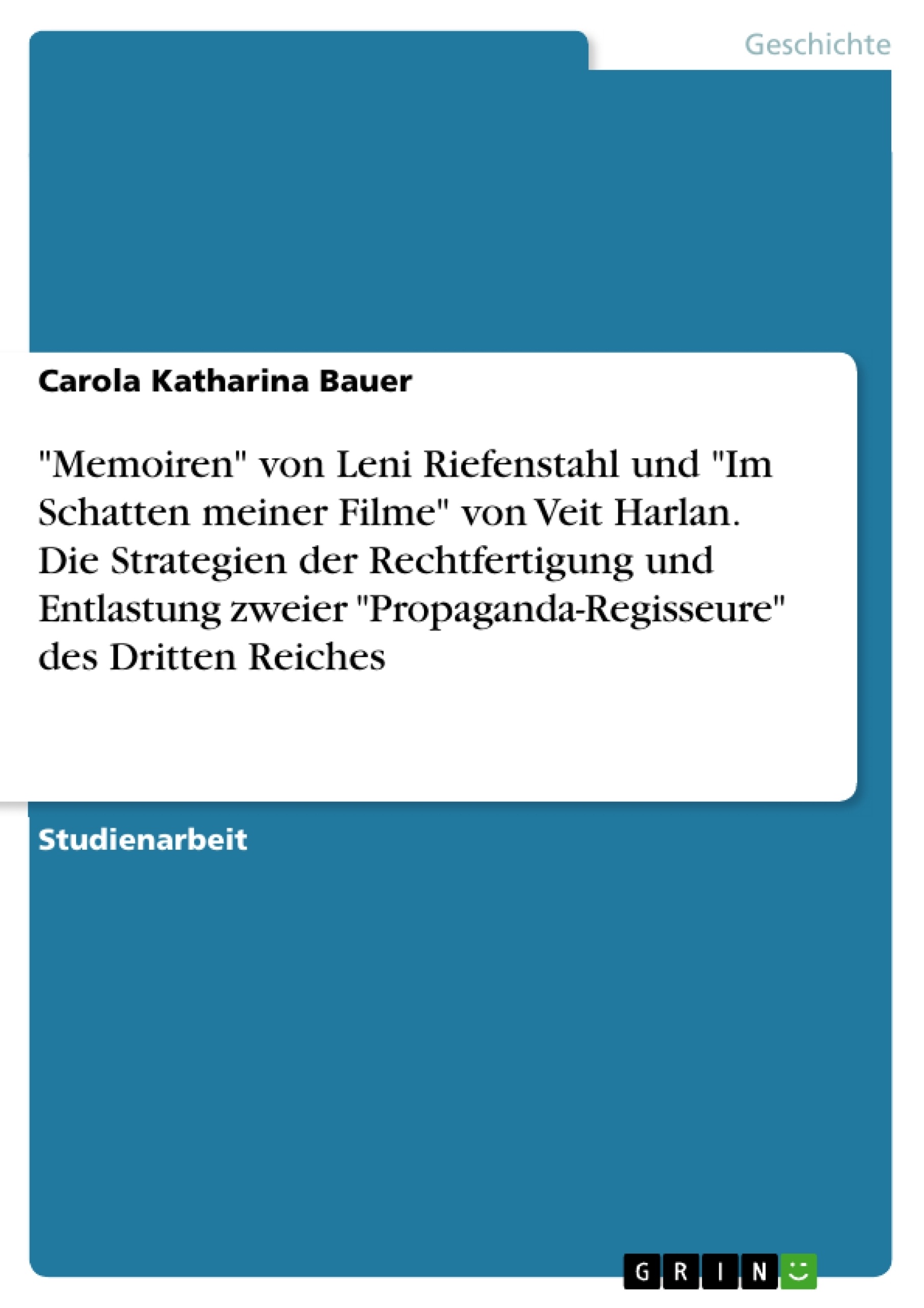Die vorliegende Hausarbeit konzentriert auf die Strategien, welche Veit Harlan und Leni Riefenstahl bei der Aufarbeitung der Vergangenheit in ihren Autobiographien anwenden, um ihre Tätigkeit als Regisseure im ‚Dritten Reich’ im Nachhinein zu erklären bzw. zu rechtfertigen.
Von besonderem Interesse erscheint mir hierbei die Frage, inwiefern es in den Texten zu einer Einsicht in eine mögliche Schuld oder Verantwortung kommt. Unter Berücksichtigung der Beeinflussung der Autobiographen durch ihren soziokulturellen, historischen Kontext soll auch dabei besonders herausgestellt werden, inwieweit die jeweiligen Darstellungen von bestimmten, tradierten Geschlechterstereotypen beeinflusst sind und inwiefern der Bezug auf diese geschlechtsspezifischen Rollenvorstellungen jeweils andere Argumentationsmuster erzeugt. Mit Blick auf die Zugehörigkeit von Veit Harlan und Leni Riefenstahl zur Berufsgruppe der Regisseure wird in der Seminararbeit zudem die Rolle, welche das Selbstverständnis als KünstlerIn bei dem Versuch der Exkulpation spielt, in die Überlegungen miteinbezogen werden.
Gliederung
1. Einleitung. Aufgabenstellung und Schwerpunkte der Seminararbeit
2. Rechtfertigungsstrategien in den Autobiographien Im Schatten meiner Filme von Veit Harlan und den Memoiren von Leni Riefenstahl
2.1 Leni Riefenstahl: Memoiren (1987)
a) Die Darstellung der Beziehung zum Nationalsozialismus/ der NS-Elite
b) Die Selbstdarstellung als Künstlerin und die Bewertung der eigenen Filme
2.2 Im Vergleich: Veit Harlan: Im Schatten meiner Filme (1966)
a) Die Darstellung der Beziehung zum Nationalsozialismus/ der NS-Elite
b) Die Selbstdarstellung als Künstler und die Bewertung der eigenen Filme
3. Zusammenfassung der Ergebnisse - Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Rechtfertigungsstrategien
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welche Strategien nutzen Riefenstahl und Harlan zur Rechtfertigung ihrer NS-Vergangenheit?
Beide nutzen in ihren Autobiographien Strategien der Entlastung, indem sie sich primär als unpolitische Künstler darstellen, die lediglich ihrem Handwerk nachgingen.
Gestehen die Regisseure in ihren Werken eine Mitschuld ein?
Die Arbeit untersucht kritisch, inwiefern es zu einer echten Einsicht in Verantwortung kommt oder ob Exkulpationsversuche dominieren.
Welche Rolle spielen Geschlechterstereotype bei der Argumentation?
Es wird analysiert, wie tradierte Rollenvorstellungen (z.B. die "naive Künstlerin" bei Riefenstahl) genutzt werden, um andere Argumentationsmuster der Entlastung zu erzeugen.
Wie stellen Riefenstahl und Harlan ihre Beziehung zur NS-Elite dar?
Die Autobiographien versuchen oft, die Nähe zu Größen wie Hitler oder Goebbels als rein beruflich oder unvermeidbar darzustellen.
Was ist das Ziel dieser vergleichenden Hausarbeit?
Ziel ist es, die spezifischen Muster der Aufarbeitung und Rechtfertigung zweier einflussreicher "Propaganda-Regisseure" des Dritten Reiches offenzulegen.
- Citar trabajo
- Carola Katharina Bauer (Autor), 2007, "Memoiren" von Leni Riefenstahl und "Im Schatten meiner Filme" von Veit Harlan. Die Strategien der Rechtfertigung und Entlastung zweier "Propaganda-Regisseure" des Dritten Reiches, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365548