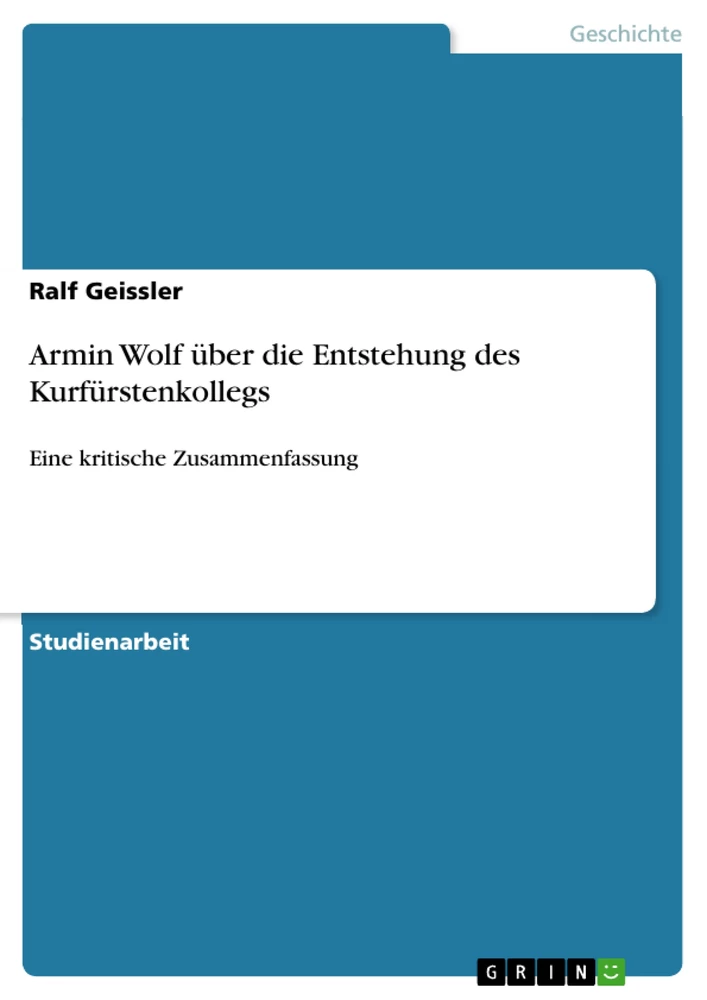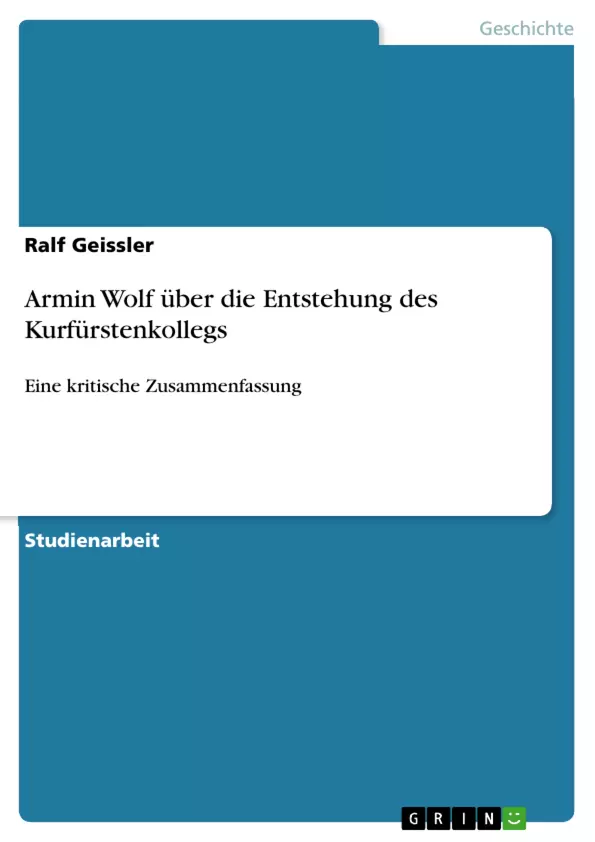Die Goldene Bulle von 1356 verbriefte sieben Fürsten des Heiligen Römischen Reiches ein besonderes Recht. Sie durften den deutschen König wählen, der dann in Rom vom Papst zum Kaiser gekrönt werden sollte. Dieses Gesetz, das Kaiser Karl IV (†1378) auf seinem
Reichstag in Nürnberg erlassen hatte, ist allerdings nicht der Ursprung dieses Privilegs. Die Goldene Bulle hielt lediglich eine Gewohnheit erstmals juristisch fest und regelte den genauen Ablauf der Königswahl. Etwa 450 Jahre behielt sie ihre Gültigkeit. Auch wenn bis 1806 noch einige Kurfürsten hinzukamen, so blieben die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier, der Pfalzgraf bei Rhein, der Markgraf von Brandenburg, der Herzog von Sachsen und der König von Böhmen nach der Goldenen Bulle die alleinigen legitimen
Königswähler und vererbten das Recht an ihre Nachfolger.
Doch warum gerade diesen Sieben die Königswahl zustand, wie dieses Gremium entstanden ist und um wie viel Jahre vor der rechtlichen Bestätigung durch die Goldene Bulle es sich herausgebildet hat, ist in der Forschung umstritten. Besonders stark wird um die Entstehung des Wahlrechts der vier weltlichen Fürsten diskutiert. Fest steht nur, dass sich bereits zwischen Ende des 12. und Ende des 13. Jahrhunderts der Kreis der wahlberechtigten Fürsten eingeengt haben muss. Spätestens 1298 bei der Wahl Albrechts von Österreich (†1308) muss das Kurfürstenkolleg bestanden haben.2
[...]
_____
2 Dieses Jahr entspricht der Datierung von Armin Wolf unter anderem in: Die Entstehung des Kurfürstenkollegs 1198-1298. Einen Forscher, der eine spätere Datierung ansetzt, habe ich nicht gefunden. Mehrere Quellen, die für dieses Jahr bereits von „Kurfürsten“ sprechen, erlauben eine spätere Datierung auch nicht. So kann, trotz verschiedenster Theorien über die Entstehung des Kurfürstenkollegs, dieses Datum als letztmöglicher Zeitpunkt für den Zusammenschluss des Gremiums angesehen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ablehnen der Erzämtertheorie
- Was ist die Erzämtertheorie?
- Armin Wolfs Auseinandersetzung mit den Quellen bis 1256
- Armin Wolfs Auseinandersetzung mit den Quellen zur Doppelwahl 1257
- Die These von der Quellen-Interpolation
- Die Interpolation des Sachsenspiegels
- Die Variationen der Interpolation in Deutschenspiegel und Schwabenspiegel
- Die Interpolation weiterer Quellen
- Die Spätdatierung der Hákonar saga Hákonarsar
- Die Entstehung des Kollegs durch einen Rechtsakt
- Die Sacri status imperii reformacio
- Das Ausüben der Hofämter durch die Kurfürsten
- Die These vom vererbten Königswahlrecht
- Die ottonische Erbengemeinschaft
- Die habsburgische Erbengemeinschaft in der Erbengemeinschaft
- Zusammenfassung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Quelleneditionen
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich mit der Entstehung des Kurfürstenkollegs im Heiligen Römischen Reich auseinander. Sie analysiert insbesondere die Argumentation des Rechtshistorikers Armin Wolf, der eine erbrechtliche Herleitung des Wahlrechts und eine späte Etablierung des Kollegs im Jahr 1298 vertritt.
- Kritische Auseinandersetzung mit Armin Wolfs These zur erbrechtlichen Herleitung des Wahlrechts der Kurfürsten
- Bewertung der Beweisführung für eine Interpolation wichtiger Quellen, insbesondere des Sachsenspiegels
- Analyse der verschiedenen Theorien zur Entstehung des Kurfürstenkollegs, insbesondere der Erzämtertheorie
- Untersuchung der Quellen und ihrer Interpretation im Hinblick auf die Entwicklung des Kurfürstenkollegs
- Rekonstruktion des historischen Kontextes der Entstehung des Kurfürstenkollegs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die historische Bedeutung des Kurfürstenkollegs und die zentrale These von Armin Wolf vorstellt. Anschließend wird die Erzämtertheorie und ihre Interpretation des Sachsenspiegels als Grundlage für das Wahlrecht der weltlichen Kurfürsten dargestellt. In Kapitel 2 analysiert die Arbeit Armin Wolfs Argumentation gegen die Erzämtertheorie und untersucht seine Interpretation von Quellen bis zum Jahr 1256.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit Armin Wolfs These der Quellen-Interpolation. Hier werden die von Wolf behaupteten Veränderungen am Sachsenspiegel sowie an anderen Quellen wie dem Deutschenspiegel und dem Schwabenspiegel näher beleuchtet. Kapitel 4 behandelt die Entstehung des Kurfürstenkollegs durch einen Rechtsakt, insbesondere die Sacri status imperii reformacio. Die Arbeit untersucht auch die Ausübung der Hofämter durch die Kurfürsten.
In Kapitel 5 wird die These vom vererbten Königswahlrecht anhand der ottonischen und der habsburgischen Erbengemeinschaften beleuchtet. Die Arbeit beleuchtet die Frage, inwieweit die Dynastien ein Erbwahlrecht beanspruchten und ob dies mit dem späteren Kurfürstenkolleg zusammenhängt. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Argumente und Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Kurfürstenkolleg, Königswahl, Heiligen Römischen Reich, Erzämtertheorie, Sachsenspiegel, Interpolation, Eike von Repgow, Armin Wolf, Sacri status imperii reformacio, Erbengemeinschaft, ottonische Dynastie, habsburgische Dynastie, Quellenkritik, Rechtsgeschichte, Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen
Was war die "Goldene Bulle" von 1356?
Die Goldene Bulle war ein wichtiges Grundgesetz des Heiligen Römischen Reiches, das die Rechte der sieben Kurfürsten zur Königswahl juristisch festschrieb.
Welche These vertritt Armin Wolf zur Entstehung des Kurfürstenkollegs?
Armin Wolf vertritt eine erbrechtliche Herleitung des Wahlrechts und datiert die endgültige Etablierung des Kollegs als festes Gremium auf das Jahr 1298.
Was ist die "Erzämtertheorie"?
Diese Theorie besagt, dass das Wahlrecht der Kurfürsten aus ihren Funktionen als Inhaber der höchsten Hofämter (Erzämter) am kaiserlichen Hof resultierte.
Was versteht man unter "Quellen-Interpolation" beim Sachsenspiegel?
Armin Wolf behauptet, dass wichtige Passagen im Sachsenspiegel (einem Rechtsbuch) nachträglich verändert oder eingefügt wurden, um das Wahlrecht der Fürsten zu legitimieren.
Wer waren die ursprünglichen sieben Kurfürsten?
Es waren die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier sowie der König von Böhmen, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg.
- Quote paper
- Ralf Geissler (Author), 2000, Armin Wolf über die Entstehung des Kurfürstenkollegs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3656