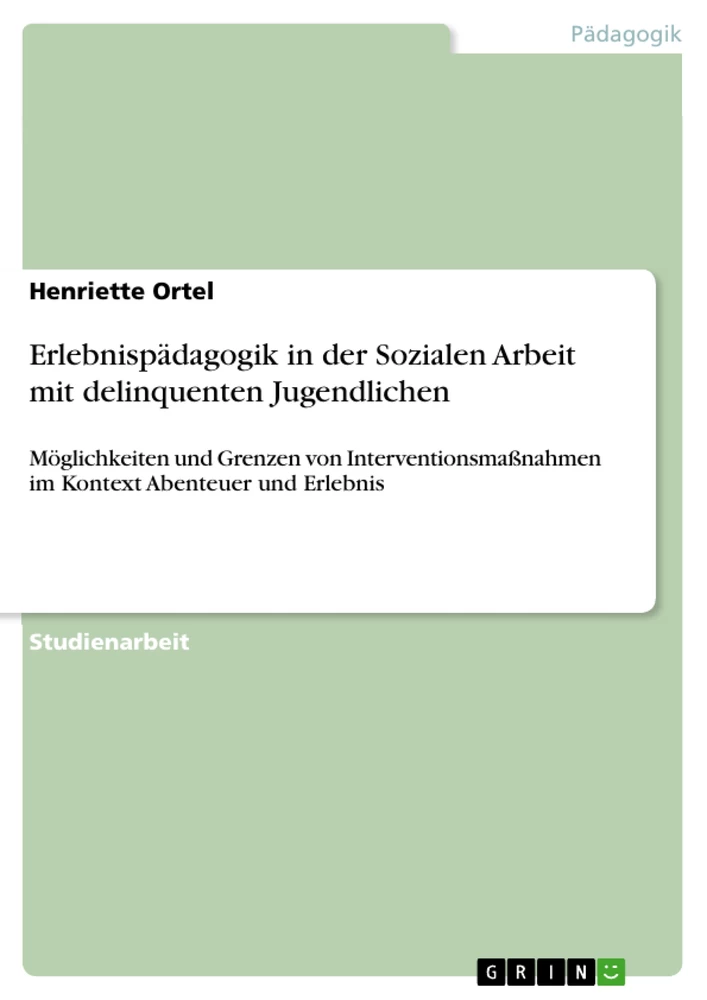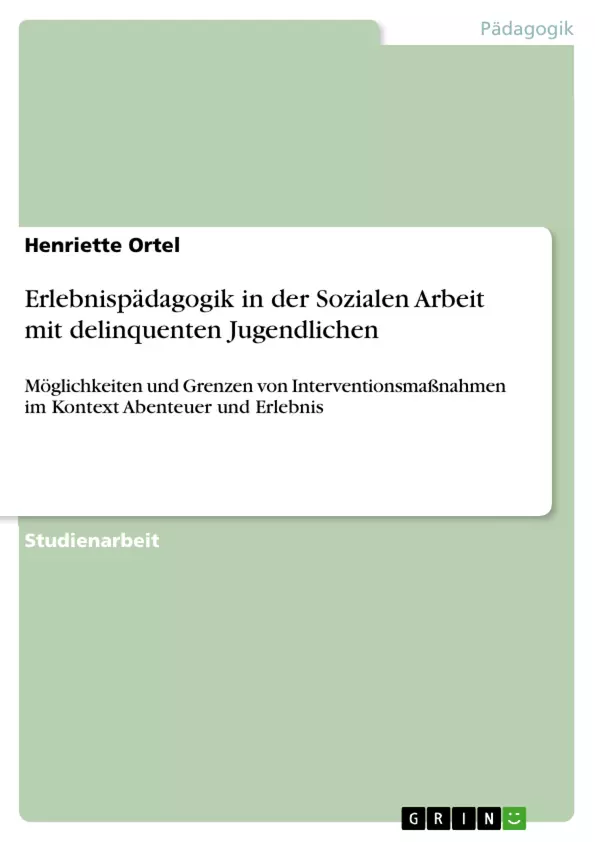In der vorliegenden Hausarbeit geht es vor allem darum, an Hand der kritischen Auseinandersetzung mit der Thematik Erlebnispädagogik deren Möglichkeiten und Grenzen in den stationären Hilfen zur Erziehung aufzuzeigen. Zudem soll der inhaltliche Schwerpunkt darauf liegen, hervorzuheben, ob Erlebnispädagogik lediglich eine Maßnahme mit kurzfristigen Impulsen und Anstößen für die Jugendlichen darstellt oder ob sie tatsächlich die Möglichkeit einer langfristigen Intervention besitzt. In diesem Kontext soll erörtert werden, in wie fern erlebnispädagogische Maßnahmen als Beitrag zur Bewältigung von delinquentem Verhalten bei Jugendlichen in den stationären Hilfen zur Erziehung angesehen werden können.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Delinquenz
1.1. Begriffsbestimmung Delinquenz
1.2. Delinquenz in Abgrenzung zu Devianz
1.3. Charakteristika Jugenddelinquenz
1.4. Exkurs soziologische Delinquenz-Theorie
1.4.1. Annäherung an die Begrifflichkeit Sozialisation im Zusammenhang mit Jugenddelinquenz
1.4.2. Wirkung der Individualisierung und Pluralisierung
1.4.3. Rolle der primären und sekundären Sozialisationsinstanzen
1.5. Zusammenfassung
2. Delinquenz und Erlebnispädagogik
2.1. Begriffliche Annäherung
2.2. Ziele erlebnispädagogischer Maßnahmen
2.3. Transfermodell
3. Erlebnispädagogik als Interventionsmaßnahme
3.1. Erlebnispädagogik als Interventionsmaßnahme in den Hilfen zur Erziehung
3.1.1. Erlebnispädagogik als Gestaltungsprinzip des Heimalltags
3.1.2. Erlebnispädagogik als Instrument zur Krisenintervention
3.1.3. Erlebnispädagogik als Alternative zum Strafvollzug
3.1.4. Erlebnispädagogik als eine Art „Finales Rettungskonzept“
3.2. Zusammenfassung
4. Kritische Betrachtung von Erlebnispädagogik
4.1. Erlebnispädagogik als „Finales Rettungskonzept“, „Wunderwaffe“ und Co.
4.2. Erlebnispädagogik im Kontext Freiwilligkeit vs. Zwang
4.3. Das Patent „Erlebnispädagogik“
4.4. Bedeutung des Transfers
4.5. Rolle der Freizeit- und Kurzzeitpädagogik
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Erlebnispädagogik bei delinquenten Jugendlichen?
Ziel ist es, durch Grenz- und Gruppenerfahrungen soziale Kompetenzen zu stärken, Selbstvertrauen aufzubauen und langfristige Impulse zur Bewältigung von delinquentem Verhalten zu setzen.
Wirkt Erlebnispädagogik langfristig oder nur kurzfristig?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob die Maßnahmen dauerhafte Verhaltensänderungen bewirken oder lediglich kurzfristige "Urlaubseffekte" darstellen. Der Erfolg hängt stark vom Transfer in den Alltag ab.
Kann Erlebnispädagogik eine Alternative zum Strafvollzug sein?
Ja, in den Hilfen zur Erziehung wird sie oft als Interventionsmaßnahme oder "finales Rettungskonzept" eingesetzt, um Jugendlichen in Krisensituationen neue Perspektiven außerhalb des Gefängnisses aufzuzeigen.
Was versteht man unter dem "Transfer" in der Erlebnispädagogik?
Transfer bedeutet die Übertragung der im Wald oder Gebirge gelernten Fähigkeiten (z. B. Teamarbeit, Frustrationstoleranz) auf die konkrete Lebenswelt und den Heimalltag des Jugendlichen.
Welche Rolle spielt die Freiwilligkeit bei diesen Maßnahmen?
Es besteht ein Spannungsfeld zwischen dem pädagogischen Ideal der Freiwilligkeit und dem institutionellen Zwang in stationären Hilfen. Die Arbeit beleuchtet, wie effektiv Maßnahmen unter Zwang sein können.
- Quote paper
- Henriette Ortel (Author), 2016, Erlebnispädagogik in der Sozialen Arbeit mit delinquenten Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365666