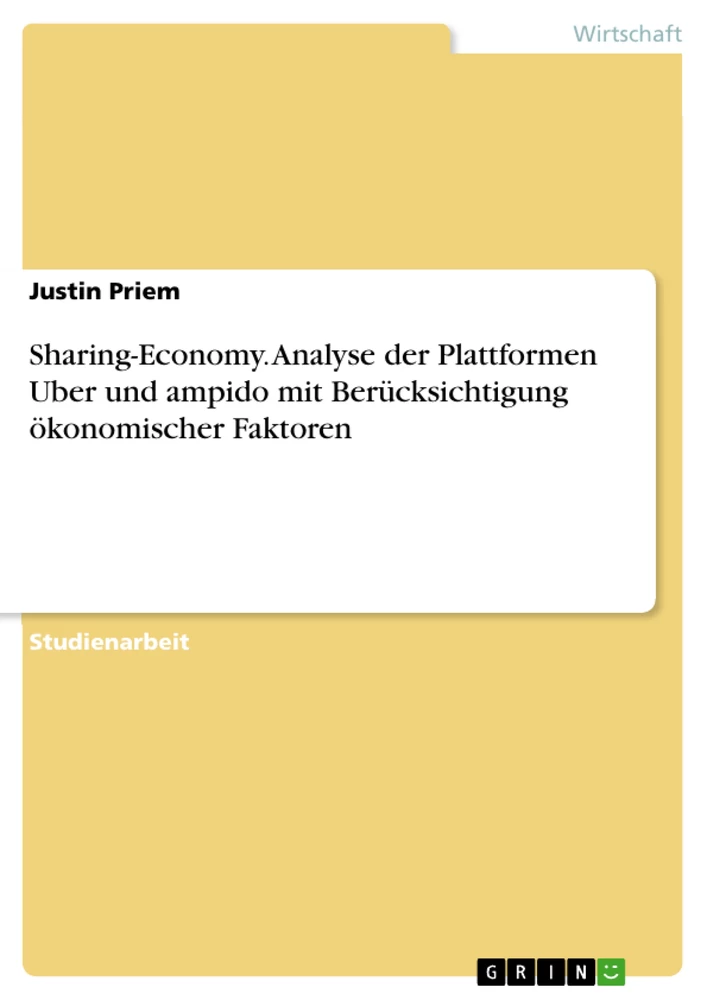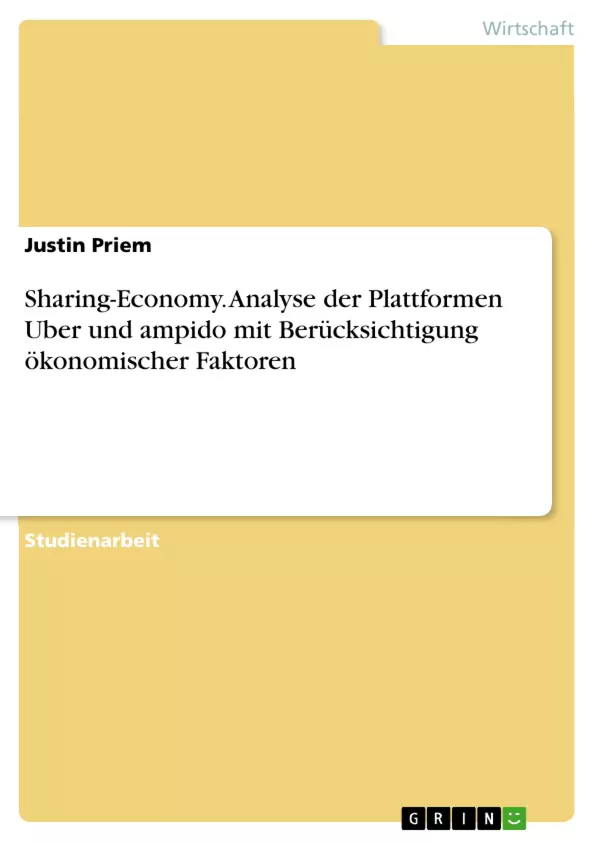Die Problemstellung dieser Arbeit ist, dass nicht genau feststeht, welche ökonomischen Aspekte Sharing-Economy-Plattformen erfolgreich machen. Ziel dieser Arbeit ist es also ökonomische Aspekte der Sharing Economy allgemein zu analysieren und diese dann auf zwei Beispielunternehmen anzuwenden, um zu sehen, ob die Annahmen der Theorien auf diese übertragen werden können.
Im zweiten Kapitel wird zunächst ein Versuch einer Definition des Themas Sharing Economy gewagt, um ein Grundverständnis darüber geben zu können, worum es sich bei dem Thema handelt.
Das darauffolgende Kapitel beschäftigt sich allgemein mit ökonomischen Theorien und ist dabei in zwei Theorien aufgeteilt: Die Theorie der Transaktionskosten und die Theo-rie des kollektiven Handelns. Diese Theorien werden erläutert, damit sie später auf die beiden Beispielunternehmen angewendet werden können.
Das vierte Kapitel gibt zunächst kurz einen Überblick darüber, welche erfolgreichen Sharing-Economy-Unternehmen es bereits gibt und zeigt gleichzeitig, dass Uber, eines der zwei gewählten Unternehmen für diese Arbeit, bereits zu den erfolgreichsten Unternehmen dieser Branche zählt. Anschließend wird zunächst das Unternehmen Uber kurz vorgestellt und das Geschäftsmodell erläutert. Danach wird Uber auf seine ökonomischen Aspekte hin analysiert und die beiden Theorien aus Kapitel 3 werden auf das Unternehmen angewendet. Abschließend wird ein kurzes Zwischenfazit gegeben, bevor am Beispiel des deutschen Unternehmens ampido dieselben Schritte der Vor-stellung und Analyse durchgeführt werden.
Im Fazit der Arbeit soll abschließend die Forschungsfrage beantwortet werden und ein Ausblick in die Zukunft der Sharing Economy gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung, Zielsetzung und Forschungsfrage
- Vorgehensweise
- Definition Sharing Economy
- Ökonomische Analyse der Sharing Economy
- Die Theorie der Transaktionskosten
- Die Theorie des kollektiven Handelns
- Analyse der beiden Geschäftsmodelle
- Unternehmensvorstellung Uber
- Das Geschäftsmodell
- Ökonomische Analyse des Unternehmens
- Zwischenfazit
- Unternehmensvorstellung ampido
- Das Geschäftsmodell
- Ökonomische Analyse des Unternehmens
- Zwischenfazit
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Analyse der Sharing Economy und untersucht dabei die ökonomischen Aspekte, die zum Erfolg dieser Plattformmodelle beitragen. Sie befasst sich mit der Frage, welche ökonomischen Faktoren den Erfolg von Sharing-Economy-Plattformen beeinflussen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Sharing Economy
- Anwendung ökonomischer Theorien auf die Sharing Economy, insbesondere der Theorie der Transaktionskosten und der Theorie des kollektiven Handelns
- Analyse der Geschäftsmodelle von Uber und ampido als exemplarische Vertreter der Sharing Economy
- Bewertung der ökonomischen Aspekte der beiden Unternehmen im Hinblick auf die Theorien der Transaktionskosten und des kollektiven Handelns
- Abschließende Bewertung der Bedeutung und des Zukunftspotenzials der Sharing Economy
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Problemstellung, Zielsetzung und Forschungsfrage der Arbeit dar.
- Kapitel 2 bietet eine Definition der Sharing Economy und beleuchtet verschiedene Definitionsversuche und die Einordnung des Begriffs in die Collaborative Economy und Collaborative Consumption.
- Kapitel 3 erläutert wichtige ökonomische Theorien, die zur Analyse der Sharing Economy herangezogen werden, insbesondere die Theorie der Transaktionskosten und die Theorie des kollektiven Handelns.
- Kapitel 4 analysiert die Geschäftsmodelle von Uber und ampido im Detail. Es beleuchtet die Geschäftsmodelle, führt eine ökonomische Analyse durch und zieht dabei die in Kapitel 3 vorgestellten Theorien heran. Das Kapitel endet mit einem Zwischenfazit für jedes Unternehmen.
Schlüsselwörter
Sharing Economy, Collaborative Economy, Collaborative Consumption, Transaktionskosten, Kollektives Handeln, Geschäftsmodell, Uber, ampido, Ökonomische Analyse
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Sharing Economy?
Es handelt sich um Plattformmodelle, die das Teilen oder gemeinsame Nutzen von Ressourcen (Collaborative Consumption) ermöglichen.
Welche ökonomischen Theorien erklären den Erfolg von Sharing-Plattformen?
Zentral sind die Theorie der Transaktionskosten (Senkung der Kosten für Suche und Abwicklung) und die Theorie des kollektiven Handelns.
Wie unterscheidet sich das Geschäftsmodell von Uber?
Uber fungiert als Vermittler von Mobilitätsdienstleistungen und nutzt Algorithmen, um Angebot und Nachfrage effizient zusammenzuführen.
Was macht das deutsche Unternehmen ampido?
Ampido ist eine Sharing-Plattform für Parkplätze, die es Privatpersonen ermöglicht, ihre freien Stellflächen zeitweise zu vermieten.
Warum sind Transaktionskosten in der Sharing Economy so wichtig?
Plattformen wie Uber oder ampido reduzieren die Kosten für den Nutzer, einen Dienstleister oder eine Ressource zu finden, was das Modell erst wirtschaftlich attraktiv macht.
- Quote paper
- B.A. Justin Priem (Author), 2017, Sharing-Economy. Analyse der Plattformen Uber und ampido mit Berücksichtigung ökonomischer Faktoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366004