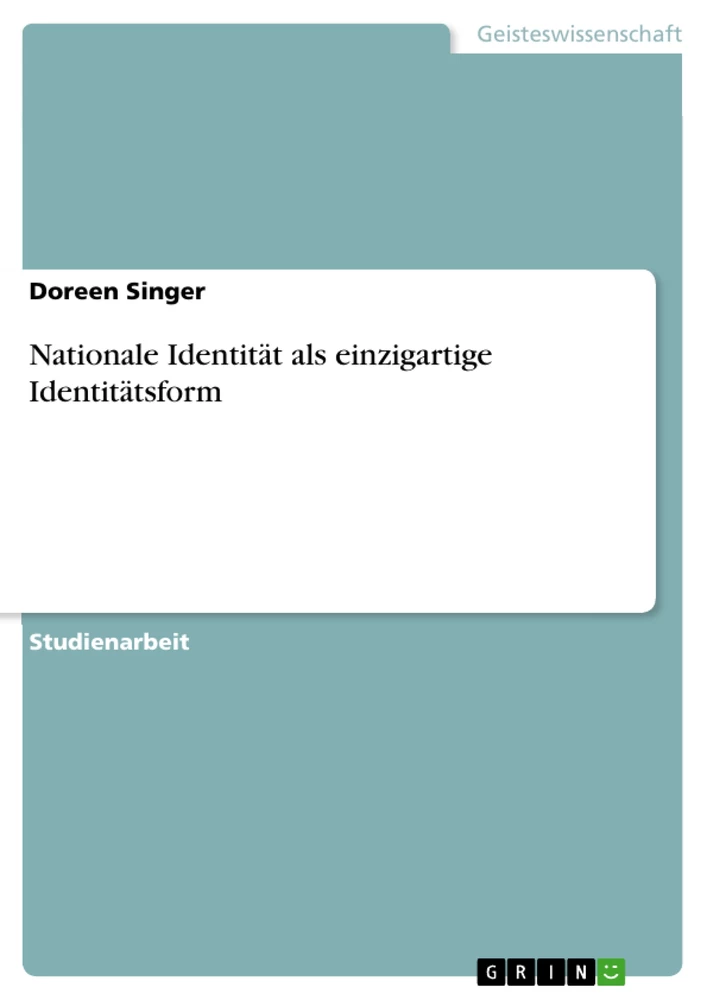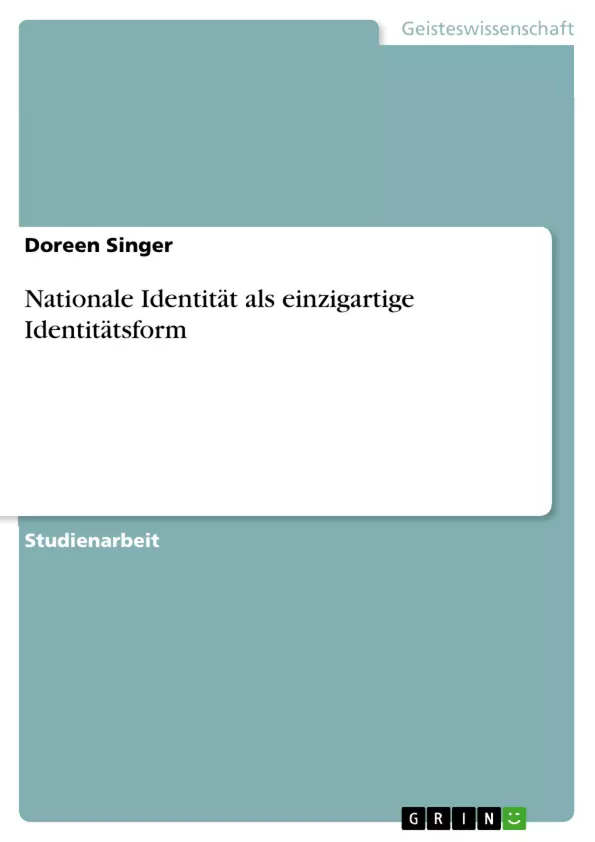Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Konzept der nationalen Identität, wobei auch andere Identitätsformen genauer in Betracht gezogen werden. Der Einfluss der Globalisierung spielt hierbei eine zentrale Rolle, genau wie die soziale Akzeptanz, die seit kurzem einen wichtigen Faktor einnimmt, was die soziokulturellen Strukturen betrifft, die sich erst seit wenigen Jahrzehnten vestärkt in unserer Gesellschaft entwickeln.
Eine genaue Abgrenzung der ‚nationalen Identität‘ zu anderen Identitätsformen kann erst nach Begriffsbestimmung des Wortes ‚Identität‘ vorgenommen werden. Die Benutzung des Begriffes ‚Identität‘ löst allein in Abhängigkeit des Zusammenhangs unterschiedliche Assoziationen und Abwehrreaktionen bei den Adressaten aus. Dem Verständnis von Identität als „vollkommene Gleichheit“ (Identität: aus dem Lateinischen ‚idem‘ = <derselbe>) reihen sich, gerade in Forschungsgebieten wie der Psychologie, Anthropologie, Soziologie und dergleichen, spezifische Vorstellungen von ‚Identität‘ an.
Inhaltsverzeichnis
- Das Konzept der nationalen Identität
- Abgrenzung zu anderen Identitätsformen
- Die Dimension des individuellen Bekenntnisses zur Nation
- Nationale Identität mit sozialem Bezug
- Nationale Identität und ethnische Pluralisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Konzept der nationalen Identität und grenzt es von anderen Identitätsformen ab. Sie beleuchtet die individuelle und soziale Dimension nationaler Identität und analysiert deren Rolle im Kontext ethnischer Pluralisierung.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung der nationalen Identität
- Individuelle und soziale Dimensionen nationaler Identität
- Der Einfluss sozialer Prozesse auf die Identitätsbildung
- Nationale Identität und Integration
- Der Zusammenhang zwischen nationaler Identität und ethnischer Pluralisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Das Konzept der nationalen Identität: Dieser Abschnitt beginnt mit einer Auseinandersetzung mit dem komplexen Begriff "Identität" und beleuchtet verschiedene Definitionen aus soziologischer und psychoanalytischer Perspektive (Mead, Freud, Ricken, Tenorth/Tippelt). Die Bedeutung von Inklusion und Exklusion in der Identitätsbildung wird hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen individueller und kollektiver Identität, wobei die individuelle Identität als Ausgangspunkt für die kollektive Identität betrachtet wird. Die Ausführungen betonen die Interdependenz zwischen individueller und sozialer Identität.
Abgrenzung zu anderen Identitätsformen: Der Kapitel befasst sich mit der Differenzierung zwischen personaler und sozialer Identität. Personale Identität wird durch individuelle, erkennbare Eigenschaften definiert, während soziale Identität sich aus Gruppenzugehörigkeiten und den damit verbundenen emotionalen Werten entwickelt. Die Arbeit verdeutlicht, wie Gruppenidentitäten (Familie, Religion, Partei etc.) nebeneinander existieren, sich überlagern oder gegenseitig ausschließen können. Schließlich wird die kollektive Identität als Oberbegriff eingeführt, zu der auch nationale und kulturelle Identität gehören.
Die Dimension des individuellen Bekenntnisses zur Nation: Dieses Kapitel untersucht das individuelle Engagement für eine kollektive Identität, insbesondere die nationale. Unter Bezugnahme auf Uhle wird kulturelle Identität als ein System von Werten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen definiert, das das Eigenbild einer Kulturgemeinschaft prägt. Die Ausbildung kollektiver Identität wird an drei sozialen Voraussetzungen festgemacht: institutionelle Ordnung, Gemeinschaft und Kommunikation. Der Abschnitt unterstreicht die dynamische Natur der Identität und deren ständigen Wandel, insbesondere in Zeiten großer gesellschaftlicher Veränderungen.
Schlüsselwörter
Nationale Identität, Identität, kollektive Identität, individuelle Identität, soziale Identität, Integration, ethnische Pluralisierung, Inklusion, Exklusion, Identitätsbildung, Gruppenzugehörigkeit, soziale Prozesse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Nationale Identität
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit dem Konzept der nationalen Identität. Sie untersucht dessen Definition, Abgrenzung zu anderen Identitätsformen (wie personaler und sozialer Identität), die individuellen und sozialen Dimensionen sowie den Einfluss auf und den Zusammenhang mit ethnischer Pluralisierung und Integration.
Welche Aspekte der nationalen Identität werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Facetten der nationalen Identität: den individuellen Bezug zur Nation, die Rolle sozialer Prozesse bei der Identitätsbildung, den Einfluss von Inklusion und Exklusion, und den Zusammenhang mit kultureller Identität. Sie analysiert die Interdependenz zwischen individueller und kollektiver Identität und betrachtet die nationale Identität im Kontext von Gruppenidentitäten (Familie, Religion, Partei etc.).
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene soziologische und psychoanalytische Perspektiven, unter anderem auf Mead, Freud, Ricken, Tenorth/Tippelt und Uhle. Diese Ansätze helfen, den komplexen Begriff der Identität zu definieren und die Dynamik der Identitätsbildung zu verstehen.
Wie wird die nationale Identität von anderen Identitätsformen abgegrenzt?
Die Arbeit differenziert deutlich zwischen personaler (individuelle Eigenschaften) und sozialer Identität (Gruppenzugehörigkeit und emotionale Werte). Sie zeigt, wie verschiedene Gruppenidentitäten nebeneinander existieren, sich überlagern oder ausschließen können und wie die nationale Identität Teil eines umfassenderen Konzepts der kollektiven Identität ist.
Welche Rolle spielt die ethnische Pluralisierung?
Die Seminararbeit analysiert den Zusammenhang zwischen nationaler Identität und ethnischer Pluralisierung. Sie untersucht, wie sich die nationale Identität in einem Kontext der kulturellen Vielfalt entwickelt und welche Herausforderungen und Chancen sich daraus ergeben.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Das Konzept der nationalen Identität; Abgrenzung zu anderen Identitätsformen; Die Dimension des individuellen Bekenntnisses zur Nation; Nationale Identität mit sozialem Bezug; Nationale Identität und ethnische Pluralisierung. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Nationale Identität, Identität, kollektive Identität, individuelle Identität, soziale Identität, Integration, ethnische Pluralisierung, Inklusion, Exklusion, Identitätsbildung, Gruppenzugehörigkeit, soziale Prozesse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Konzept der nationalen Identität umfassend zu untersuchen und dessen Bedeutung im Kontext von Individualität, Sozialität und ethnischer Pluralisierung zu analysieren. Sie will ein tieferes Verständnis für die Komplexität und Dynamik nationaler Identitätsbildung schaffen.
- Quote paper
- Doreen Singer (Author), 2017, Nationale Identität als einzigartige Identitätsform, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366108