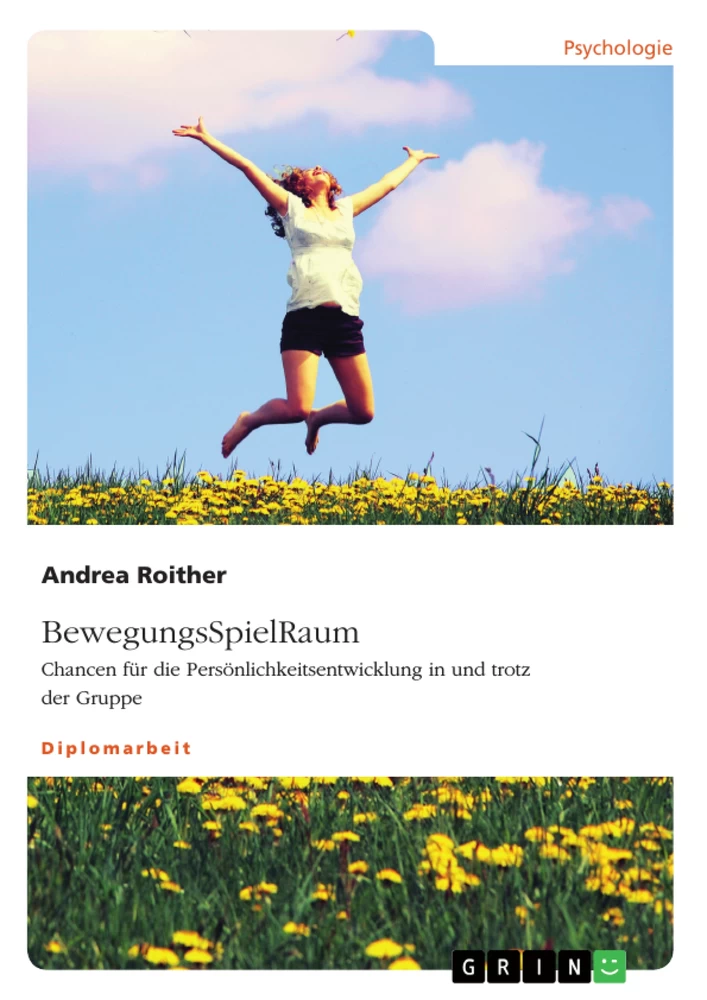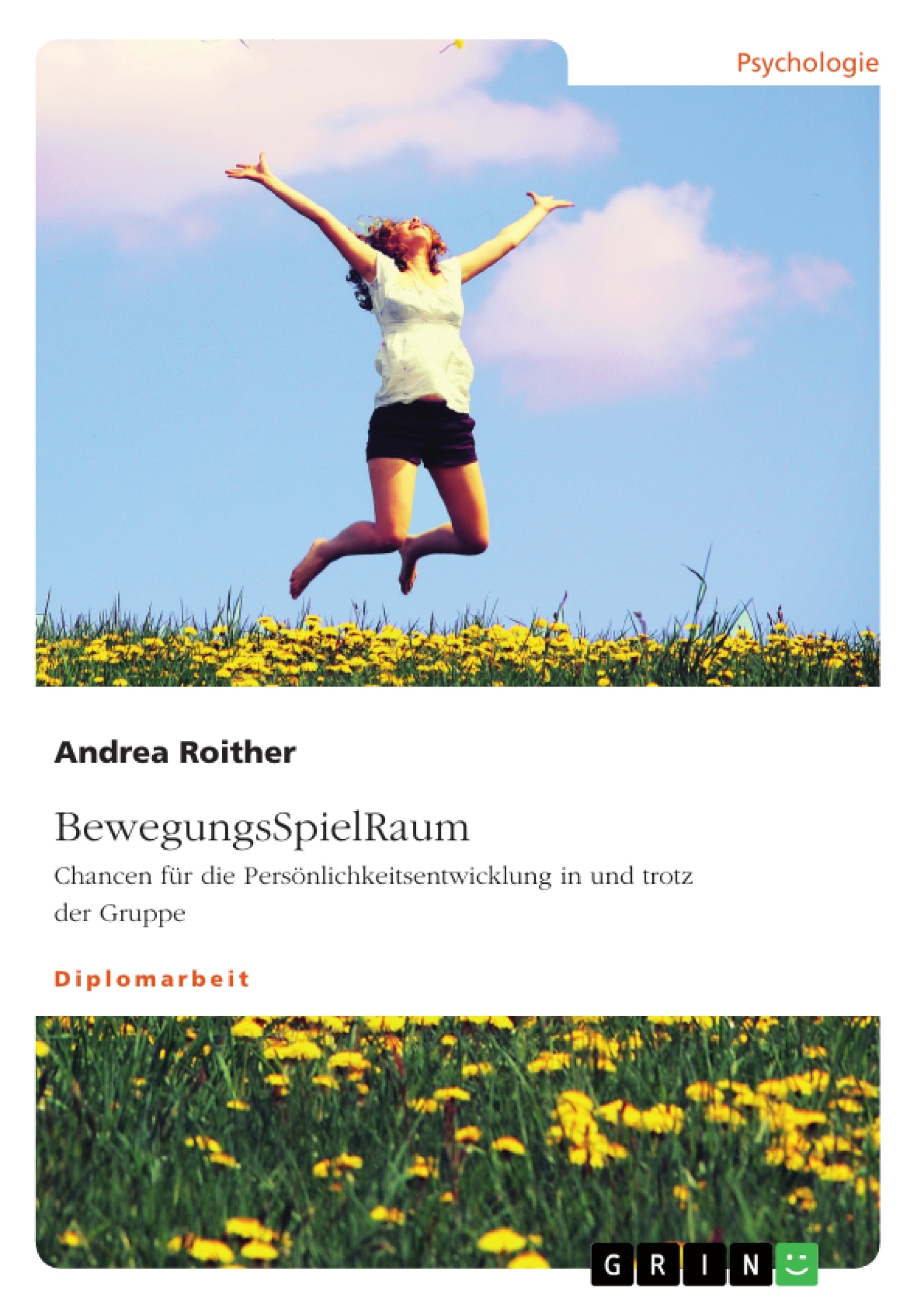Was lässt das Leben gelingen? Wie kann der Mensch sein eigenes Potential voll ausschöpfen – als Individuum, und gleichzeitig als Teil einer Gruppe? Unternehmerin, Diplom-Lebensberaterin in Logotherapie und Existenzanalyse und Coach Andrea Roither beschäftigt sich in diesem Buch mit dem Konstrukt des „BewegungsSpielRaumes“. Als Erfahrungsräume für die persönliche Entwicklung sollen BewegungsSpielRäume Menschen helfen, die nach neuen Möglichkeiten, Beweglichkeit, Selbstausdruck und Entwicklung suchen. Dabei steht auch die Frage im Mittelpunkt, welche Chancen sich durch das Entdecken und Erfahren von individuellen BewegungsSpielRäumen für die Persönlichkeitsentwicklung innerhalb einer Gruppe ergeben.
Der Zugang zur Fragestellung ist interdisziplinär: Aspekte der Psychologie, Soziologie, Philosophie, Humanethologie, Pädagogik, Logotherapie und Existenzanalyse werden von der Autorin herangezogen, um das eigens entwickelte Konstrukt „BewegungsSpielRaum“ zu reflektieren. Neben Überlegungen zum Mensch-Sein und Mensch-Werden in der Gruppe und Gesellschaft erschließt die Autorin Schlüsselpositionen für die Persönlichkeitsentwicklung – Beziehung, Emotion, Gefühl, Sinneswahrnehmung, Lernen und Kommunikation – die in ihrer Arbeit eine zentrale Basis für die menschliche Interaktion darstellen. Angeregt durch Beispiele aus ihrer beruflichen Praxis als Coach und Trainerin skizziert Andrea Roither Möglichkeiten, wie jeder Einzelne Zugang zu seinen BewegungsSpielRäumen erhält und sein Potential entfalten kann. Die wissenschaftliche Arbeit endet mit einer persönlichen Biografiearbeit der Autorin, in der ihre ersten 17 Lebensjahre mit den Ergebnissen der Untersuchung reflektiert werden.
Das Buch richtet sich an Trainer, Coaches, Supervisoren, HRs und Pädagogen sowie an jeden, der neue Handlungsräume entdecken und sich weiterentwickeln möchte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. BewegungsSpielRaum
- 1.1. Chancen zur Persönlichkeitsentwicklung in und trotz der Gruppe
- 1.1.1. Einleitung
- 1.1.2. Vorwort
- 1.1.3. Fragestellungen
- 1.1.4. Methodik
- 1.1.5. Das Konstrukt BewegungsSpielRaum
- 2. Bewegungsfelder des Menschen
- 2.1. Perspektiven zum Mensch-Werden und Mensch-Sein
- 2.1.1. Das Subjekt und die Welt
- 2.1.2. Freuds Persönlichkeitstheorie zur psychischen Entwicklung
- 2.1.3. Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung
- 2.1.4. Jungs Darstellung der Individuation
- 2.1.5. Keupps Ansätze zur Identität und deren Konstruktion
- 2.1.6. Schewior-Popps Zugang zur Persönlichkeit und deren Kompetenzen
- 2.1.7. Existenzialismus und Existenzphilosophie
- 2.1.8. Frankls Credo zum personalen Geist – die Person dahinter
- 2.1.9. Disziplinen (Säulen) der Logotherapie und Existenzanalyse
- 2.1.10. Zusammenfassung Mensch-Werden und Mensch-Sein
- 2.2. Perspektiven zum menschlichen Da-Sein und Bei-Sein
- 2.2.1. Körperliche Weltbeziehung
- 2.2.2. Das Gefühl der Entfremdung
- 2.2.3. Raum und Zeit
- 2.2.4. Fähigkeiten der Geistigen Person
- 2.2.5. Zusammenfassung Da-Sein und Bei-Sein
- 2.3. Perspektiven zum Mensch in der Gruppe und Gesellschaft
- 2.3.1. Gruppenidentität und Ich-Identität
- 2.3.2. Stammesgeschichtliche und kulturelle Anpassung
- 2.3.3. Sozialisation
- 2.3.4. Der Prozess - Tuckmans Phasen-Modell der Gruppendynamik
- 2.3.5. Die Struktur – Thomanns Beziehungsmodell und Stahls Gruppenfelder
- 2.3.6. Gesellschaft und Gerechtigkeit
- 2.3.7. Die Theorie des Guten und des vernünftigen Lebensplans
- 2.3.8. Gerechtigkeit und Glück für das Individuum
- 2.3.9. Spiritualität, Wert und Sinn
- 2.3.10. Zusammenfassung Mensch in der Gruppe und Gesellschaft
- 3. Schlüssel zur Persönlichkeitsentwicklung in BewegungsSpielRäumen
- 3.1. Position der Beziehung
- 3.2. Position der Emotion und des Gefühls
- 3.3. Position des Lernens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Chancen von „BewegungsSpielRäumen“ für die Persönlichkeitsentwicklung in und trotz der Gruppe. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Perspektiven aus Psychologie, Soziologie, Philosophie, Humanethologie und Pädagogik, sowie aus der Logotherapie und Existenzanalyse.
- Das Konstrukt „BewegungsSpielRaum“ und seine Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung
- Der Einfluss von Beziehungen, Emotionen und Sinneswahrnehmung auf die Persönlichkeitsentwicklung
- Lernen und Kommunikation in „BewegungsSpielRäumen“
- Die Rolle der Gruppe und Gesellschaft in der Persönlichkeitsentwicklung
- Theoretische Ansätze zur Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
1. BewegungsSpielRaum: Dieses einführende Kapitel legt den Grundstein der Arbeit und beschreibt das zentrale Konstrukt „BewegungsSpielRaum“. Es skizziert die Forschungsfrage, die Methodik und definiert den Begriff „BewegungsSpielRaum“ im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung. Es dient als Ausgangspunkt für die nachfolgenden Kapitel, in denen verschiedene theoretische Perspektiven auf den Menschen und seine Entwicklung in Gruppen beleuchtet werden.
2. Bewegungsfelder des Menschen: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit verschiedenen theoretischen Perspektiven auf das Mensch-Werden und Mensch-Sein. Es werden unterschiedliche Persönlichkeitsmodelle (Freud, Erikson, Jung, Keupp, Schewior-Popp) vorgestellt und im Zusammenhang mit existenzialistischen und logotherapeutischen Ansätzen diskutiert. Die Betrachtungsweisen des menschlichen Da-Seins und Bei-Seins in Bezug auf Körper, Gefühle, Raum und Zeit werden ebenso erörtert wie die Perspektive des Menschen in der Gruppe und Gesellschaft, einschließlich Gruppendynamik, Sozialisation und ethischen Fragen. Die einzelnen Unterkapitel liefern wichtige Bausteine, um das Konstrukt „BewegungsSpielRaum“ im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung zu verstehen.
3. Schlüssel zur Persönlichkeitsentwicklung in BewegungsSpielRäumen: In diesem Kapitel werden zentrale Aspekte für die Persönlichkeitsentwicklung in „BewegungsSpielRäumen“ herausgearbeitet. Die Bedeutung von Beziehung, Emotion und Lernen wird ausführlich diskutiert. Es werden verschiedene theoretische Ansätze zu den Bereichen Beziehungsgestaltung, Emotionsregulation und Lernprozessen vorgestellt und auf ihre Relevanz für die Persönlichkeitsentwicklung innerhalb der beschriebenen „BewegungsSpielRäume“ eingegangen. Der Fokus liegt dabei auf der Interaktion des Menschen als soziales Wesen und der damit verbundenen Bedeutung für die individuelle Entwicklung.
Schlüsselwörter
BewegungsSpielRaum, Persönlichkeitsentwicklung, Gruppe, Identität, Beziehung, Emotion, Gefühl, Sinneswahrnehmung, Lernen, Kommunikation, Logotherapie, Existenzanalyse, Identitätsbildung, Sozialisation, Gruppendynamik.
Häufig gestellte Fragen zu "BewegungsSpielRaum: Chancen zur Persönlichkeitsentwicklung in und trotz der Gruppe"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Chancen von „BewegungsSpielRäumen“ für die Persönlichkeitsentwicklung in und trotz der Gruppe. Sie beleuchtet verschiedene Perspektiven aus Psychologie, Soziologie, Philosophie, Humanethologie und Pädagogik, sowie aus der Logotherapie und Existenzanalyse.
Was wird unter "BewegungsSpielRaum" verstanden?
Das einführende Kapitel definiert das zentrale Konstrukt „BewegungsSpielRaum“ im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung. Es dient als Ausgangspunkt für die weiteren Kapitel, die verschiedene theoretische Perspektiven auf den Menschen und seine Entwicklung in Gruppen beleuchten.
Welche theoretischen Ansätze werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Persönlichkeitsmodelle (Freud, Erikson, Jung, Keupp, Schewior-Popp) und diskutiert diese im Zusammenhang mit existenzialistischen und logotherapeutischen Ansätzen. Sie betrachtet das menschliche Da-Sein und Bei-Sein in Bezug auf Körper, Gefühle, Raum und Zeit sowie die Perspektive des Menschen in der Gruppe und Gesellschaft, einschließlich Gruppendynamik, Sozialisation und ethischen Fragen.
Welche Schlüsselthemen werden im Kapitel 2 ("Bewegungsfelder des Menschen") behandelt?
Kapitel 2 bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit verschiedenen Perspektiven auf das Mensch-Werden und Mensch-Sein. Es umfasst unter anderem das Subjekt und die Welt, Freuds Persönlichkeitstheorie, Eriksons Stufenmodell, Jungs Individuation, Keupps Ansätze zur Identität, Schewior-Popps Zugang zur Persönlichkeit, Existenzialismus, Frankls Logotherapie, und die Rolle des Menschen in der Gruppe und Gesellschaft (Gruppenidentität, Sozialisation, Gruppendynamik, Gerechtigkeit).
Welche Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung werden in Kapitel 3 ("Schlüssel zur Persönlichkeitsentwicklung in BewegungsSpielRäumen") hervorgehoben?
Kapitel 3 untersucht die Bedeutung von Beziehung, Emotion und Lernen für die Persönlichkeitsentwicklung in „BewegungsSpielRäumen“. Es werden verschiedene theoretische Ansätze zu den Bereichen Beziehungsgestaltung, Emotionsregulation und Lernprozessen vorgestellt und auf ihre Relevanz für die Persönlichkeitsentwicklung innerhalb der beschriebenen „BewegungsSpielRäume“ eingegangen. Der Fokus liegt auf der Interaktion des Menschen als soziales Wesen und der damit verbundenen Bedeutung für die individuelle Entwicklung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
BewegungsSpielRaum, Persönlichkeitsentwicklung, Gruppe, Identität, Beziehung, Emotion, Gefühl, Sinneswahrnehmung, Lernen, Kommunikation, Logotherapie, Existenzanalyse, Identitätsbildung, Sozialisation, Gruppendynamik.
Welche Methodik wurde in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit beschreibt die angewandte Methodik im einführenden Kapitel (Kapitel 1.1.4).
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit gestellt?
Die Forschungsfragen werden im einführenden Kapitel (Kapitel 1.1.3) vorgestellt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Chancen von „BewegungsSpielRäumen“ für die Persönlichkeitsentwicklung in und trotz der Gruppe und beleuchtet den Einfluss von Beziehungen, Emotionen, Sinneswahrnehmung, Lernen und Kommunikation auf die Persönlichkeitsentwicklung. Sie untersucht auch die Rolle der Gruppe und Gesellschaft und verschiedene theoretische Ansätze zur Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsbildung.
- Quote paper
- Andrea Roither (Author), 2017, BewegungsSpielRaum. Chancen für die Persönlichkeitsentwicklung in und trotz der Gruppe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366378