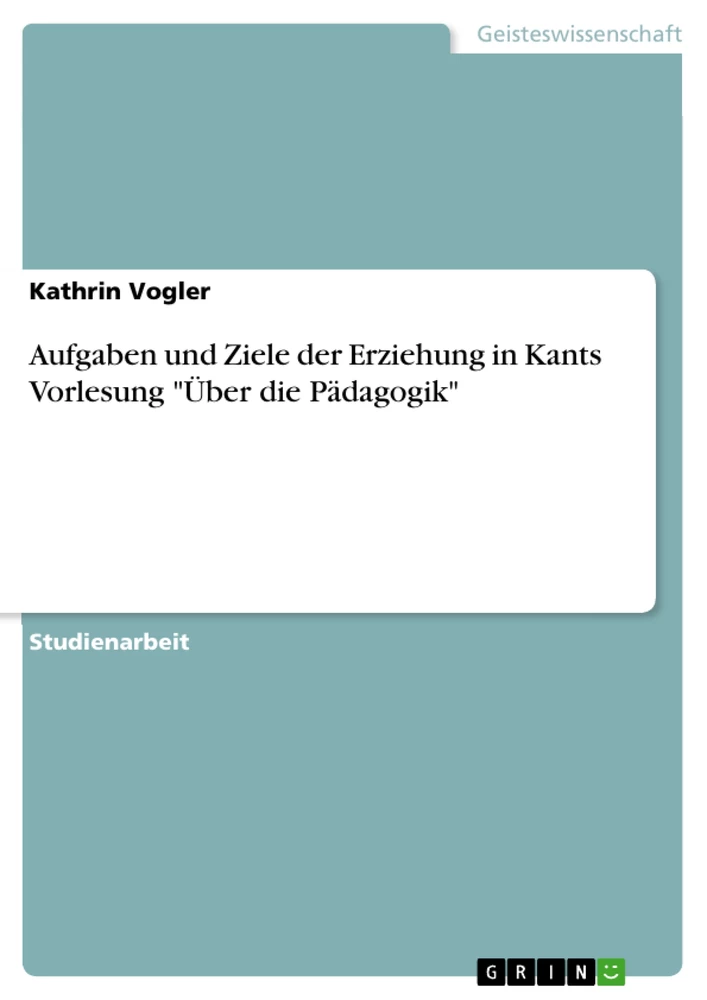Kant und Pädagogik – zwei Begriffe, die vielleicht nicht sofort miteinander in Verbindung gebracht werden. Schließlich war Immanuel Kant nicht in erster Linie als Pädagoge tätig, sondern hat sich als Philosoph des 18.Jahrhunderts einen Namen gemacht und gilt heute nicht ohne Grund als einer der bedeutendsten, wenn nicht sogar als der bedeutendste deutsche Philosoph.
Es ist dennoch nicht überraschend, dass Kant sich früher oder später mit dem Thema Erziehung auseinander setzen musste. "Musste" ist hierbei wörtlich zu verstehen, denn tatsächlich wurde ihm während seiner Lehrtätigkeit an der Königsberger Universität aufgetragen, eine Vorlesung über Pädagogik zu halten. Dieser Verpflichtung kommt Kant im Wintersemester 1776/77 zum ersten Mal nach. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Definition, den Aufgaben und den Zielen der Erziehung in Kants Vorlesung "Über die Pädagogik".
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Was ist Erziehung?
- 1.1 Anthropologische Grundlegung
- 1.2 Definition von Erziehung
- 1.3 Einteilung des Erziehungsbegriffs
- 2. Aufgaben der Erziehung
- 2.1 Wartung
- 2.2 Disziplinierung
- 2.3 Kultivierung
- 2.4 Zivilisierung
- 2.5 Moralisierung
- 3. Erziehungsziele
- 4. Das Problem der Erziehung
- II. Kants Vorlesung Über Pädagogik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Immanuel Kants Vorlesung Über Pädagogik und untersucht seine pädagogischen Ideen im Kontext der Aufklärung. Im Fokus stehen Kants anthropologische Grundlegung, seine Definition von Erziehung, die Aufgaben der Erziehung sowie die Rolle der Vernunft in Kants pädagogischem Denken.
- Kants anthropologische Grundlegung und die Bedeutung des Menschenbildes für seine Pädagogik
- Die Definition von Erziehung bei Kant und die verschiedenen Aspekte, die er umfasst
- Die Aufgaben der Erziehung nach Kant, wie Wartung, Disziplinierung, Kultivierung, Zivilisierung und Moralisierung
- Kants Einteilung des Erziehungsbegriffs in physische und praktische Erziehung
- Die Rolle der Vernunft und des moralischen Gesetzes in Kants pädagogischen Ausführungen
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Dieser Abschnitt stellt Immanuel Kant als Philosoph der Aufklärung vor und beleuchtet seine Bedeutung für die Pädagogik. Er skizziert Kants Lebensweg und seine Zeit im Kontext der Aufklärung, wobei er die Rolle der Vernunft und der Mündigkeit hervorhebt.
- 1. Was ist Erziehung?: Dieses Kapitel beginnt mit der anthropologischen Grundlegung von Kants Pädagogik und beschreibt sein Menschenbild. Es stellt die Frage, warum Erziehung überhaupt notwendig ist und erläutert Kants Auffassung von den "guten Keimen" im Menschen.
- 1.2 Definition von Erziehung: Dieser Abschnitt präsentiert Kants verschiedene Definitionen von Erziehung und zeigt die Vielschichtigkeit seines Erziehungsbegriffs auf. Es werden verschiedene Aspekte wie Wartung, Disziplin, Unterweisung und Bildung hervorgehoben.
- 1.3 Einteilung des Erziehungsbegriffs: Kant teilt seine Vorlesung über Pädagogik in physische und praktische Erziehung auf. Diese Einteilung entspricht seiner Unterscheidung zwischen dem Menschen als sensibles und intelligibles Wesen.
- 2. Aufgaben der Erziehung: Dieser Abschnitt erläutert Kants Auffassung von den verschiedenen Aufgaben der Erziehung, die von der Wartung über die Disziplinierung bis hin zur Kultivierung und Moralisierung reichen.
Schlüsselwörter
Immanuel Kant, Pädagogik, Aufklärung, Anthropologie, Vernunft, Mündigkeit, Erziehung, Wartung, Disziplinierung, Kultivierung, Zivilisierung, Moralisierung, physische Erziehung, praktische Erziehung, sensibles Wesen, intelligibles Wesen
Häufig gestellte Fragen
War Immanuel Kant ein Pädagoge?
Kant war primär Philosoph, hielt jedoch im Rahmen seiner Lehrtätigkeit an der Universität Königsberg ab 1776 Vorlesungen über Pädagogik.
Wie definiert Kant Erziehung?
Erziehung ist für Kant der Prozess, durch den der Mensch zum Menschen wird. Er unterscheidet dabei zwischen physischer und praktischer Erziehung.
Was sind die fünf Aufgaben der Erziehung nach Kant?
Die Aufgaben sind Wartung (Pflege), Disziplinierung (Bezähmung der Wildheit), Kultivierung (Belehrung), Zivilisierung (Manieren) und Moralisierung (Gesinnung).
Warum ist Moralisierung für Kant das höchste Ziel?
Weil der Mensch dadurch lernt, nicht nur aus Gewohnheit, sondern aus Einsicht in das moralische Gesetz und aus Pflicht zu handeln.
Welche Rolle spielt die Vernunft in Kants Pädagogik?
Die Erziehung soll den Menschen dazu befähigen, seine Vernunft selbstständig zu gebrauchen und so den Zustand der Mündigkeit zu erreichen.
- Quote paper
- Kathrin Vogler (Author), 2016, Aufgaben und Ziele der Erziehung in Kants Vorlesung "Über die Pädagogik", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366478