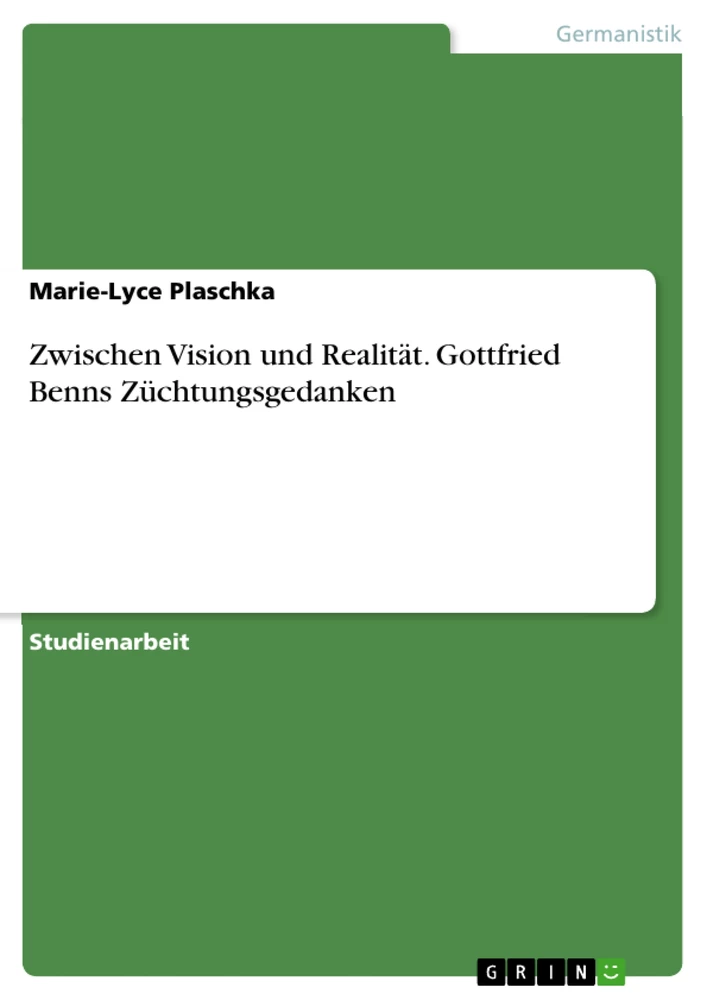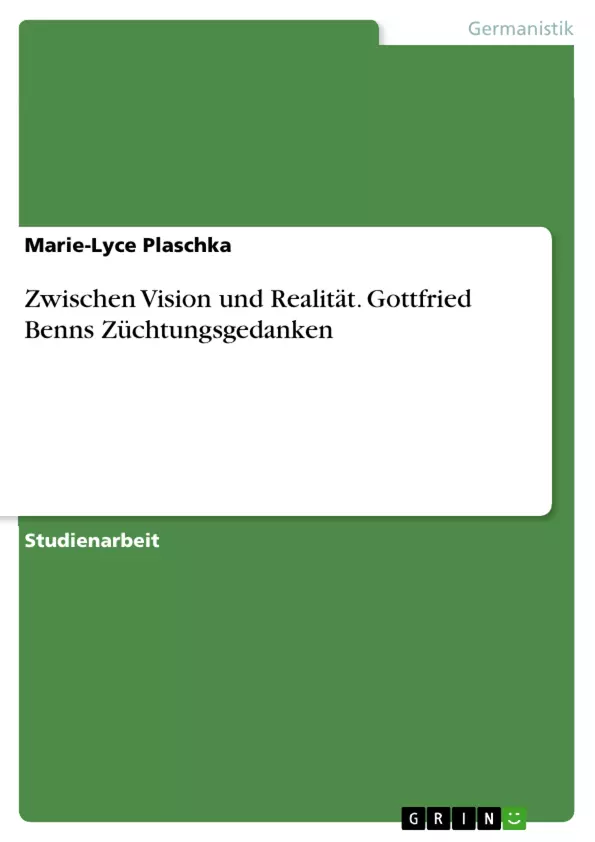Im Folgenden wird zunächst untersucht, inwieweit der Essay „Der Aufbau der Persönlichkeit“ und die politischen Veränderungen in Deutschland Anlass für Gottfried Benns Züchtungsgedanken sein könnten. Nicht zu übersehen ist dabei Benns Wunsch nach der Schaffung eines neuen Menschen. Aber welche Eigenschaften hat dieser neue deutsche Mensch und was unterscheidet ihn zum vorherigen Menschen? Diese Frage soll durch eine Gegenüberstellung anhand des Essays „Züchtung I“ geklärt werden.
In seinem Aufsatz „Geist und Seele künftiger Geschlechter“ wird eine Antwort darauf gegeben, ob und inwieweit sich Benn mit seinen Aufsätzen an das nationalsozialistische Gedankengut annähert. Kommentare und Rezensionen der Öffentlichkeit zu seinen Züchtungsvorstellungen werden vorgestellt und fließen in die Analyse mit ein. Ziel ist es, zu analysieren, inwieweit seine Gedanken zur Züchtung eines neuen Menschen mit denen des Nationalsozialismus in Einklang gebracht werden können und ob sie nur eine Vision des Dichters waren oder Einfluss auf die Realität nehmen konnten.
Inhaltsverzeichnis
- Zeitgeist 1900-1933
- Zwischen Vision und Realität: Gottfried Benns Züchtungsgedanken
- Anlass für Gottfried Benns Züchtungsgedanken
- Gottfried Benns Konstruktion zum Wesen des Menschen
- Gottfried Benns Sicht auf die politischen Vorgänge 1933
- Der alte Mensch und Gottfried Benns Vision vom neuen Menschen
- Gottfried Benns Annäherung an die Realität
- Reaktionen in der Öffentlichkeit
- Gottfried Benns Scheitern an der Wirklichkeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Gottfried Benns Züchtungsgedanken im Kontext des Zeitgeschehens der 1930er Jahre. Der Fokus liegt auf der Analyse der Entstehung und Entwicklung dieser Gedanken, deren Beziehung zur politischen Situation in Deutschland und deren Rezeption in der Öffentlichkeit.
- Gottfried Benns biologische Sicht auf den Menschen
- Die Rolle des politischen Wandels in Deutschland um 1930
- Die Vision eines neuen Menschen bei Gottfried Benn
- Die Annäherung und Distanzierung von Benns Züchtungsgedanken zum Nationalsozialismus
- Die Rezeption von Benns Züchtungsgedanken in der Öffentlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Zeitgeist 1900-1933
Dieses Kapitel stellt den historischen und literarischen Kontext dar, in dem Gottfried Benns Züchtungsgedanken entstanden sind. Es beleuchtet die prägenden Ereignisse der Zeit von 1900 bis 1933, insbesondere den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik und die Weltwirtschaftskrise. Das Kapitel zeigt außerdem auf, wie diese Ereignisse die Kunst und Literatur, insbesondere den Expressionismus, beeinflussten, und wie sich die Ideen des Ich-Zerfalls und der Sehnsucht nach Veränderung in Gottfried Benns Frühwerk manifestieren.
Zwischen Vision und Realität: Gottfried Benns Züchtungsgedanken
Dieses Kapitel analysiert die Entstehung und Entwicklung von Gottfried Benns Züchtungsgedanken. Es untersucht den Essay „Der Aufbau der Persönlichkeit“ und dessen Einfluss auf Benns spätere Züchtungsgedanken, sowie die Rolle der politischen Entwicklungen der 1930er Jahre für die Konzeptionierung eines neuen Menschen. Das Kapitel beleuchtet außerdem die Rezeption von Benns Züchtungsgedanken in der Öffentlichkeit.
Anlass für Gottfried Benns Züchtungsgedanken
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Ursachen und Impulsen für Benns Züchtungsgedanken. Es analysiert den Essay „Der Aufbau der Persönlichkeit“ und zeigt auf, wie Benns Sicht auf den Menschen als biologisches Wesen, seine Kritik an der bestehenden Gesellschaft und die politischen Ereignisse der Zeit um 1930 die Entstehung seiner Züchtungsgedanken beeinflussten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Gottfried Benns Züchtungsgedanken, biologische Sicht auf den Menschen, Der Aufbau der Persönlichkeit, Zeitgeist, Expressionismus, Nationalsozialismus, politische Veränderungen, Rezeption, Vision, Realität.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Gottfried Benn unter "Züchtungsgedanken"?
Benn entwickelte Visionen zur Schaffung eines "neuen Menschen", basierend auf einer biologischen Sichtweise der Persönlichkeit und des Geistes.
Wie verhielt sich Benn zum Nationalsozialismus?
Die Arbeit analysiert Benns Annäherung an nationalsozialistisches Gedankengut um 1933 und untersucht, inwieweit seine biologischen Theorien mit der NS-Ideologie konform gingen.
Was ist der Inhalt des Essays "Züchtung I"?
In diesem Essay stellt Benn seine Vision des neuen deutschen Menschen dem "alten Menschen" gegenüber und definiert die gewünschten Eigenschaften.
War Benns Vision Realität oder reine Dichtung?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen seinen dichterischen Visionen und deren versuchter oder gescheiterter Anwendung in der politischen Wirklichkeit.
Welchen Einfluss hatte der Zeitgeist von 1900 bis 1933 auf Benn?
Ereignisse wie der Erste Weltkrieg und der Expressionismus prägten Benns Ideen vom "Ich-Zerfall" und der Sehnsucht nach einer biologischen Erneuerung der Gesellschaft.
- Citation du texte
- Marie-Lyce Plaschka (Auteur), 2017, Zwischen Vision und Realität. Gottfried Benns Züchtungsgedanken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366550