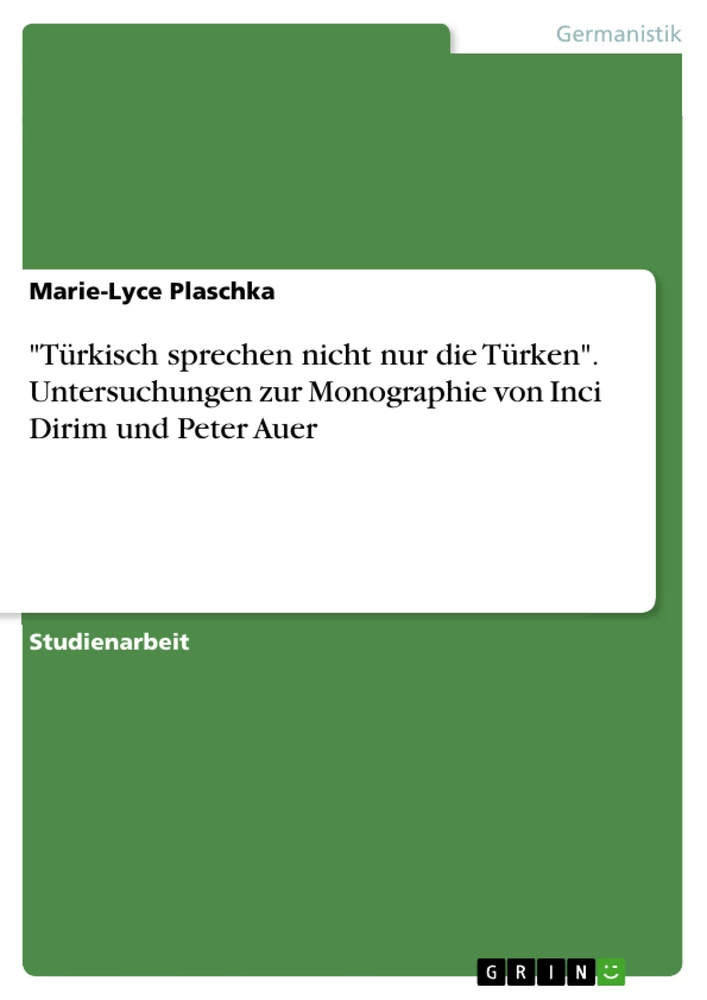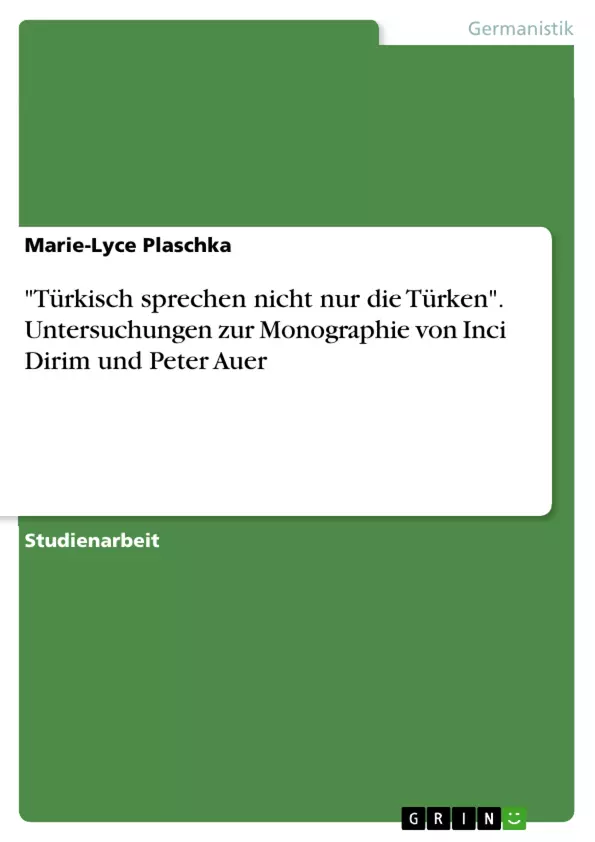Ziel der Arbeit ist es, die Untersuchung von Inci Dirim und Peter Auer im Rahmen ihres Buches „Türkisch sprechen nicht nur die Türken“ vorzustellen und gegebenenfalls Schwachstellen des Projekts aufzuzeigen. Die Arbeit beschäftigt sich im ersten Teil mit dem Untersuchungsgegenstand sowie den Methoden und Daten der Untersuchung. Im zweiten Teil sollen dann die Ergebnisse anhand von Beispielen dargestellt werden. Hierbei wird zunächst die Frage geklärt, warum sich die Jugendlichen die türkische Sprache angeeignet haben. Daraufhin soll gezeigt werden, wo die Informanten selbst die Anfänge ihres Türkischerwerbs sehen und wie gut sie türkisch sprechen. Zuletzt wird dann darauf eingegangen, wie die Probanden zwischen dem Deutschen und dem Türkischen in ihren Redebeiträgen wechseln und die beiden Sprachen grammatikalisch vermischen.
„Türkisch sprechen nicht nur die Türken.“ Wenn man diesen Satz liest, wird man im ersten Moment wahrscheinlich sagen „Ja, na klar!“, schließlich sprechen nicht nur die Deutschen deutsch oder die Engländer englisch. Aber welchen Grund haben nicht-türkische Jugendliche in Deutschland, diese Sprache zu erlernen? Genau mit diesem Phänomen haben sich Inci Dirim und Peter Auer in ihrer Monographie auseinandergesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Monographie „Türkisch sprechen nicht nur die Türken“
- 2.1. Untersuchungsgegenstand
- 2.2. Methoden und Daten der Untersuchung
- 2.3. Ergebnisse
- 2.3.1. Acts of identity
- 2.3.1.1. Die Affilation mit den Türken
- 2.3.1.2. Die Orientierung an subkulturellen Modellen der großstädtischen Außenseiterkultur (dem „Ghetto“)
- 2.3.1.3. Die Orientierung an jugendkulturellen Szenen
- 2.3.2. Aussagen über den Beginn und den Verlauf des Türkischerwerbs
- 2.3.3. Der Gebrauch des Türkischen
- 2.3.3.1. Minimaler Gebrauch
- 2.3.3.2. Gemischter Gebrauch
- 2.3.3.3. Maximaler Gebrauch
- 2.3.4. Code-Switching und Code-Mixing
- 2.3.4.1. Teilnehmerbezogenes Code-Switching
- 2.3.4.2. Diskursfunktionales Code-Switching
- 2.3.4.3. Ad hoc-Transfers von Inhaltswörtern
- 2.3.4.4. Transfer von Diskursmarkern und Interjektionen
- 2.4. Kritik
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit präsentiert und analysiert die Monographie „Türkisch sprechen nicht nur die Türken“ von Inci Dirim und Peter Auer. Ziel ist es, den Untersuchungsgegenstand, die Methodik und die wichtigsten Ergebnisse der Studie darzustellen und kritisch zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Erforschung des Türkischerwerbs bei nicht-türkischstämmigen Jugendlichen in Hamburg und den damit verbundenen sprachlichen Praktiken.
- Türkischerwerb bei nicht-türkischstämmigen Jugendlichen
- Soziolinguistische Faktoren des Spracherwerbs
- Code-Switching und Code-Mixing im Kontext des Türkischen und Deutschen
- Identitätskonstruktion durch Sprache
- Methodische Ansätze der empirischen Sprachforschung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Monographie „Türkisch sprechen nicht nur die Türken“ ein und stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für den Türkischerwerb bei nicht-türkischstämmigen Jugendlichen in Deutschland in den Mittelpunkt. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und legt den Fokus auf die Darstellung der Untersuchung, ihrer Ergebnisse und einer kritischen Auseinandersetzung.
2. Die Monographie „Türkisch sprechen nicht nur die Türken“: Dieses Kapitel beschreibt ausführlich die Monographie von Dirim und Auer. Es erläutert den Untersuchungsgegenstand, der die Erforschung des Status und der Verwendung des Türkischen in gemischt-ethnischen Jugendgruppen zum Ziel hatte, besonders unter dem Aspekt der Türkischkenntnisse und des Sprachgebrauchs bei Jugendlichen mit nicht-türkischem Familienhintergrund. Der methodische Ansatz, basierend auf längsschnittlichen Beobachtungen und Interviews mit 25 Jugendlichen in Hamburg, wird detailliert dargelegt. Die soziale Zusammensetzung der Stichprobe wird ebenfalls präsentiert. Die Bedeutung der Auswahl des Untersuchungsortes Hamburg mit seiner hohen Dichte an türkischen Migranten wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Türkischerwerb, Code-Switching, Code-Mixing, Jugendsprache, Soziolinguistik, Mehrsprachigkeit, Identitätskonstruktion, Ethnographie, empirische Sprachforschung, nicht-türkischstämmige Jugendliche, Hamburg.
Häufig gestellte Fragen zu „Türkisch sprechen nicht nur die Türken“
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit präsentiert und analysiert die Monographie „Türkisch sprechen nicht nur die Türken“ von Inci Dirim und Peter Auer. Sie beschreibt den Untersuchungsgegenstand, die Methodik und die wichtigsten Ergebnisse der Studie und bewertet diese kritisch.
Worauf konzentriert sich die Analyse der Monographie?
Der Fokus liegt auf der Erforschung des Türkischerwerbs bei nicht-türkischstämmigen Jugendlichen in Hamburg und den damit verbundenen sprachlichen Praktiken, insbesondere Code-Switching und Code-Mixing.
Welche Themen werden in der Monographie behandelt?
Die Monographie untersucht den Türkischerwerb bei nicht-türkischstämmigen Jugendlichen, soziolinguistische Faktoren des Spracherwerbs, Code-Switching und Code-Mixing im Kontext des Türkischen und Deutschen, Identitätskonstruktion durch Sprache und methodische Ansätze der empirischen Sprachforschung.
Welche Methoden wurden in der Monographie verwendet?
Die Studie von Dirim und Auer basiert auf längsschnittlichen Beobachtungen und Interviews mit 25 Jugendlichen in Hamburg. Die soziale Zusammensetzung der Stichprobe und die Auswahl Hamburgs als Untersuchungsort mit seiner hohen Dichte an türkischen Migranten werden detailliert erläutert.
Welche Ergebnisse werden in der Monographie präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen die Analyse von „Acts of Identity“ (Identitätshandlungen) der Jugendlichen, Aussagen über den Beginn und Verlauf des Türkischerwerbs, den Gebrauch des Türkischen (minimal, gemischt, maximal), sowie detaillierte Analysen von Code-Switching und Code-Mixing (teilnehmerbezogen, diskursfunktional, Ad-hoc-Transfers etc.).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur ausführlichen Darstellung der Monographie „Türkisch sprechen nicht nur die Türken“ (inkl. Untersuchungsgegenstand, Methodik, Ergebnissen und Kritik), und ein Fazit. Die Kapitelzusammenfassung bietet einen detaillierten Überblick über den Inhalt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Türkischerwerb, Code-Switching, Code-Mixing, Jugendsprache, Soziolinguistik, Mehrsprachigkeit, Identitätskonstruktion, Ethnographie, empirische Sprachforschung, nicht-türkischstämmige Jugendliche, Hamburg.
Was ist das Ziel der vorliegenden Arbeit?
Das Ziel ist die Darstellung und kritische Auseinandersetzung mit der Monographie „Türkisch sprechen nicht nur die Türken“, um den Untersuchungsgegenstand, die Methodik und die wichtigsten Ergebnisse zu präsentieren und zu beleuchten.
Welche Aspekte der Identitätskonstruktion werden behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie die Jugendlichen ihre Identität durch die Verwendung des Türkischen und die sprachlichen Praktiken (Code-Switching, Code-Mixing) konstruieren. Hierbei werden Aspekte der Affiliation mit den Türken, der Orientierung an subkulturellen Modellen und jugendkulturellen Szenen betrachtet.
- Arbeit zitieren
- Marie-Lyce Plaschka (Autor:in), 2015, "Türkisch sprechen nicht nur die Türken". Untersuchungen zur Monographie von Inci Dirim und Peter Auer, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366554