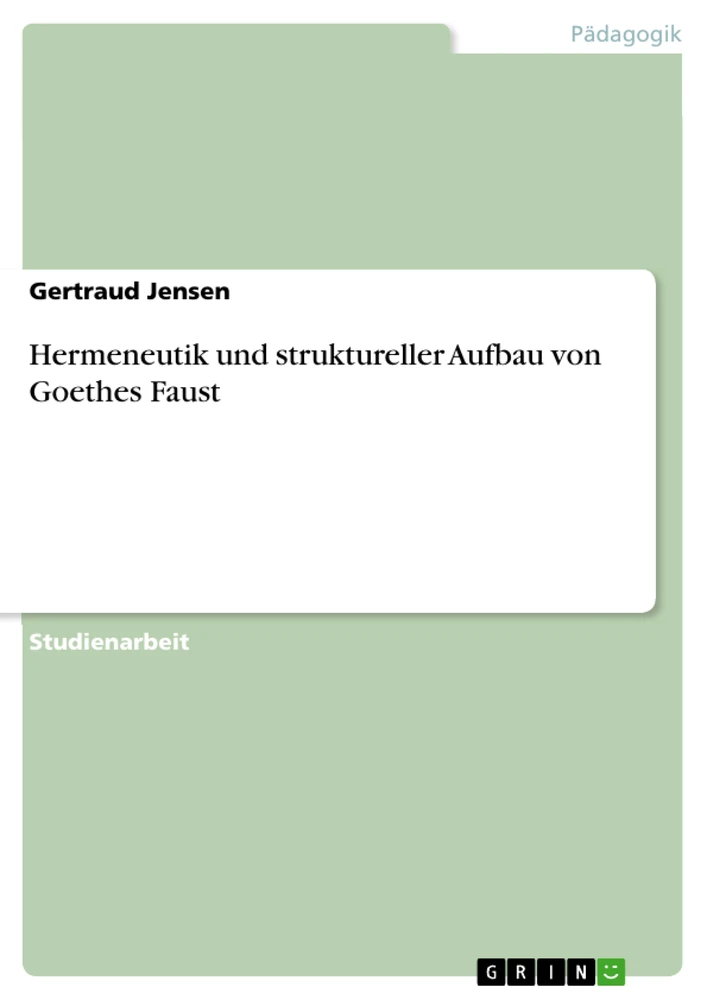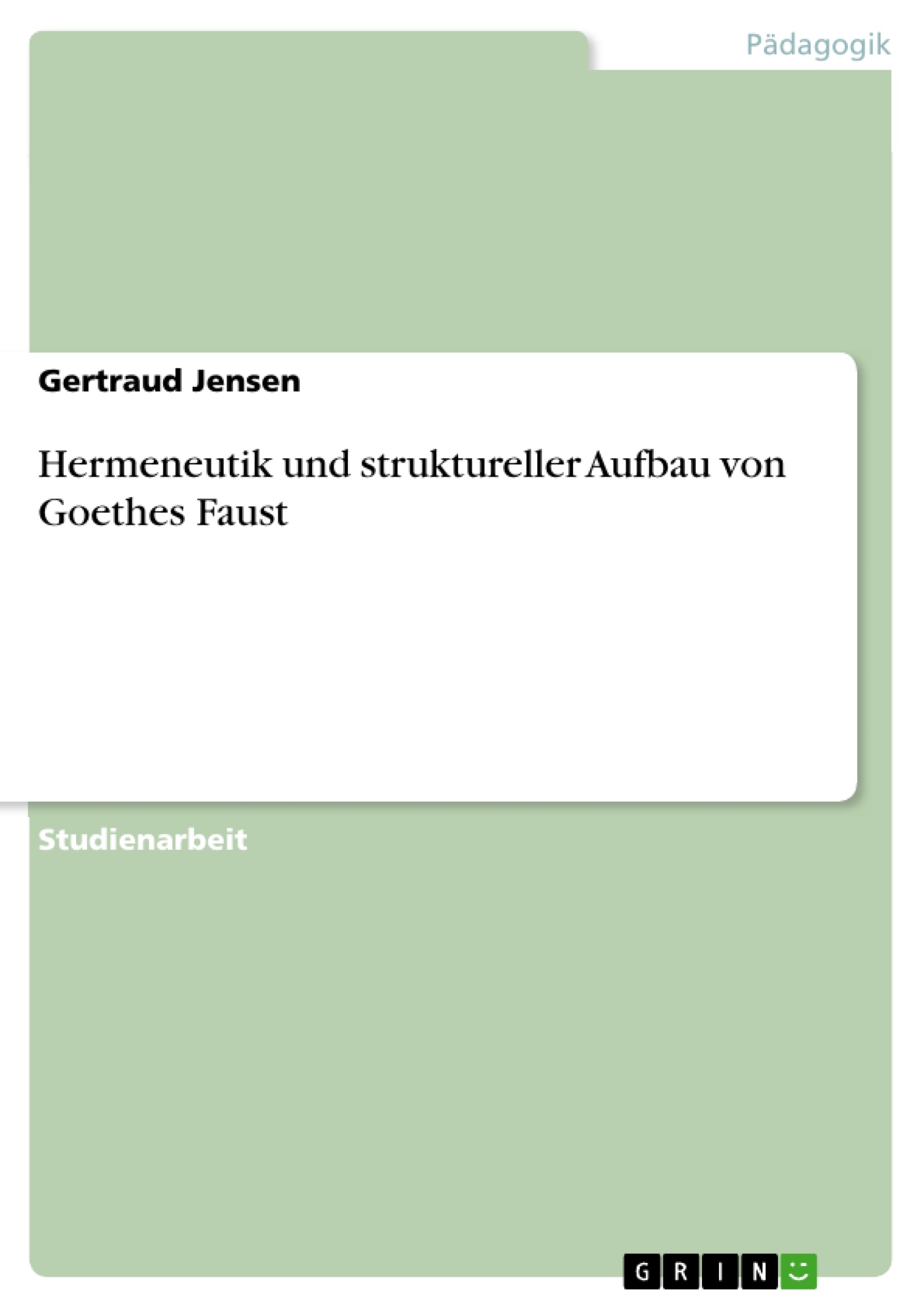Dieser Arbeit liegt das Drama Faust 1 von Johann Wolfgang von Goethe, zu Grunde. Dieses Werk ist eines der bekanntesten und meist zitiertesten Werke der Literatur. Die Fertigstellung des Gesamtwerkes dauerte über sechzig Jahre und dadurch kann man auch Spuren von mehreren literarischen Epochen erkennen. Der „Urfaust“ wurde in der „Sturm und Drang“ Zeit geschrieben, „Faust – Der Tragödie erster Teil“ ist von der Epoche der Klassik geprägt. „Faust – Der Tragödie Zweite Teil“ fiel in die letzten Lebensjahre Goethes. Jedoch ist die Gestalt des Fausts nicht eine Erfindung von Goethe. Die Figur besaß bereits eine lange Tradition in der Literatur.
Ein wichtiger Teilaspekt von Goethes Faust ist die „Gretchentragödie“, welche sich durch eine ansteigende Handlungskurve, wo Faust Margarete begehrt, zu einem Höhepunkt und gleichzeitigen Wendepunkt, die Hingabe Margaretes zu Faust, erstreckt und dann durch eine fallende Handlungskurve mit Margaretes Ende in der Kerkerszene ihren Schluss findet. Auf den ersten Blick hin, scheint es, dass die „Gretchentragödie“ einen linearen und kontinuierlichen Handlungsverlauf aufweist, welches ein Merkmal für eine geschlossene Dramenform wäre. Die Figur der bürgerlichen Margarete macht eine vielfältige Wandlung durch und der gelehrte Wissenschaftler, Faust, hat viele innere Kämpfe mit sich zu fechten. Man erkennt sehr unterschiedliche Menschenbilder in diesen zwei Figuren, welche mit typischen Tugend- und Moralvorstellungen ihrer repräsentierenden Schicht zu kämpfen haben. Die beschriebene herzergreifende Gefühlswelt der „bürgerlichen Heldin“ – Margarete – ist es, welches Mitgefühl bei den Lesern
weckt. Daran kann man auch die Züge eines bürgerlichen Trauerspiels erkennen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Leseanleitung
- Methode
- Theorie
- Drama
- Das geschlossene Drama
- Das offene Drama
- Das bürgerliche Trauerspiel
- Drama
- Analyse
- Gretchentragödie
- Vergleich der zwei Figuren: Faust und Margarete
- Charakterisierung der Figur: Margarete
- Charakterisierung der Figur: Faust
- Menschenbilder in Faust und Margarete
- Züge des bürgerlichen Trauerspiels in „Faust 1“
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse der „Gretchentragödie“ im Kontext von Goethes „Faust 1“. Ziel ist es, die Dramenform der Gretchentragödie zu untersuchen, das Werk auf Züge des bürgerlichen Trauerspiels hin zu analysieren und die beiden Figuren Faust und Margarete im Hinblick auf ihre Menschlichkeit und die in ihnen reflektierten Gesellschaftsbilder zu betrachten.
- Einstufung der „Gretchentragödie“ als geschlossenes oder offenes Drama
- Analyse von „Faust 1“ auf Elemente des bürgerlichen Trauerspiels
- Vergleich der Figuren Faust und Margarete hinsichtlich ihrer Charakteristik
- Identifizierung von Menschenbildern in Faust und Margarete
- Bedeutung der Gretchentragödie im Gesamtwerk von Goethe
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Werk „Faust 1“ und die darin enthaltene „Gretchentragödie“ vor. Die Arbeit fokussiert sich auf die Untersuchung dieser Dramenform im Kontext von Goethes Gesamtwerk. Die Einleitung erwähnt die Entstehungszeit von „Faust 1“ und bezieht sich auf die verschiedenen literarischen Epochen, die in dem Werk spürbar sind. Die Einleitung beleuchtet zudem die Bedeutung der Gretchentragödie als wichtiges Element des Gesamtwerks.
- Problemstellung: Hier werden die zentralen Fragen der Analyse formuliert. Die Problemstellung untersucht, ob die Gretchentragödie als geschlossenes oder offenes Drama zu klassifizieren ist, inwieweit „Faust 1“ Züge eines bürgerlichen Trauerspiels aufweist und in welchen Punkten sich die Figuren Faust und Margarete unterscheiden. Dabei steht die Frage nach den durch diese Figuren reflektierten Menschenbildern im Mittelpunkt.
- Leseanleitung: Dieser Abschnitt erklärt die Herangehensweise an die Analyse. Er beschreibt die einzelnen Schritte der Untersuchung und die gewählte Methode, die hermeneutische Methode. Die Leseanleitung liefert eine Übersicht über die behandelten Themen in den einzelnen Kapiteln und vermittelt den Leserinnen und Lesern einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
- Methode: In diesem Kapitel wird die hermeneutische Methode als Analysemethode vorgestellt. Es werden die Grundzüge der Hermeneutik erläutert und die Gründe für die Wahl dieser Methode in diesem Zusammenhang begründet. Der hermeneutische Zirkel und seine Funktionsweise im Rahmen der Textinterpretation werden erläutert.
- Theorie: Die Theoriekapitel beleuchten die Dramentheorie und das bürgerliche Trauerspiel. Dabei werden die verschiedenen Formen des Dramas, die Entstehung und typische Merkmale des bürgerlichen Trauerspiels sowie die Unterschiede zwischen geschlossenem und offenem Drama thematisiert. Der Abschnitt beleuchtet die Bedeutung des Dramas in der Geschichte der Literatur und die Entstehung des bürgerlichen Trauerspiels als Gegenentwurf zum Hofdrama.
- Analyse: Die Analysekapitel befassen sich mit der Gretchentragödie als Dramenform und ihrer Einordnung in die Theorie des geschlossenen Dramas. Sie analysieren die Figuren Faust und Margarete hinsichtlich ihrer Charakteristik, ihrer Rolle in der Geschichte und ihrer symbolischen Bedeutung. Die Analyse untersucht auch die Bedeutung von „Faust 1“ als Beispiel für das bürgerliche Trauerspiel.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Werk „Faust 1“ von Johann Wolfgang von Goethe und analysiert die „Gretchentragödie“ im Kontext des bürgerlichen Trauerspiels. Schlüsselthemen sind Dramenform, geschlossenes Drama, offenes Drama, Charakterisierung, Menschenbild, Gretchentragödie, bürgerliches Trauerspiel, hermeneutische Methode. Die Arbeit untersucht die Bedeutung der „Gretchentragödie“ für das Gesamtwerk von Goethe und beleuchtet die wichtigen sozialen und kulturellen Aspekte des Zeitalters.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Gretchentragödie in Goethes Faust?
Ein zentraler Teilaspekt von Faust 1, der die Geschichte von Margaretes Begehren, Hingabe und tragischem Ende im Kerker beschreibt.
Welche Merkmale eines bürgerlichen Trauerspiels finden sich in Faust 1?
Die Figur der bürgerlichen Margarete, ihre moralischen Konflikte und die herzergreifende Gefühlswelt wecken Mitgefühl, was typisch für dieses Genre ist.
Was ist der Unterschied zwischen Faust und Margarete?
Faust ist ein gelehrter Wissenschaftler mit inneren Kämpfen, während Margarete als bürgerliche Heldin mit den Moralvorstellungen ihrer Schicht ringt.
Ist die Gretchentragödie ein geschlossenes Drama?
Auf den ersten Blick wirkt sie linear und kontinuierlich, was für eine geschlossene Form spricht, doch die Arbeit untersucht dies kritisch im Kontext offener Formen.
Welche Rolle spielt die Hermeneutik in dieser Arbeit?
Die hermeneutische Methode wird genutzt, um den Text tiefgreifend zu interpretieren und die darin enthaltenen Menschenbilder zu verstehen.
- Quote paper
- Gertraud Jensen (Author), 2015, Hermeneutik und struktureller Aufbau von Goethes Faust, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366634