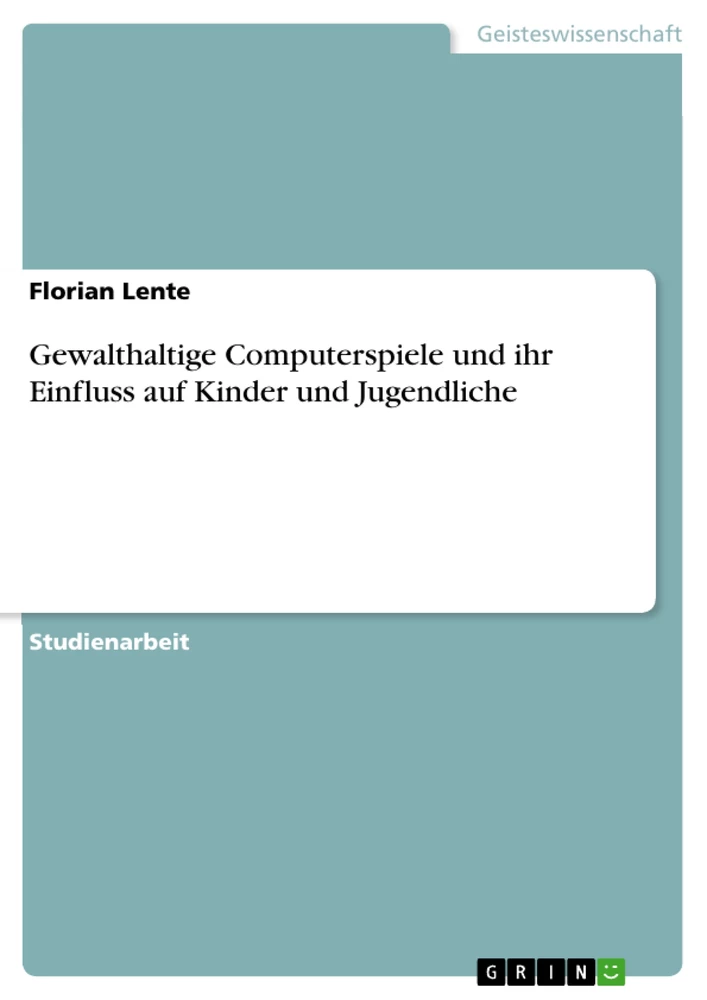Der CDU-Politiker und Bundesinnenminister Thomas de Maizière forderte im Juli 2016 nach dem Terroranschlag in München eine stärkere Debatte über Killerspiele. Er betont, dass das "unerträgliche Ausmaß von gewaltverherrlichenden Spielen im Internet auch eine schädliche Wirkung auf die Entwicklung von Jugendlichen hat. Das kann kein vernünftiger Mensch bestreiten" (Süddeutsche Zeitung).
Mit diesem Statement rief Thomas de Maizière die Diskussion um den Zusammenhang von Videospielen und Gewalt erneut ins Leben zurück. Zunächst stand die Forderung eines Verbots von Killerspielen in den Nullerjahren seitens der CDU/CSU im Raum und schaffte es in den Koalitionsvertrag 2005. Zum Ende des Jahrzehnts ebbte die Diskussion ohne rechtliche Veränderung wieder ab.
Zurück bleib lediglich die Novelle des Jugendschutzgesetztes aus dem Jahr 2003, welches auf der Annahme beruht, dass das Spielen gewalthaltiger Computerspiele Auswirkungen auf das alltägliche Leben habe und es somit eine Übertragung von erlernten Verhaltensmustern aus dem virtuellen in den realen Raum gäbe. Jedoch stellt sich hier die Frage, ob diese Annahme empirisch fundiert ist. Anregt durch das polarisierende Thema in den Massenmedien untersuchen Forscher seit Mitte der 90’er Jahre den Zusammenhang zwischen gewalthaltigen Computerspielen und Gewaltexzessen wie beispielsweise Amokläufen.
In der vorliegenden Hausarbeit wird dieser grundlegenden Frage nachgegangen und aktuelle Wissensbestände miteinander verglichen. Des Weiteren wird ein Blick auf die mediale Berichterstattung, sowie die Rolle des Jugendschutzes und der Sozialen Arbeit geworfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2 Grundlage: Begriffsdefinitionen
- 2.1 Gewaltbegriff
- 2.2 Aggressionsbegriff
- 2.3 Computer- und Videospiele
- 2.3.1 Statistische Angaben zur Mediennutzung
- 2.3.2 Vorstellung von Battlefield 1 und Hatred
- 3 Öffentliche Gewaltwahrnehmung
- 3.1 Rolle des Jugendschutzes
- 3.2 Amokläufe, öffentliche Diskussion und Medienberichterstattung
- 4 Theorien zur Computerspielgewalt
- 4.1 Anlass und Motivation
- 4.2 Reale und virtuelle Gewalt im Vergleich
- 4.3 Katharsisthese
- 4.4 Suggestionsthese
- 4.5 Habitualisierungs- bzw. Desensibilisierungsthese
- 5 Rolle der Sozialen Arbeit
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern Computerspiele einen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben. Dazu werden verschiedene wissenschaftliche Theorien, die den Zusammenhang zwischen Gewalt in Computerspielen und realer Gewalt untersuchen, beleuchtet. Zudem wird die Rolle des Jugendschutzes, die öffentliche Diskussion und die mediale Berichterstattung im Kontext dieser Thematik betrachtet.
- Zusammenhang zwischen Computerspielgewalt und realer Gewalt
- Einfluss von Computerspielen auf Kinder und Jugendliche
- Rolle des Jugendschutzes und der Sozialen Arbeit
- Öffentliche Diskussion und mediale Berichterstattung
- Wissenschaftliche Theorien zur Computerspielgewalt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die aktuelle Diskussion um den Zusammenhang zwischen Videospielen und Gewalt vor, die durch Aussagen von Politikern wie Thomas de Maizière wiederbelebt wurde. Die Hausarbeit analysiert die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dieser Thematik und betrachtet die Rolle des Jugendschutzes sowie die mediale Berichterstattung.
2 Grundlage: Begriffsdefinitionen
Dieser Abschnitt definiert die Begriffe Gewalt und Aggression und erläutert die unterschiedlichen Ansätze, die in der wissenschaftlichen Literatur vertreten werden. Des Weiteren werden Computer- und Videospiele als Medium vorgestellt und statistische Daten zur Mediennutzung in Deutschland dargestellt.
3 Öffentliche Gewaltwahrnehmung
Dieses Kapitel untersucht die Rolle des Jugendschutzes in Bezug auf Computerspiele und die öffentliche Diskussion um Amokläufe, die oft mit gewalttätigen Computerspielen in Verbindung gebracht werden. Der Fokus liegt auf der medialen Berichterstattung und der Frage, wie diese die öffentliche Wahrnehmung von Computerspielgewalt beeinflusst.
4 Theorien zur Computerspielgewalt
In diesem Kapitel werden verschiedene Theorien zur Computerspielgewalt vorgestellt und miteinander verglichen. Dabei werden die Motive und Anlässe von gewalttätigem Verhalten in Computerspielen beleuchtet, sowie die Beziehung zwischen realer und virtueller Gewalt diskutiert. Theorien wie die Katharsisthese, die Suggestionsthese und die Habitualisierungs- bzw. Desensibilisierungsthese werden vorgestellt und kritisch betrachtet.
5 Rolle der Sozialen Arbeit
Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext von Computerspielgewalt. Hierbei werden Möglichkeiten und Herausforderungen der Sozialen Arbeit im Umgang mit Kindern und Jugendlichen beleuchtet, die mit gewalthaltigen Computerspielen konfrontiert sind.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Computerspielgewalt, Jugendschutz, Mediennutzung, Aggression, Katharsisthese, Suggestionsthese, Desensibilisierung, Amokläufe, öffentliche Diskussion und Medienberichterstattung. Diese Begriffe bilden den Schwerpunkt der Untersuchung und werden in verschiedenen Kontexten beleuchtet, um die komplexe Thematik des Zusammenhangs zwischen Computerspielen und Gewalt zu erforschen.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es einen bewiesenen Zusammenhang zwischen „Killerspielen“ und Gewalt?
Die Arbeit untersucht verschiedene wissenschaftliche Theorien; eine eindeutige empirische Fundierung für reale Gewalt durch Spiele ist jedoch umstritten.
Was besagt die Katharsisthese?
Diese These nimmt an, dass das Ausleben von virtueller Gewalt zu einem Abbau von realen Aggressionen führt (Reinigungseffekt).
Was ist die Habitualisierungsthese?
Sie besagt, dass der häufige Konsum von Gewalt zu einer Desensibilisierung und Abstumpfung gegenüber realer Gewalt führen kann.
Welche Rolle spielt der Jugendschutz bei Computerspielen?
Der Jugendschutz (z.B. USK) soll verhindern, dass Kinder und Jugendliche mit Inhalten konfrontiert werden, die ihre Entwicklung beeinträchtigen könnten.
Wie beeinflussen Medienberichte die öffentliche Wahrnehmung?
Oft werden Amokläufe in den Medien vorschnell mit Computerspielen verknüpft, was die politische Debatte über Verbote befeuert.
- Quote paper
- Florian Lente (Author), 2017, Gewalthaltige Computerspiele und ihr Einfluss auf Kinder und Jugendliche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366800