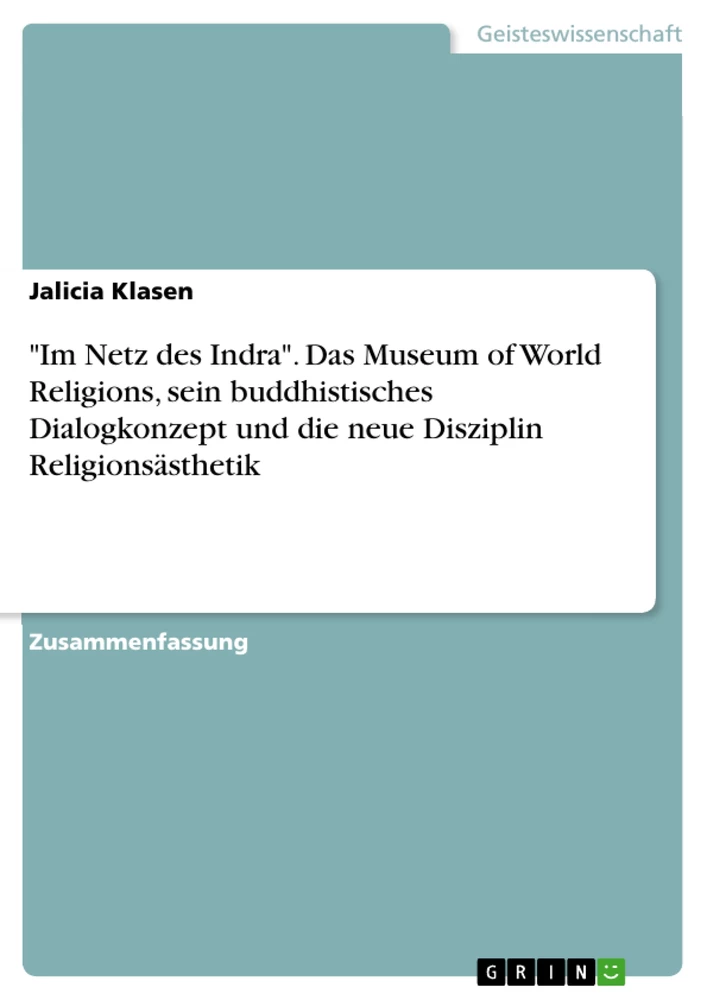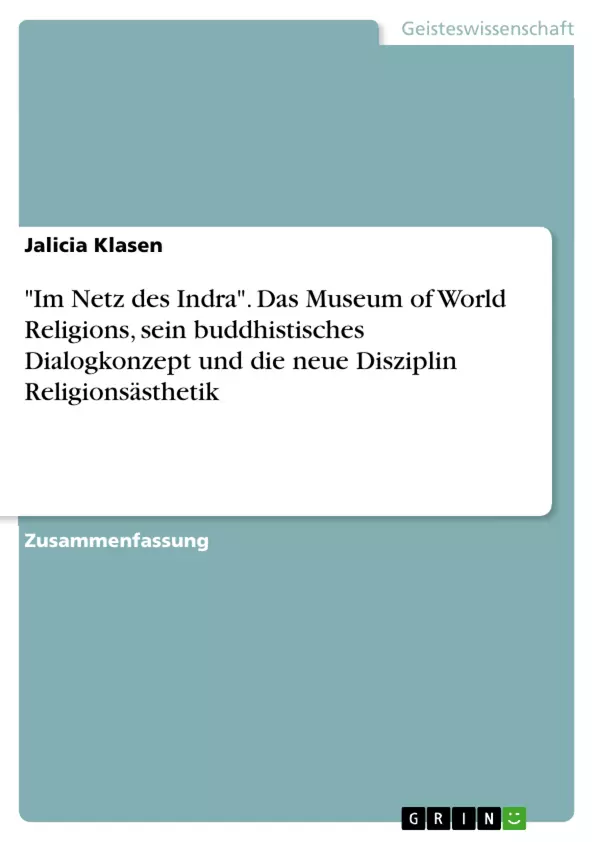Der vorliegende Auszug des wissenschaftlichen Textes aus „Im Netz des Indra“ von Annette Wilke und Esther Maria Guggenmos, aus dem siebten Band der Veröffentlichungen des Centrums für Religiöse Studien Münster, befasst sich unter anderem mit der neuen Disziplin der Religionsästhetik.
Der Untertitel „Das Museum of World Religions, sein buddhistisches Dialogkonzept und die neue Disziplin Religionsästhetik“ und der Begriff des „Indra“, verweisen auf die Auseinandersetzung mit der vedischen und somit der ältesten nachweisbaren Religion Indiens.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Museum of World Religion
- Die Religionsästhetik als neues Forschungsfeld
- Der Cultural Turn
- Der Iconic Turn
- Das Verhältnis von Religionsästhetik und Religionssemiotik
- Analyse des Museums
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert die neue Disziplin der Religionsästhetik anhand des Museum of World Religions in Taipeh und dessen buddhistisches Dialogkonzept. Ziel ist es, die Entstehung und die zentralen Fragestellungen der Religionsästhetik zu beleuchten und deren Bedeutung für die Religionswissenschaft zu verdeutlichen.
- Entstehung und Entwicklung der Religionsästhetik als Forschungsfeld
- Der Einfluss des Cultural Turn und des Iconic Turn auf die Religionsästhetik
- Das Verhältnis zwischen Religionsästhetik und Religionssemiotik
- Die Rolle von Wahrnehmung und Erfahrung im Kontext religiöser Ästhetik
- Analyse des Museum of World Religions als Beispiel für postmoderne Religionsformen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Der Text gibt eine Einführung in das Thema Religionsästhetik und kündigt die Analyse des Museum of World Religions als Fallbeispiel an. Er verortet die Arbeit im Kontext des Buches „Im Netz des Indra“ und beschreibt den Fokus auf die vedische Religion. Die Einleitung stellt den Kontext und die zentrale Fragestellung der folgenden Analyse dar.
2. Museum of World Religion: Dieses Kapitel präsentiert das Museum of World Religions und dessen buddhistisches Dialogkonzept. Es beginnt mit einem Grußwort des CEO, das die Ziele des Museums – insbesondere die Erreichung der absoluten Freiheit des Lebens – hervorhebt. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Museumsraums als „Erlebnisraum“, der eine zentrale Rolle in der folgenden Auseinandersetzung mit der Religionsästhetik spielt. Die Beschreibung des Raumes legt den Grundstein für die spätere Analyse der ästhetischen und sinnlichen Erfahrung im religiösen Kontext.
3. Die Religionsästhetik als neues Forschungsfeld: Dieses Kapitel befasst sich mit der Religionsästhetik als akademische Disziplin. Es untersucht deren Fragestellungen, Methoden und Erkenntnisinteressen, wobei der Schwerpunkt auf der Neuheit dieses Ansatzes liegt. Es werden die „kulturalistische Wende“ und der „iconic turn“ als wichtige Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Religionsästhetik analysiert, die den Fokus von rein textbasierten Ansätzen hin zu einer Berücksichtigung von Sinnlichkeit, Körperlichkeit und Materialität erweitert haben. Die Diskussion verschiedener Wissenschaftler und ihrer Beiträge zu diesem Feld unterstreicht die Vielschichtigkeit und den interdisziplinären Charakter der Religionsästhetik.
4. Das Verhältnis von Religionsästhetik und Religionssemiotik: Dieses Kapitel erörtert die Beziehung zwischen Religionsästhetik und Religionssemiotik, also zwischen der Analyse von Wahrnehmungssystemen und der Analyse von Zeichen- und Kommunikationssystemen. Es diskutiert unterschiedliche Perspektiven auf deren Verbindung und Differenz. Die Religionsästhetik wird als integrierender Oberbegriff positioniert, der verschiedene Dimensionen religiöser Kommunikation umfasst. Die Fähigkeit der Religionsästhetik, die Kluft zwischen Religionsphänomenologie und Kulturwissenschaft zu überbrücken und die Vielschichtigkeit religiöser Kommunikation transparent zu machen, wird hervorgehoben. Die Analyse des Museums of World Religions dient als Beispiel für die Anwendung der Religionsästhetik auf moderne, postmoderne religiöse Formen.
5. Analyse des Museums: Dieses Kapitel beschreibt das Museum of World Religions als ein „Wahrnehmungspanorama“, das durch seine Gestaltung und Inszenierung bestimmte Gefühle und Stimmungen beim Besucher auslöst. Die Analyse betont die Rolle kultureller und sozialer Vorkenntnisse des Betrachters bei der Wahrnehmung und Interpretation religiöser Ästhetik. Das Kapitel verdeutlicht, wie die Religionsästhetik die Interaktion zwischen dem Individuum und dem religiösen Objekt im kulturellen Kontext versteht. Die Bedeutung der inneren Wahrnehmung (Erinnerungen, Fantasien, Halluzinationen) für das Verständnis religiöser Erfahrung wird betont.
Schlüsselwörter
Religionsästhetik, Museum of World Religions, Cultural Turn, Iconic Turn, Religionssemiotik, Wahrnehmung, Erfahrung, Sinnlichkeit, postmoderne Religionsformen, buddhistisches Dialogkonzept, vedische Religion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Religionsästhetik anhand des Museum of World Religions
Was ist der Gegenstand dieser Textanalyse?
Die Analyse untersucht die neue Disziplin der Religionsästhetik anhand des Museum of World Religions in Taipeh und dessen buddhistisches Dialogkonzept. Sie beleuchtet die Entstehung und zentralen Fragestellungen der Religionsästhetik und deren Bedeutung für die Religionswissenschaft.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Entstehung und Entwicklung der Religionsästhetik als Forschungsfeld, den Einfluss des Cultural Turn und des Iconic Turn, das Verhältnis zwischen Religionsästhetik und Religionssemiotik, die Rolle von Wahrnehmung und Erfahrung im Kontext religiöser Ästhetik sowie eine Analyse des Museum of World Religions als Beispiel für postmoderne Religionsformen. Ein besonderer Fokus liegt auf der vedischen Religion im Kontext des Buches „Im Netz des Indra“.
Welche Kapitel umfasst die Analyse?
Die Analyse gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Museum of World Religions, ein Kapitel zur Religionsästhetik als neues Forschungsfeld, ein Kapitel zum Verhältnis von Religionsästhetik und Religionssemiotik, eine Analyse des Museums selbst und ein Fazit. Jedes Kapitel wird im Text zusammengefasst.
Wie wird das Museum of World Religions in der Analyse behandelt?
Das Museum wird als „Erlebnisraum“ beschrieben und als Beispiel für postmoderne Religionsformen analysiert. Die Analyse konzentriert sich auf die Gestaltung und Inszenierung des Museums und deren Wirkung auf den Besucher, unter Berücksichtigung kultureller und sozialer Vorkenntnisse. Die Bedeutung der inneren Wahrnehmung (Erinnerungen, Fantasien, Halluzinationen) für das Verständnis religiöser Erfahrung wird ebenfalls hervorgehoben.
Welche Rolle spielen der Cultural Turn und der Iconic Turn?
Der Cultural Turn und der Iconic Turn werden als wichtige Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Religionsästhetik betrachtet. Sie haben den Fokus von rein textbasierten Ansätzen hin zu einer Berücksichtigung von Sinnlichkeit, Körperlichkeit und Materialität erweitert.
Wie wird das Verhältnis von Religionsästhetik und Religionssemiotik dargestellt?
Der Text erörtert die Beziehung zwischen der Analyse von Wahrnehmungssystemen (Religionsästhetik) und der Analyse von Zeichen- und Kommunikationssystemen (Religionssemiotik). Die Religionsästhetik wird als integrierender Oberbegriff positioniert, der verschiedene Dimensionen religiöser Kommunikation umfasst und die Kluft zwischen Religionsphänomenologie und Kulturwissenschaft überbrücken kann.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Religionsästhetik, Museum of World Religions, Cultural Turn, Iconic Turn, Religionssemiotik, Wahrnehmung, Erfahrung, Sinnlichkeit, postmoderne Religionsformen, buddhistisches Dialogkonzept, vedische Religion.
Welches ist die zentrale Fragestellung der Analyse?
Die zentrale Fragestellung ist die Beleuchtung der Entstehung und der zentralen Fragestellungen der Religionsästhetik und deren Bedeutung für die Religionswissenschaft, anhand des Fallbeispiels des Museum of World Religions und seines buddhistischen Dialogkonzepts.
- Arbeit zitieren
- Jalicia Klasen (Autor:in), 2016, "Im Netz des Indra". Das Museum of World Religions, sein buddhistisches Dialogkonzept und die neue Disziplin Religionsästhetik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366804