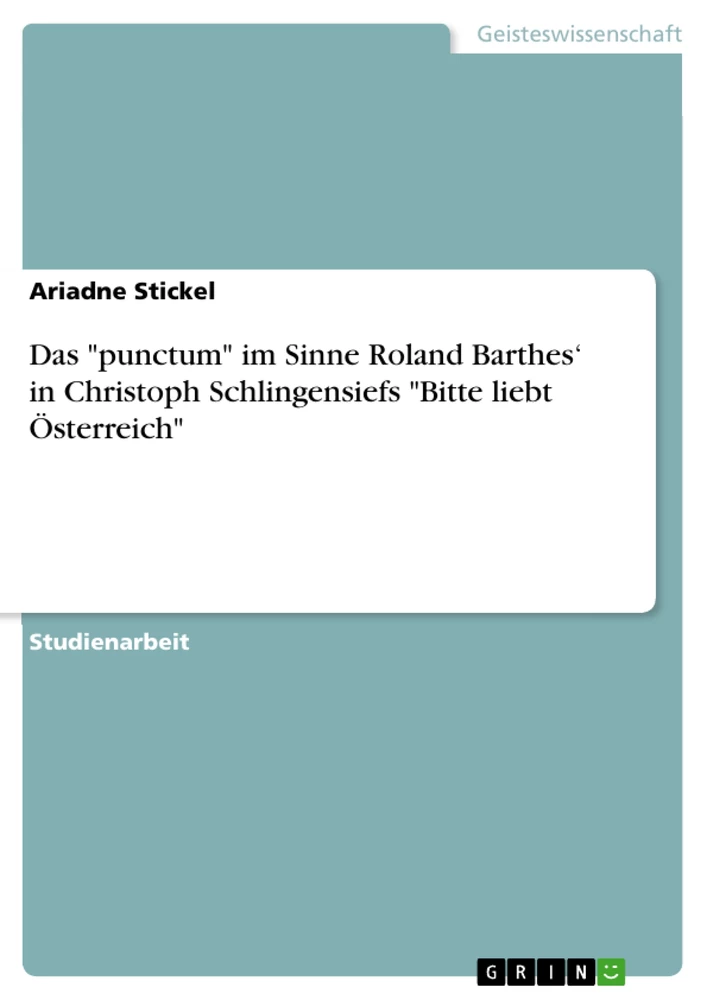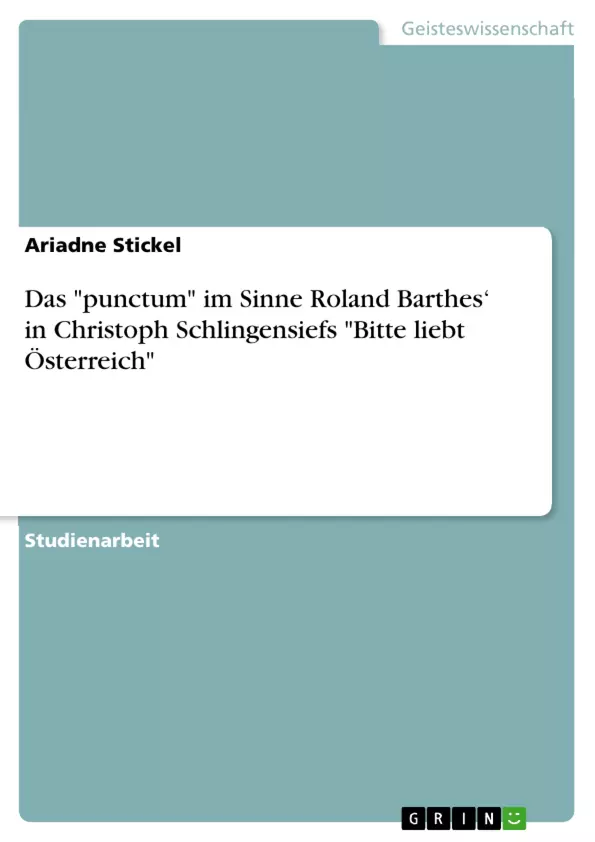Die Arbeiten keines anderen Aktionskünstlers, Schauspielers, Theater- beziehungsweise Filmemachers erfordern im Rahmen ihrer Auseinandersetzung beim Sammeln und Orientieren von Gedanken und Gefühlen eine ähnliche Anstrengung, wie die von Christoph Schlingensief. Und wenige sind reizvoller. Die Beschäftigung mit seinen Projekten oder das Rezipieren seiner Filme ruft nicht selten ungreifbare Empfindungen hervor und auf vermeintliche Erkenntnisse folgt häufig schon die nächste Frage.
Presse, Politiker, Passanten und Zuschauer zeigen sich begeistert, fasziniert, angeekelt, empört, verständnislos, nie aber gleichgültig. Wie kommt es zu dieser Betroffenheit, der Lust, der Wut, dem Schmerz, mit denen sich viele Menschen im Rahmen der Arbeiten konfrontiert sehen? Dass es Schlingensief nie schlicht um Provokation ging, wie von Kritikern gerne konstatiert und vorgeworfen, dürfte jedem, der sich ernsthaft mit seiner Arbeit auseinandersetzt, bald klar werden.
Franziska Schößler greift in einem ihrer Texte den von Roland Barthes entwickelten Begriff des punctums auf, um Elemente der Störbilder in Schlingensiefs Aktionen zu beschreiben, ohne weiter im Detail darauf einzugehen. Das punctum im Sinne Roland Barthes‘ mit den Arbeiten von Christoph Schlingensief in Zusammenhang zu bringen erscheint mir zunächst äußerst passend. Im Folgenden soll dieser Impuls aufgegriffen und vertieft werden. Wo und inwiefern kann bei näherer Betrachtung in den Arbeiten Schlingensiefs von einem solchen punctum die Rede sein? Lassen sich Barthes‘ Gedanken zur Fotografie überhaupt auf Aktionen von Schlingensief übertragen und anwenden?
Zunächst sollen in aller Kürze für das Verständnis hilfreiche Grundbegriffe der Fotografie bei Roland Barthes geklärt und das punctum genauer betrachtet werden. Anschließend werde ich näher auf die mir für die Fragestellung relevant erscheinende Aktion „Bitte liebt Österreich“ eingehen und diese dezidiert auf das Auftreten eines punctums im Sinne Barthes‘ untersuchen. Abschließend werden gewonnene Erkenntnisse in einem Fazit zusammengetragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundbegriffe der Fotografie bei Roland Barthes
- Das studium
- Das punctum
- Christoph Schlingensiefs „Bitte liebt Österreich“
- Das punctum und die Aktion
- Die Produktion widersprüchlicher Bilder in „Bitte liebt Österreich“
- Reaktionen der Zuschauer und Passanten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit widmet sich der Frage, wie das Konzept des punctums nach Roland Barthes in Christoph Schlingensiefs Aktionskunst angewendet werden kann. Ziel ist es, den Einfluss des punctums auf die Rezeption von Schlingensiefs Arbeiten, insbesondere „Bitte liebt Österreich“, zu untersuchen.
- Das punctum als stören des studiums in der Fotografie
- Die Anwendung des punctums auf die Aktionskunst Schlingensiefs
- Die Wirkung des punctums auf die Betrachter von Schlingensiefs Aktionen
- Die Rezeption von Schlingensiefs Werken im Kontext des punctums
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt den Aktionskünstler Christoph Schlingensief sowie dessen Werk „Bitte liebt Österreich“ vor. Sie stellt die Relevanz des punctums im Kontext der Rezeption von Schlingensiefs Arbeiten in Frage.
Kapitel 2 behandelt die Grundbegriffe der Fotografie bei Roland Barthes, insbesondere das studium und das punctum. Dabei wird die Funktion des punctums als stören des studiums und dessen Einfluss auf die Rezeption von Fotografien erläutert.
Kapitel 3 beschreibt die Aktionskunst „Bitte liebt Österreich“ von Christoph Schlingensief. Es wird auf die Entstehung und Durchführung der Aktion sowie auf die darin enthaltenen Elemente eingegangen, die für die Analyse des punctums relevant sind.
Kapitel 4 analysiert die Produktion widersprüchlicher Bilder in Schlingensiefs Aktion „Bitte liebt Österreich“ und beleuchtet die Reaktionen der Zuschauer und Passanten auf diese Bilder.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe punctum, studium, Fotografie, Aktionskunst, Christoph Schlingensief, „Bitte liebt Österreich“, Rezeption, Betrachter, Wirkung, Analyse, Interpretation.
- Citar trabajo
- Ariadne Stickel (Autor), 2015, Das "punctum" im Sinne Roland Barthes‘ in Christoph Schlingensiefs "Bitte liebt Österreich", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366896