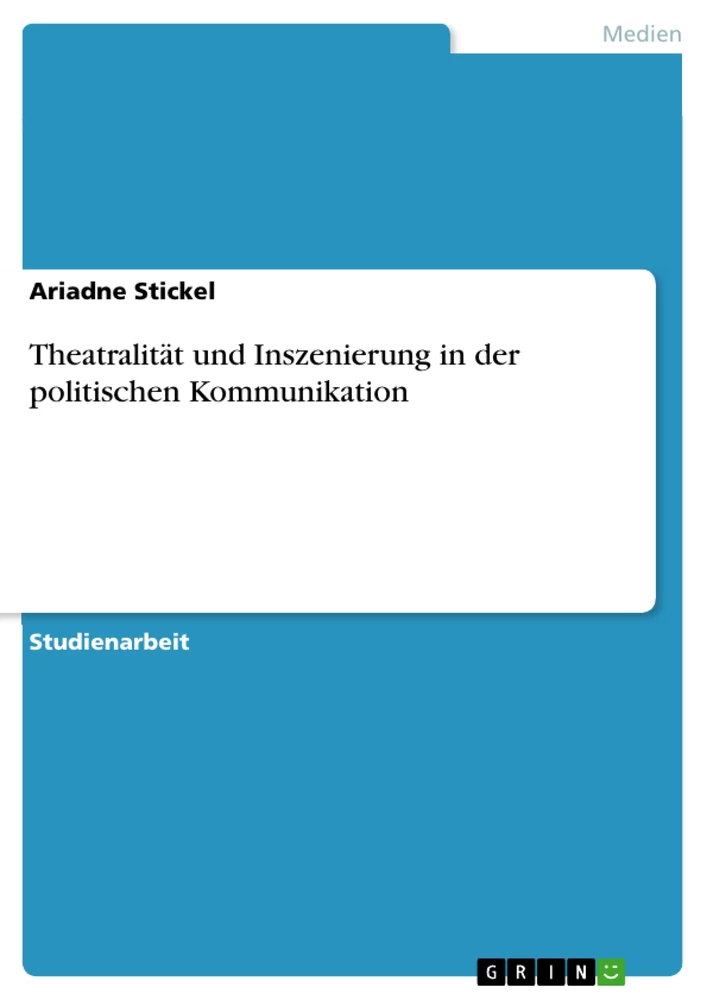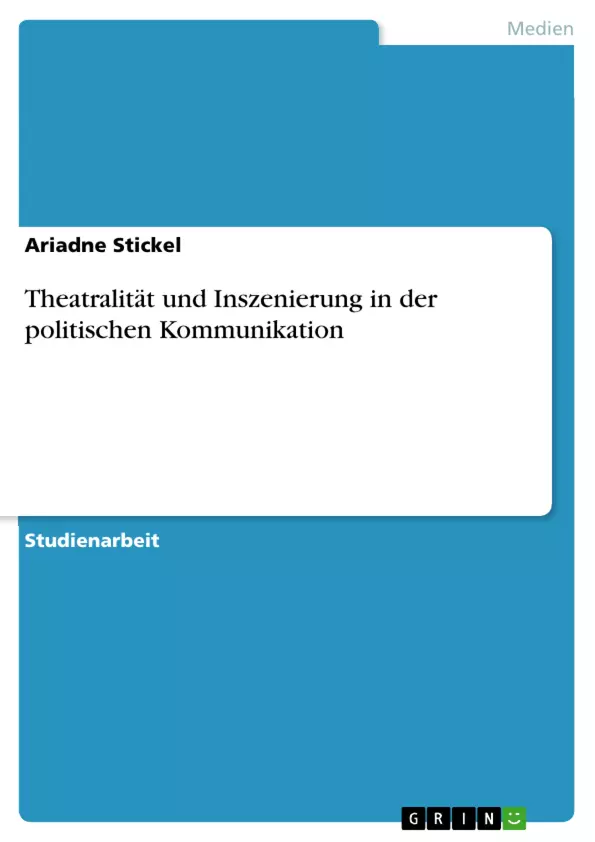Das Spannungsfeld zwischen Theatralität, Inszenierung und politischer Kommunikation soll in dieser Arbeit näher betrachtet und anhand von Beispielen untersucht werden.
„Politik muss so gestaltet werden, dass sie nicht Eitelkeiten bedient, nicht auf Wirkung in der Öffentlichkeit bedacht ist, sondern dass sie Ergebnisse erzielt.” So der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg 2010 einem Bericht des Weser Kuriers zufolge. Unabhängig von der Glaubwürdigkeit dieser Aussage, die sich in Anbetracht des weiteren Verlaufs der politischen Karriere des Amtsinhabers in Frage stellen ließe, und unabhängig von dem Kontext, in dem damals die Aussage gemacht wurde, erscheinen darin enthaltene Bestrebungen zunächst einleuchtend und sinnvoll. Die öffentliche Meinung hierzulande scheint sich seit langem einig zu sein, dass es in der Politik zu viel um die Selbstdarstellung und Wirkung in der Öffentlichkeit geht und würde gewiss einen Wandel hin zu ergebnisorientierterer Politik begrüßen, bei der weniger Wert auf die Wirkung und mehr auf zielgerichtetes Handeln gelegt würde. Die Fernsehmoderatorin Sabine Christiansen wirft in ihrer Diskussionssendung besorgt die Frage auf, ob Politik zum Schowbusiness verkomme und ob es denn nur noch um die Wirkung der Politik im Fernsehen gehe.
Derlei Fragen führen zu dem in diesem Zusammenhang häufig verwendeten Inszenierungsbegriff, welcher wiederum unmittelbar mit dem immer wieder angestellten Vergleich zwischen Theater und Politik zusammenhängt. Leidenschaftlich gerne bedienen sich Journalisten der Metapher. Es ist dann von Marionetten zu lesen, von Kasperletheater, der politischen Bühne, von Laientruppen und Szenen. Meist geht mit solch einem Vergleich eine negative Konnotation einher. Es wird dem Gefühl Ausdruck verliehen getäuscht zu werden, lediglich Zeuge einer Inszenierung statt „echter” Politik zu sein. Von Maske, Fassade, Inszenierung und mangelnder Authentizität ist in diesem Zusammenhang ebenfalls häufig die Rede. Was aber bedeutet Inszenierung im ursprünglichen Sinne der Theaterwissenschaft und was in der Politik? Welcher Inszenierungspraktiken wird sich bedient und wann sind diese nicht zu verurteilen, sondern möglicherweise eine Notwendigkeit?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Selbstdarstellung im Alltag bei Goffman
- Theatralität in der politischen Kommunikation
- Die negative Konnotation und der Inszenierungsbegriff in der politischen Kommunikation
- Vorderbühne – Hinterbühne
- (Sich)-In-Szene-Setzen
- Form und Mittel der Inszenierung bei Peer Steinbrück während des „Klartext-Open-Airs“
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Bedeutung von Theatralität und Inszenierung in der politischen Kommunikation. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie Inszenierungspraktiken in der Politik eingesetzt werden und welche Auswirkungen sie auf die öffentliche Wahrnehmung haben.
- Das Spannungsfeld zwischen Theatralität und Inszenierung in der politischen Kommunikation
- Die Rolle der Selbstdarstellung in der Politik und ihre Beziehung zu Goffmans Theorien
- Die Bedeutung von Inszenierungsstrategien in der politischen Kommunikation
- Die Auswirkungen von Inszenierungspraktiken auf die öffentliche Wahrnehmung
- Beispiele aus der politischen Praxis zur Veranschaulichung der Thematik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Inszenierung in der politischen Kommunikation vor und führt den Leser in die Problemstellung ein. Sie zeigt die Relevanz des Themas auf und skizziert den Forschungsstand.
- Die Selbstdarstellung im Alltag bei Goffman: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Erkenntnissen von Erving Goffman, der in seiner Untersuchung „Wir alle spielen Theater“ die alltägliche Inszenierungspraktiken des Einzelnen analysiert. Es werden Goffmans Kernaussagen und seine Konzepte von Vorder- und Hinterbühne erläutert.
- Theatralität in der politischen Kommunikation: Dieses Kapitel untersucht den Begriff der Theatralität und dessen Bedeutung für die politische Kommunikation. Es werden die vier Aspekte der Theatralität nach Fischer-Lichte erläutert und ihre Anwendung in der politischen Praxis betrachtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Theatralität, Inszenierung, politische Kommunikation, Selbstdarstellung, Goffman, Vorderbühne, Hinterbühne, Performance, Korporalität, Wahrnehmung, öffentliche Meinung, Medien, Politik, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Inszenierung“ in der Politik?
Inszenierung bezeichnet die gezielte Gestaltung des öffentlichen Auftritts von Politikern, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen und Botschaften medial wirksam zu platzieren.
Was ist Goffmans Konzept von Vorderbühne und Hinterbühne?
Die Vorderbühne ist der Ort der öffentlichen Selbstdarstellung, während die Hinterbühne der private Raum ist, in dem die Inszenierung vorbereitet wird und Politiker „sie selbst“ sein können.
Ist politische Inszenierung immer negativ zu bewerten?
Nein, die Arbeit diskutiert, dass Inszenierung in einer mediengesteuerten Gesellschaft oft eine Notwendigkeit ist, um komplexe Inhalte überhaupt Gehör zu verschaffen.
Welches Beispiel wird für moderne politische Inszenierung genannt?
Die Hausarbeit analysiert unter anderem das „Klartext-Open-Air“ von Peer Steinbrück als Beispiel für spezifische Inszenierungspraktiken.
Was bedeutet „Theatralität“ im politischen Kontext?
Es beschreibt die Nutzung theatraler Mittel (Raum, Körper, Licht, Dramaturgie), um politische Ereignisse als Aufführungen für das Publikum (Wähler) zu gestalten.
- Citation du texte
- Ariadne Stickel (Auteur), 2014, Theatralität und Inszenierung in der politischen Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366902