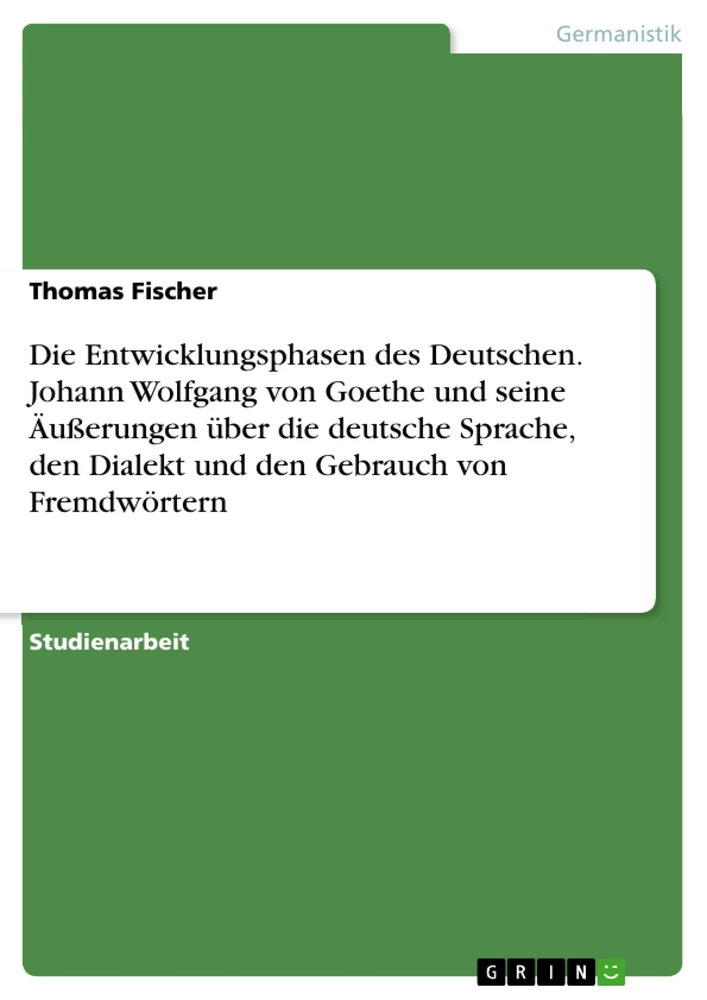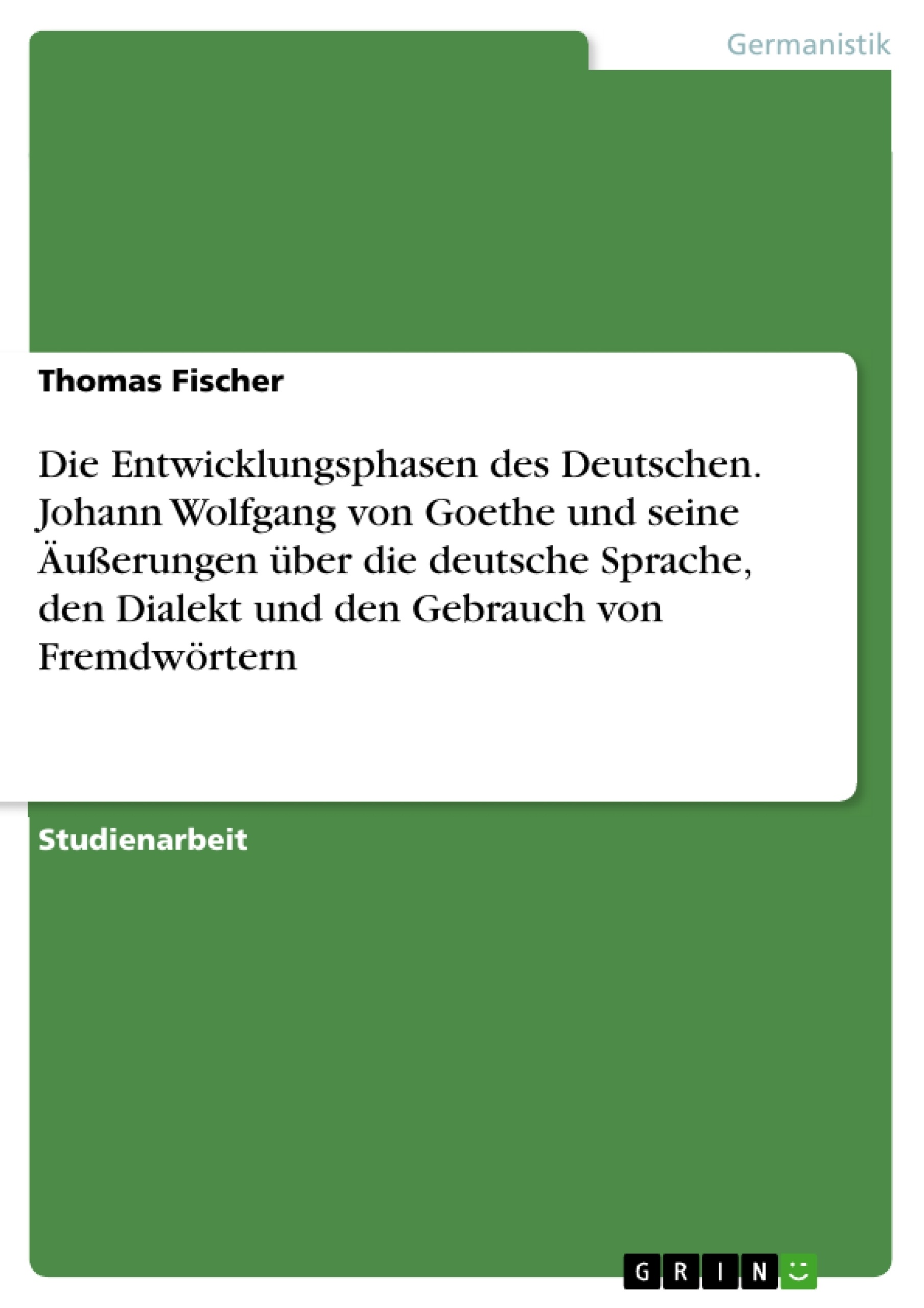Ziel dieser Arbeit ist es, ein repräsentatives Gesamtbild über das Verhältnis Goethes zur deutschen Sprache zu erstellen und dadurch mehr Verständnis über die Sprache der Goethezeit von 1770 bis 1830 zu erhalten.
In dieser Arbeit sollen zuerst Goethes kritische Äußerungen über die Unzulänglichkeiten der deutschen Sprache unter Beachtung der bereits erwähnten Schwierigkeiten untersucht werden. Im Anschluss daran werden Äußerungen über die positiven Möglichkeiten der deutschen Sprache behandelt, da dies einen direkten Blick auf das Verhältnis negativer, oder besser: kritischer zu positiven Aussagen über die Sprache ermöglicht. Danach wird Goethes Auffassung über den Dialekt und dessen Stellung bezüglich der Schauspielerei Gegenstand der Untersuchung, bevor abschließend das Verhältnis des Dichters zum Gebrauch von Fremdwörtern erläutert werden soll. Hierbei ist es in den meisten Bereichen erforderlich, den Wandel bestimmter Ansichten Goethes über die deutsche Sprache im Laufe seines Lebens zu beachten. Die Tragweite dieses Aspektes wird allein schon in den unterschiedlichen Sprachstilen, die Goethe abhängig vom Lebensalter verwendet, ersichtlich. Als Beispiel denke man nur an „Die Leiden des jungen Werthers“ im Vergleich zu dem zweiten Teil des „Faust“ sowie an die Tatsache, dass Goethe seine früheren Werke zu einem späteren Zeitpunkt überarbeitet hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Kritische Äußerungen über die deutsche Sprache
- 3. Positive Äußerungen über die deutsche Sprache
- 4. Äußerungen über den Dialekt
- 5. Äußerungen über den Gebrauch von Fremdwörtern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goethes Verhältnis zur deutschen Sprache, indem sie seine kritischen und positiven Äußerungen analysiert. Das Ziel ist es, ein umfassendes Bild seines Sprachverständnisses zu zeichnen und dadurch ein besseres Verständnis der Sprache der Goethezeit (1770-1830) zu ermöglichen. Die Arbeit berücksichtigt die Entwicklung seiner Ansichten im Laufe seines Lebens und die Komplexität der Interpretation seiner Aussagen.
- Goethes kritische Äußerungen über die deutsche Sprache und ihre Kontextualisierung
- Goethes positive Wertschätzung der deutschen Sprache und ihrer Ausdrucksmöglichkeiten
- Goethes Haltung zum Dialekt und dessen Rolle im Theater
- Goethes Position zum Gebrauch von Fremdwörtern
- Die Entwicklung von Goethes Sprachverständnis im Laufe seines Lebens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Die Arbeit befasst sich mit Goethes Äußerungen zur deutschen Sprache, einem Thema, das in der Sprachwissenschaft bisher wenig Beachtung gefunden hat. Goethes umfangreiches Werk und die damit verbundene Mythenbildung erschweren die objektive Analyse. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, Aussagen im Kontext ihres jeweiligen Schriftstücks zu betrachten, um Fehlinterpretationen zu vermeiden, insbesondere bei scheinbar kritischen Äußerungen. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die Untersuchung von Goethes kritischen und positiven Äußerungen, seiner Haltung zu Dialekten und Fremdwörtern umfasst und den Wandel seiner Ansichten im Laufe seines Lebens berücksichtigt.
2. Kritische Äußerungen über die deutsche Sprache: Dieses Kapitel untersucht Goethes vermeintlich kritische Äußerungen zur deutschen Sprache. Es differenziert zwischen direkter Kritik an der Sprache selbst und Kritik an deren Gebrauch. Goethes vermeintliche Sprachkritik wird im Kontext seiner Werke analysiert und als Ausdruck seiner Überzeugung interpretiert, dass die Sprache nicht alle Aspekte des menschlichen Erlebens und des Geistes adäquat erfassen kann. Beispiele aus seinen Werken wie „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ und die „Farbenlehre“ illustrieren seine Ansicht, dass die Sprache symbolisch und bildlich ist und höhere geistige oder natürliche Phänomene nur unzureichend beschreiben kann. Die Kritik richtete sich weniger gegen die Sprache an sich als gegen die Grenzen des Sprachausdrucks.
Schlüsselwörter
Goethe, deutsche Sprache, Sprachkritik, Sprachgeschichte, Dialekt, Fremdwörter, Sprachphilosophie, Literaturwissenschaft, Sprachwandel, Goethezeit.
Häufig gestellte Fragen zu: Goethes Verhältnis zur deutschen Sprache
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Goethes Verhältnis zur deutschen Sprache. Sie analysiert seine kritischen und positiven Äußerungen über die Sprache, seinen Umgang mit Dialekten und Fremdwörtern, und verfolgt die Entwicklung seines Sprachverständnisses im Laufe seines Lebens (1770-1830).
Welche Aspekte von Goethes Sprachverständnis werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Goethes kritische und positive Äußerungen zur deutschen Sprache, seine Haltung zum Dialekt und dessen Rolle im Theater, seine Position zum Gebrauch von Fremdwörtern, und die Entwicklung seines Sprachverständnisses über die Jahre.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu den folgenden Themen: Problemstellung, kritische Äußerungen über die deutsche Sprache, positive Äußerungen über die deutsche Sprache, Äußerungen über den Dialekt, und Äußerungen über den Gebrauch von Fremdwörtern. Sie beinhaltet außerdem eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Wie wird Goethes vermeintliche Sprachkritik interpretiert?
Die Arbeit differenziert zwischen direkter Kritik an der Sprache selbst und Kritik an deren Gebrauch. Goethes vermeintliche Sprachkritik wird im Kontext seiner Werke analysiert und als Ausdruck seiner Überzeugung interpretiert, dass die Sprache nicht alle Aspekte des menschlichen Erlebens und des Geistes adäquat erfassen kann. Seine Kritik richtete sich weniger gegen die Sprache an sich, als gegen die Grenzen des Sprachausdrucks.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Goethes umfangreiches Werk, inklusive Werken wie „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ und die „Farbenlehre“, um seine Äußerungen zur deutschen Sprache zu kontextualisieren und zu analysieren.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit betont die Notwendigkeit, Goethes Aussagen im Kontext ihres jeweiligen Schriftstücks zu betrachten, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Der methodische Ansatz umfasst die Untersuchung von Goethes kritischen und positiven Äußerungen, seiner Haltung zu Dialekten und Fremdwörtern, und berücksichtigt den Wandel seiner Ansichten im Laufe seines Lebens.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, deutsche Sprache, Sprachkritik, Sprachgeschichte, Dialekt, Fremdwörter, Sprachphilosophie, Literaturwissenschaft, Sprachwandel, Goethezeit.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Bild von Goethes Sprachverständnis zu zeichnen und dadurch ein besseres Verständnis der Sprache der Goethezeit (1770-1830) zu ermöglichen.
- Citar trabajo
- Thomas Fischer (Autor), 2003, Die Entwicklungsphasen des Deutschen. Johann Wolfgang von Goethe und seine Äußerungen über die deutsche Sprache, den Dialekt und den Gebrauch von Fremdwörtern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367028