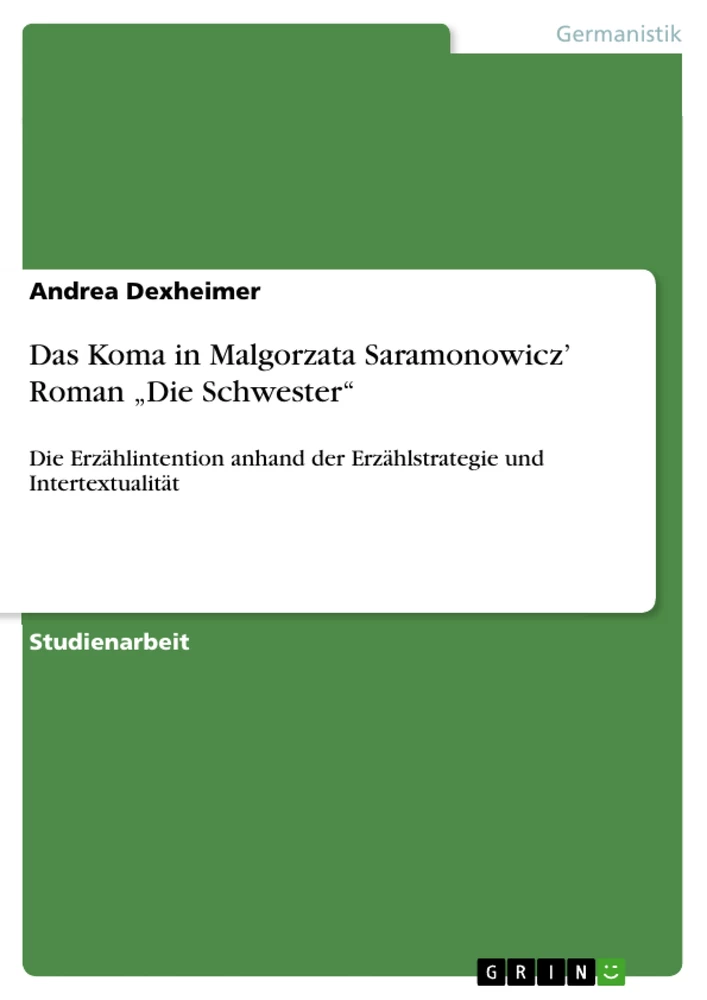Das Koma als Grenzgebiet zwischen Leben und Tod ermöglicht keine ausschließliche Beschreibung der Innenperspektive zur Darstellung der tatsächlichen Disposition des Bewusstseins. Dieser Umstand rückt die fiktionale Beschreibung nicht nur in den Vordergrund, sie eröffnet ihr gleichermaßen die Option zur Erprobung ihrer Ressourcen. In einer literarischen Nomenklatur aus drei Erzählstimmen tangiert Malgorazata Saramonowicz jenen Zustand, der sich den Forschungsgebieten der rationalen Wissenschaften wie Medizin und Philosophie weitgehend verschließt. Ihr Debutroman „Die Schwester“ regt, als zeitgenössisches postmodernes Werk mit seiner symbolhaften Sprache, zur Dechiffrierung an. In der vorliegenden Arbeit soll zunächst die erzähl-theoretische Analyse bedient werden um den Roman in seiner Vielschichtigkeit zu untersuchen. Hierbei werden die ersten Impulse zur Decodierung von der paratextuellen Ebene des Werkes geboten. Der Raum des Romans konstituiert sich aus den Differenzen, die sich aus den Positionen der Erzählstimmen konstituieren. Das Koma findet eine Beschreibungsweise indem es in einer Außenperspektive und einer verdoppelten Innenperspektive gespiegelt wird.
In einem weiteren Schritt soll die innere Verweisstruktur im Roman untersucht werden. Um die Charakteristiken der Erzählstimmen auszudifferenzieren sollen die intertextuellen Verweise in Zusammenhang mit der jeweiligen Stimme gesetzt werden. Die Analyse soll die Erzählintention des postmodernen Romans, in dessen Zentrum die Komapatientin Marie steht, unter der symbolischen Ebene tangieren. Abschließend sollen die herausgefilterten Attribute exemplarisch anhand der Interpretation der Erzählung „Die Verwandlung“ von Franz Kafka im Roman nachvollzogen werden. Die Differenzierungen in der vorliegenden Arbeit legen die Verschriftlichung des Zustands Koma in Saramonowicz’ Roman als ein literarisches Instrumentarium offen. Aus der Vorgehensweise soll eine Konkretisierung der Erzählintention hinter dem Motiv Koma resultieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Paratextuelle Betrachtungen
- 2.1. Die Stimme Marias
- 2.2. Die Botschaften des Kakerlak
- 2.3. Die Außenperspektive des Erzählers
- 3. Intertextuelle Räume im Roman
- 3.1. Kritik als Ansatz für die intertextuelle Interpretation
- 3.2. Intertextuelle Spurensuche
- 3.3. Diskurse im intertextuellen Universum
- 3.3.1. Die Differenz zur Schrift
- 3.3.2. Mythologische und biblische Adaptionen
- 4. „Die Schwester“ und „Die Verwandlung“ eine Annäherung
- 4.1. Der Kakerlak und das Ungeziefer
- 4.3. Der Apfel der Erkenntnis
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Malgorzata Saramonowicz' Roman „Die Schwester“, indem sie die Erzählstrategie und Intertextualität untersucht, um die Erzählintention des Romans zu ergründen. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Komas als Grenzbereich zwischen Leben und Tod und der vielschichtigen Erzählperspektive.
- Analyse der multiperspektivischen Erzählstruktur des Romans
- Untersuchung der intertextuellen Bezüge, insbesondere zu Franz Kafka
- Erforschung der symbolischen Sprache und der Bedeutung des Kakerlaks
- Deutung der Rolle der weiblichen Figur Maria im Kontext des Romans
- Interpretation des Komas als literarisches Instrumentarium
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Romans ein und beschreibt das Koma als einen Zustand, der sich der rationalen Wissenschaft entzieht. Sie skizziert den Ansatz der Arbeit, der die erzähltheoretische Analyse und die Untersuchung der Intertextualität verbindet, um die Erzählintention des Romans zu erhellen. Der Fokus liegt auf der Dechiffrierung der symbolhaften Sprache und der multiperspektivischen Erzählweise.
2. Paratextuelle Betrachtungen: Dieses Kapitel analysiert den Titel „Die Schwester“ als programmatische Polysemantik, die auf die Geschwisterbeziehung, den Inzest und intertextuelle Bezüge zu Kafka hinweist. Es beschreibt die drei Erzählstimmen (Maria, der Kakerlak und der Erzähler) und deren unterschiedliche Darstellung im Text (Kursivdruck, Fettdruck, reguläres Format), die auf die jeweilige Perspektive und den emotionalen Zustand hinweisen. Die Analyse der Erzählstimmen legt die Vielschichtigkeit der Erzählung und deren Bedeutung für das Verständnis des Komas offen.
3. Intertextuelle Räume im Roman: Dieses Kapitel untersucht die intertextuellen Verweise im Roman, vor allem im Hinblick auf die kritische und symbolische Ebene. Es analysiert die verschiedenen Diskurse, die im Roman aufeinandertreffen, und deren Bedeutung für die Charakterisierung der Erzählstimmen und die Deutung des Komas. Die Analyse zeigt, wie die Intertextualität die Vielschichtigkeit des Romans verstärkt und zum Verständnis der Erzählintention beiträgt.
4. „Die Schwester“ und „Die Verwandlung“ eine Annäherung: Dieses Kapitel vergleicht die Darstellung des Komas in Saramonowicz' Roman mit der Verwandlung Kafkas. Es analysiert Parallelen und Unterschiede in der Darstellung der Figuren, der symbolischen Sprache und der Erzählperspektive. Der Vergleich dient dazu, die spezifischen Merkmale der Darstellung des Komas in „Die Schwester“ hervorzuheben und die Erzählintention zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Koma, Erzähltheorie, Intertextualität, Malgorzata Saramonowicz, „Die Schwester“, Franz Kafka, „Die Verwandlung“, symbolische Sprache, multiperspektivische Erzählweise, Geschlechterrollen, Inzest, Postmoderne.
Häufig gestellte Fragen zu Malgorzata Saramonowicz' "Die Schwester"
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Malgorzata Saramonowicz' Roman "Die Schwester" unter Berücksichtigung der Erzählstrategie und Intertextualität, um die Erzählintention des Romans zu ergründen. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Komas als Grenzbereich zwischen Leben und Tod und der vielschichtigen Erzählperspektive. Die Arbeit untersucht die multiperspektivische Erzählstruktur, intertextuelle Bezüge (insbesondere zu Franz Kafka), die symbolische Sprache, die Rolle der weiblichen Figur Maria und die Interpretation des Komas als literarisches Instrumentarium.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, paratextuelle Betrachtungen (Analyse des Titels und der Erzählstimmen), intertextuelle Räume im Roman (Analyse intertextueller Verweise und Diskurse), einen Vergleich zwischen "Die Schwester" und Kafkas "Die Verwandlung", und eine Schlussbemerkung. Jedes Kapitel befasst sich mit spezifischen Aspekten des Romans und trägt zum Gesamtverständnis bei.
Welche Erzählstimmen werden im Roman analysiert?
Die Arbeit analysiert drei Erzählstimmen: die Stimme Marias, die Botschaften des Kakerlaks und die Außenperspektive des Erzählers. Die unterschiedliche Darstellung dieser Stimmen im Text (Kursivdruck, Fettdruck, reguläres Format) wird untersucht, um deren jeweilige Perspektive und den emotionalen Zustand zu verdeutlichen.
Welche intertextuellen Bezüge werden untersucht?
Die Arbeit untersucht vor allem die intertextuellen Bezüge zu Franz Kafkas "Die Verwandlung". Der Vergleich der Darstellung des Komas, der Figuren und der symbolischen Sprache in beiden Romanen bildet einen zentralen Aspekt der Analyse. Weitere intertextuelle Verweise und Diskurse werden ebenfalls untersucht und in Bezug auf die Erzählintention und die Vielschichtigkeit des Romans eingeordnet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter, die die Arbeit charakterisieren, sind: Koma, Erzähltheorie, Intertextualität, Malgorzata Saramonowicz, „Die Schwester“, Franz Kafka, „Die Verwandlung“, symbolische Sprache, multiperspektivische Erzählweise, Geschlechterrollen, Inzest, Postmoderne.
Wie wird das Koma in der Arbeit dargestellt?
Das Koma wird als Grenzbereich zwischen Leben und Tod dargestellt, der sich der rationalen Wissenschaft entzieht. Die Arbeit untersucht das Koma als literarisches Instrumentarium und analysiert dessen Darstellung in Bezug auf die Erzählperspektiven und die symbolische Sprache des Romans.
Welche Rolle spielt der Kakerlak im Roman?
Der Kakerlak spielt eine symbolische Rolle im Roman und wird als eine der Erzählstimmen analysiert. Seine Botschaften und seine Bedeutung im Kontext des Komas und der Gesamtgeschichte des Romans werden in der Arbeit untersucht.
Wie wird die Erzählintention des Romans ermittelt?
Die Erzählintention wird durch die Kombination aus erzähltheoretischer Analyse und der Untersuchung der Intertextualität ermittelt. Die Analyse der multiperspektivischen Erzählstruktur, der symbolischen Sprache und der intertextuellen Bezüge trägt zum Verständnis der Erzählintention bei.
- Arbeit zitieren
- Andrea Dexheimer (Autor:in), 2011, Das Koma in Malgorzata Saramonowicz’ Roman „Die Schwester“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367258