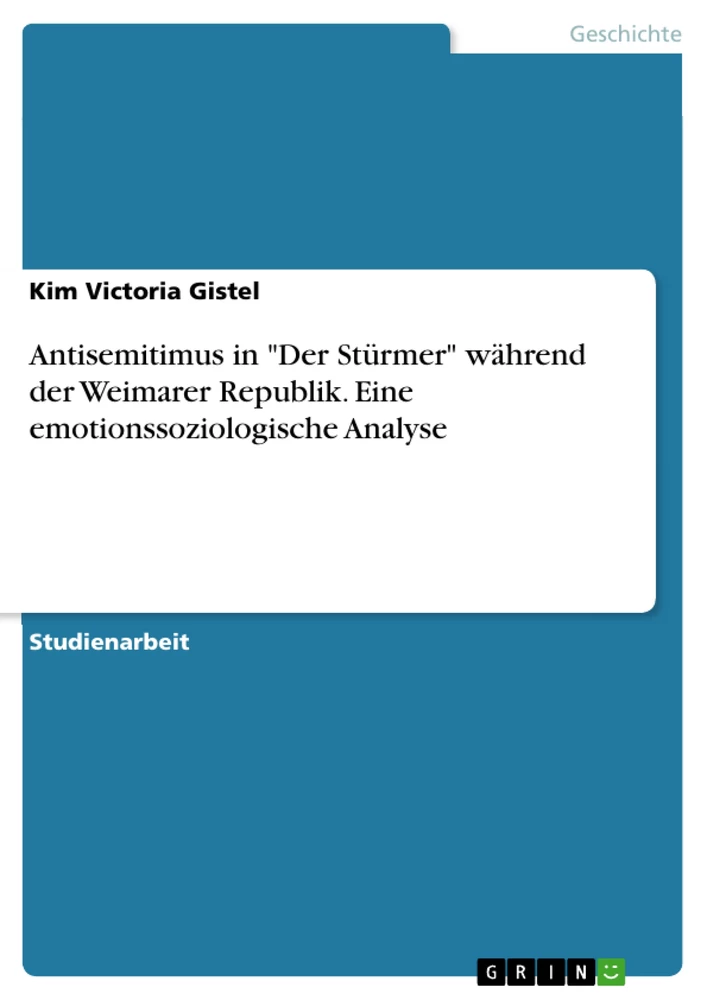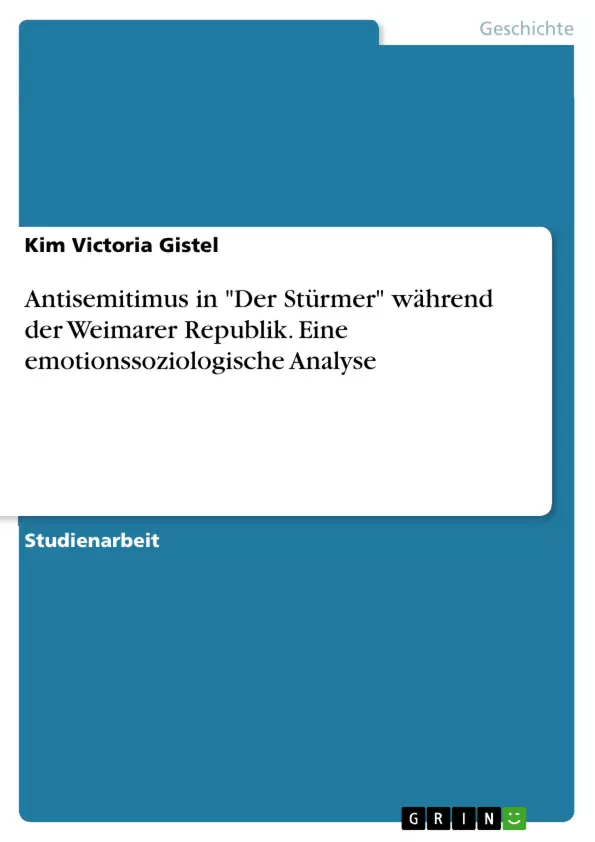Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Verbindung zwischen destruktiven Gefühlen und dem Antisemitismus des 20. Jahrhunderts. Als Grundlage der antisemitischen Propaganda wird die Hetzzeitschrift "Der Stürmer" verwendet, der als Vermittler der anti-jüdischen Ideologie der Nationalsozialisten gilt. Neben einer Einleitung in die Definitionen der soziologischen Gefühlsstrukturen des Menschen und einer kurzen Sicht auf den Antisemitismus als emotionalen Nährboden erfolgt die emotionsgeschichtliche Analyse des "Stürmers". Hier sollen vor allem der emotionale Dreiklang, bestehend aus Angst, Neid und Hass, herausgearbeitet werden. Das Hauptaugenmerk soll sich darauf richten, inwieweit der "Stürmer" in seinen Artikeln diese Gefühle in den Vordergrund setzt, mit diesen arbeitet und bei seinen Lesern weckt. Zusätzlich sollen die Ursachen und der Wirkungsgrad der Einsetzung von Gefühlen in diesem propagandistischen Werk erläutert werden. So ist die Frage zu stellen warum es überhaupt sinnvoll wäre, das antisemitische Weltbild in den Gefühlen des Menschen einzubinden und zu fixieren. Wieso musste die Abneigung gegen die jüdische Bevölkerung als körperliche beziehungsweise geistige Regung erscheinen, wenn es so unzählige antijüdische Argumentationsmodelle gab?
„Den stärksten Anlass zum Handeln bekommt der Mensch immer durch Gefühle.“ Diese Worte vom preußischen General Carl von Clausewitz lassen sich in praktisch jede Liebesgeschichte einbinden, die je geschrieben wurde. Doch nicht immer ist die Liebe das ausschlaggebende Gefühl zu einer Handlung. Auch destruktive Gefühle, wie Hass oder Neid, können den Menschen extrem beeinflussen, ganz gleich, ob dies auf einer bewussten oder unbewussten Ebene passiert. Doch wie werden solche Gefühle übermittelt? Ist es überhaupt möglich Menschen kollektiv zu beeinflussen und sie so zu manipulieren, dass diese einer objektiv ausgeführten Argumentation widerstehen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist ein Gefühl?
- Antisemitismus als emotionaler Nährboden
- »Der Stürmer«
- Journalistische Technik
- Die Propaganda im »>Stürmer<<
- Angst, Neid und Hass – der emotionale Dreiklang des »Stürmers«
- Angst
- Neid
- Hass
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die emotionale Dimension des Antisemitismus in der Zeitung »Der Stürmer« zur Zeit der Weimarer Republik. Sie befasst sich mit der Rolle von Emotionen wie Angst, Neid und Hass in der antisemitischen Propaganda und analysiert, wie diese Gefühle eingesetzt wurden, um eine anti-jüdische Ideologie zu verbreiten.
- Emotionale Strukturen des Antisemitismus
- Einsatz von Angst, Neid und Hass als Mittel der Propaganda
- Wirkung von Emotionen auf die Leser des »Stürmers«
- Soziologische und psychologische Aspekte der Gefühlsmanipulation
- Vergleichende Analyse der antisemitischen Propaganda im »Stürmer«
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Emotionsgeschichte des Antisemitismus ein und stellt die Bedeutung von Gefühlen für menschliches Handeln heraus. Kapitel 2 liefert eine kurze Definition des Begriffs „Gefühl“ und beleuchtet die Rolle von Emotionen in der Werbung und Politik. In Kapitel 3 wird Antisemitismus als ein emotionaler Nährboden beleuchtet, der auf destruktiven Gefühlen wie Hass und Angst basiert.
Kapitel 4 analysiert die Zeitung »Der Stürmer« als Instrument der antisemitischen Propaganda. Es werden die journalistischen Techniken und die Propaganda des »Stürmers« erläutert, sowie der emotionale Dreiklang aus Angst, Neid und Hass, der in der Zeitung zum Einsatz kommt. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie diese Gefühle bei den Lesern geweckt und eingesetzt werden, um ihre Meinung zu beeinflussen.
Schlüsselwörter
Antisemitismus, Emotionen, »Der Stürmer«, Propaganda, Angst, Neid, Hass, Weimarer Republik, Gefühlsmanipulation, Soziologie, Psychologische Aspekte, Geschichte der Emotionen, Medienanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was war "Der Stürmer"?
"Der Stürmer" war eine von Julius Streicher herausgegebene antisemitische Hetzzeitschrift im Nationalsozialismus, die für ihre aggressive und primitive Propaganda bekannt war.
Welche Rolle spielen Gefühle in der Propaganda des "Stürmers"?
Die Propaganda zielte darauf ab, den "emotionalen Dreiklang" aus Angst, Neid und Hass bei den Lesern zu wecken, um das antisemitische Weltbild tief zu verankern.
Warum wurde Neid als propagandistisches Mittel eingesetzt?
Durch die Darstellung der jüdischen Bevölkerung als vermeintlich unrechtmäßig wohlhabend oder einflussreich wurde Neid geschürt, um soziale Ausgrenzung zu legitimieren.
Wie wurde Angst im "Stürmer" instrumentalisiert?
Juden wurden als existenzielle Bedrohung für das deutsche Volk dargestellt, um ein Klima der Angst zu schaffen, das radikales Handeln als "Notwehr" erscheinen ließ.
Was ist eine emotionssoziologische Analyse?
Diese Analyse untersucht, wie soziale Strukturen und Medien gezielt Gefühle manipulieren, um kollektive Einstellungen und Handlungen zu steuern.
- Quote paper
- Kim Victoria Gistel (Author), 2015, Antisemitimus in "Der Stürmer" während der Weimarer Republik. Eine emotionssoziologische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367344