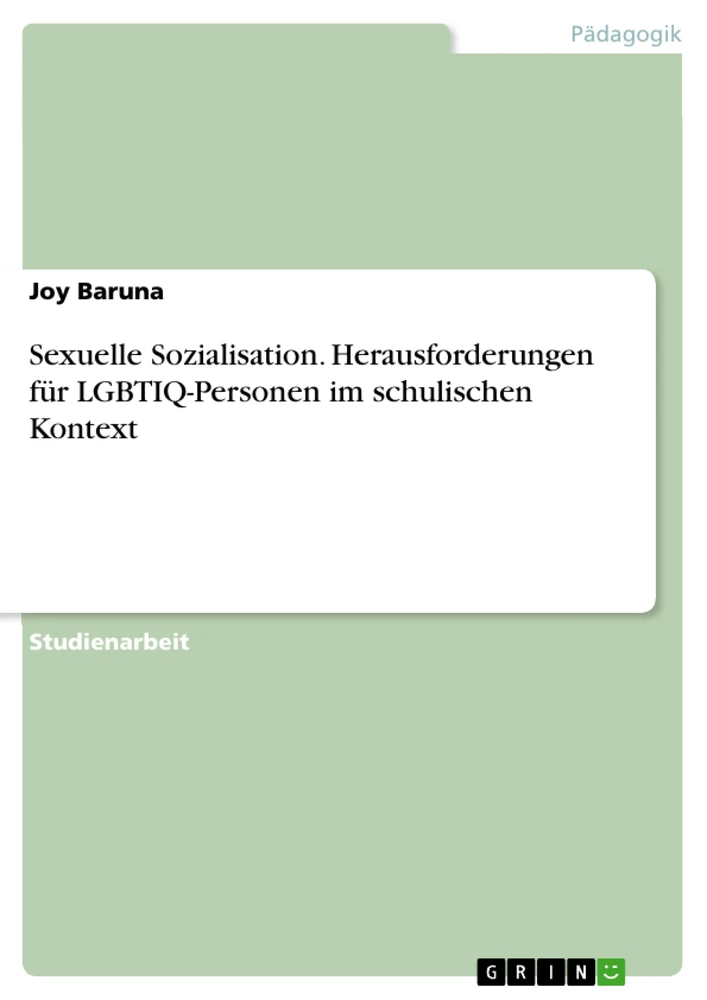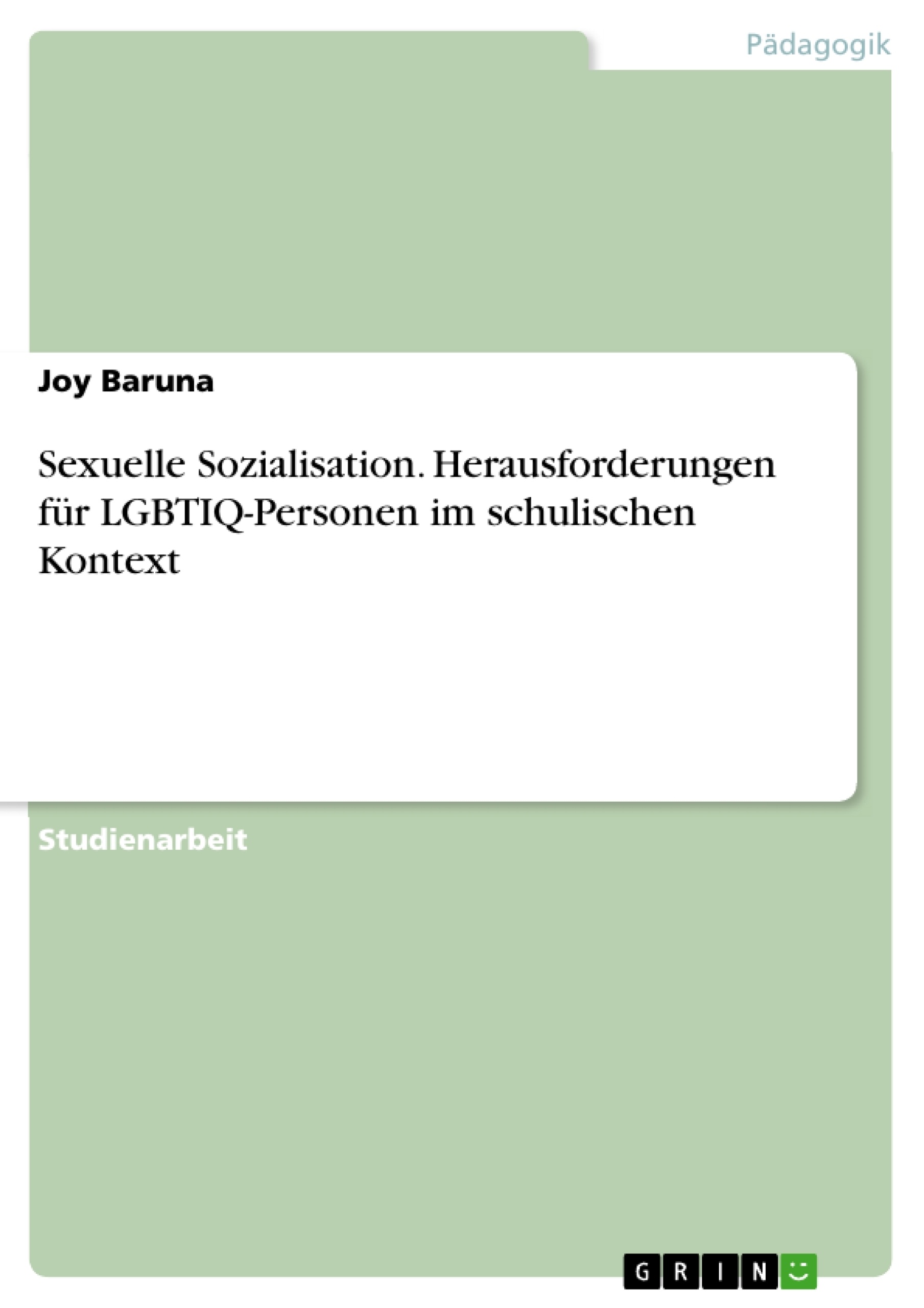Diese Arbeit stellt den Abschluss eines Projektes dar, dessen Ziel es war, innerhalb von Workshops an Grundschulen die Themen sexuelle Orientierung und sexuelle Identität kindgerecht und interdisziplinär in das Unterrichtsgeschehen einzubinden, um den Schüler*innen eine Auseinandersetzung mit LGBTQI-Lebensweisen zu ermöglichen und Mobbing, Gewalt sowie Ausgrenzung entgegenzuwirken. Daraus ergab sich die grundsätzliche Frage, welche Rolle der schulische Kontext bezüglich der Entwicklung der sexuellen Identität spielt beziehungsweise vor welchen Herausforderungen Schüler*innen im Lebensraum Schule stehen, insbesondere sofern sie sexuelle Neigungen jenseits der Heterosexualität entwickeln, wie es bei LGBTQI-Personen der Fall ist.
Zu Beginn ist eine Klärung der Begriffe sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität und Geschlechtsrolle unumgänglich. Desweiteren wird in Kürze auf die Genese der sexuellen Präferenzstruktur sowie der sexuellen Identität eingegangen. Es folgen eine Auseinandersetzung mit der Institution Schule als Sozial-und Inszenierungsraum und ein Überblick zu den Problemlagen von LGBTQI-Schüler*innen, wobei insbesondere auf den Prozess des Coming-outs eingegangen wird. Abschließend werden die Implikationen zusammengefasst, welche sich im Hinblick auf eine moderne Sexualpädagogik der Vielfalt ableiten lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1) Einleitung
- 2) Sexuelle Identität und sexuelle Orientierung
- a) Begriffsdifferenzierung und Überblick zum gesellschaftlichen Diskurs
- b) Genese der sexuellen Identität und sexuellen Orientierung
- 3) Sexuelle Sozialisation von LGBTQI-Schüler*innen im schulischen Kontext
- a) Daten- und Problemlage im Überblick
- b) Das Coming-out
- 4) Fazit und Schlussfolgerungen zum Umgang mit Vielfalt im Schulalltag
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Projekt untersucht die Herausforderungen, vor denen LGBTQI-Schüler*innen im schulischen Kontext stehen. Es beleuchtet die Bedeutung des schulischen Umfelds für die Entwicklung der sexuellen Identität und die Problematik von Diskriminierung und Mobbing. Ziel ist es, sexualpädagogische Ansätze zu fördern, die sexuelle Vielfalt einbeziehen und ein respektvolles Schulklima schaffen.
- Diskriminierung von LGBTQI-Schüler*innen in der Schule
- Begriffsdefinitionen: sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsrolle
- Das Coming-out als Prozess und Herausforderung
- Der Einfluss des schulischen Kontextes auf die sexuelle Identität
- Sexualpädagogische Ansätze für ein inklusives Schulklima
Zusammenfassung der Kapitel
1) Einleitung: Die Einleitung führt mit einem Zitat eines Schülers die Problematik von Diskriminierung und Mobbing gegenüber LGBTQI-Schüler*innen ein. Sie beschreibt das Ziel des Projekts, LGBTQI-Lebensweisen kindgerecht und interdisziplinär im Unterricht zu verankern, um Mobbing und Ausgrenzung entgegenzuwirken. Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Rolle des schulischen Kontextes bei der Entwicklung der sexuellen Identität und den Herausforderungen für LGBTQI-Schüler*innen. Sie kündigt die begriffliche Klärung, die Auseinandersetzung mit der Schule als Sozialraum und den Problemlagen von LGBTQI-Schüler*innen, insbesondere den Coming-out-Prozess, sowie die Schlussfolgerungen für eine moderne Sexualpädagogik an.
2) Sexuelle Identität und sexuelle Orientierung: Dieses Kapitel differenziert die Begriffe sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität und Geschlechtsrolle. Es wird auf die Genese der sexuellen Präferenzstruktur und der sexuellen Identität eingegangen, wobei verschiedene wissenschaftliche Perspektiven und die gesellschaftliche Debatte um die Heteronormativität und die Queer Theory einbezogen werden. Der Fokus liegt auf der sozialen Konstruktion des Geschlechts und der Notwendigkeit der Akzeptanz von vielfältigen Geschlechtsidentitäten jenseits des binären Systems. Die Kapitel analysiert den Spannungsfeld zwischen heteronormativen Sichtweisen und der Queer Theory, die die heteronormative Regulierung von Gender und Begehren kritisiert. Die Ausführungen unterstreichen die Komplexität der sexuellen Identität und die Bedeutung von Selbstdefinition und -Identifikation.
3) Sexuelle Sozialisation von LGBTQI-Schüler*innen im schulischen Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet die Datenlage und die Problematik der sexuellen Sozialisation von LGBTQI-Schüler*innen im schulischen Kontext. Es analysiert die Herausforderungen, denen sich diese Schüler*innen im Schulalltag gegenübersehen, inklusive des Coming-out Prozesses und der damit verbundenen Risiken von Diskriminierung, Mobbing und Ausgrenzung. Der Kapitel verweist auf die Notwendigkeit von inklusiven schulischen Maßnahmen und Interventionen.
Schlüsselwörter
LGBTQI, Sexuelle Identität, Sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsrolle, Heteronormativität, Queer Theory, Coming-out, Diskriminierung, Mobbing, Schule, Sexualpädagogik, Inklusion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Herausforderungen für LGBTQI-Schüler*innen im Schulkontext
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Herausforderungen, denen sich LGBTQI-Schüler*innen im schulischen Kontext gegenübersehen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der sexuellen Identität und Orientierung, der sexuellen Sozialisation im Schulkontext, dem Coming-out-Prozess und der Bedeutung einer inklusiven Sexualpädagogik.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen sind: Diskriminierung und Mobbing von LGBTQI-Schüler*innen, begriffliche Klärung von sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Geschlechtsrolle, der Coming-out-Prozess als Herausforderung, der Einfluss des schulischen Kontextes auf die sexuelle Identität und sexualpädagogische Ansätze für ein inklusives Schulklima. Das Dokument analysiert auch die heteronormative Perspektive und die Queer Theory.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in vier Kapitel: 1) Einleitung, 2) Sexuelle Identität und sexuelle Orientierung, 3) Sexuelle Sozialisation von LGBTQI-Schüler*innen im schulischen Kontext und 4) Fazit und Schlussfolgerungen zum Umgang mit Vielfalt im Schulalltag. Kapitel 2 differenziert wichtige Begriffe und beleuchtet die Genese sexueller Identität. Kapitel 3 konzentriert sich auf die Datenlage und Problematik der sexuellen Sozialisation von LGBTQI-Schüler*innen in der Schule, inklusive des Coming-out-Prozesses.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Das Dokument zielt darauf ab, die Herausforderungen für LGBTQI-Schüler*innen im schulischen Kontext zu untersuchen und sexualpädagogische Ansätze zu fördern, die sexuelle Vielfalt einbeziehen und ein respektvolles Schulklima schaffen. Es möchte dazu beitragen, Mobbing und Ausgrenzung entgegenzuwirken und LGBTQI-Lebensweisen kindgerecht und interdisziplinär im Unterricht zu verankern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: LGBTQI, Sexuelle Identität, Sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsrolle, Heteronormativität, Queer Theory, Coming-out, Diskriminierung, Mobbing, Schule, Sexualpädagogik, Inklusion.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist die nach der Rolle des schulischen Kontextes bei der Entwicklung der sexuellen Identität und den damit verbundenen Herausforderungen für LGBTQI-Schüler*innen.
Wie wird das Thema Coming-out behandelt?
Das Coming-out wird als Prozess und Herausforderung für LGBTQI-Schüler*innen dargestellt, der mit Risiken wie Diskriminierung, Mobbing und Ausgrenzung verbunden sein kann. Das Dokument betont die Bedeutung von Unterstützung und Akzeptanz im schulischen Umfeld.
Welche Rolle spielt die Queer Theory?
Die Queer Theory wird als Gegenposition zur heteronormativen Perspektive präsentiert und dient der Analyse der gesellschaftlichen Regulierung von Gender und Begehren. Sie unterstreicht die Notwendigkeit der Akzeptanz vielfältiger Geschlechtsidentitäten jenseits des binären Systems.
- Quote paper
- Joy Baruna (Author), 2017, Sexuelle Sozialisation. Herausforderungen für LGBTIQ-Personen im schulischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367349