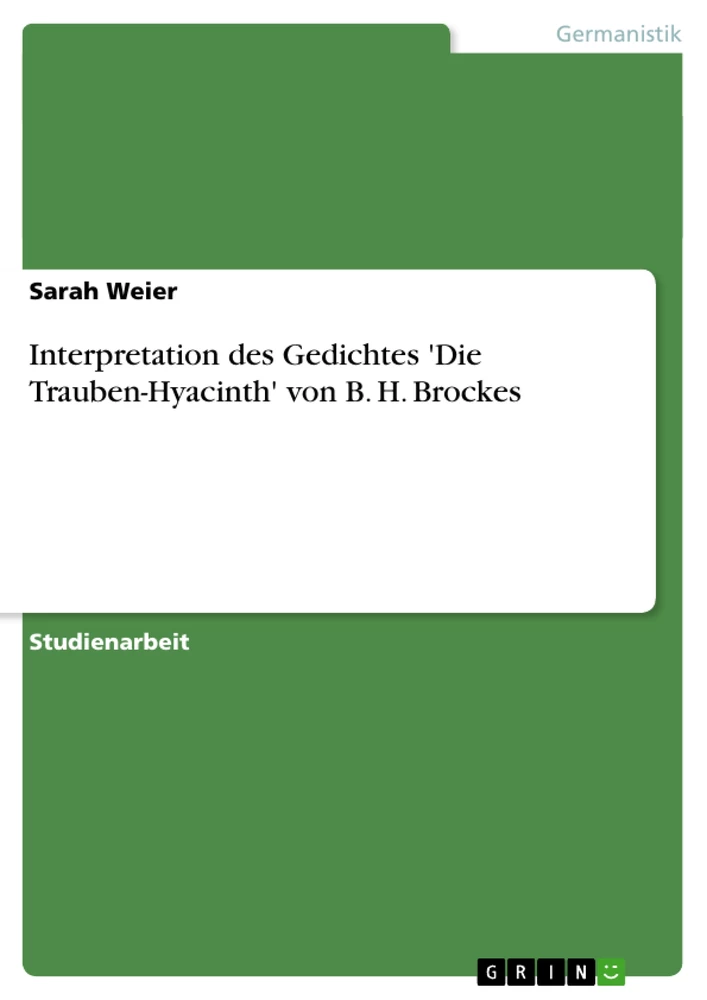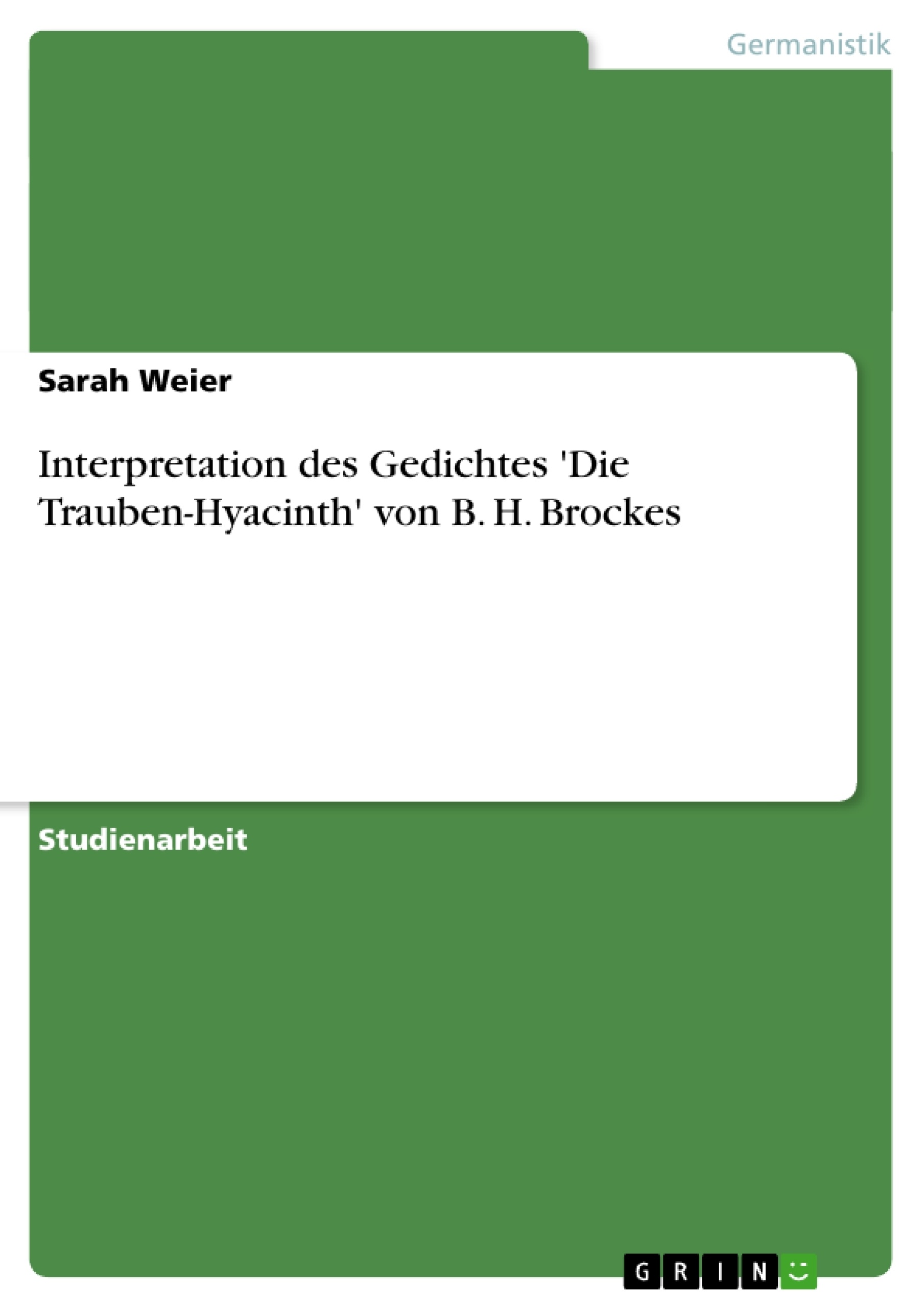Der frühaufklärerische Poet und Hamburger Ratsherrn Barthold Heinrich Brockes [1680-1747] gehört zu den weniger bekannten Schriftstellern deutschen Literaturgeschichte.1 Sein Hauptwerk, die neunbändige Gedichtanthologie „Irdisches Vergnügen in Gott“ wurde zu Lebzeiten Brockes‘ abgewertet, ohne ihren hohen Informationsgehalt zu beachten. Denn dieses Werk, so behauptet Kimber, sei „eine Schatzkammer an Informationen über das frühe 18.Jahrhundert“ (Kim, S. 47). In meiner Arbeit befasse ich mich exemplarisch mit dem Gedicht „Die Trauben-Hyacinth“2 aus Band V des „Irdischen Vergnügen in Gott“ um dieser Behauptung nachzugehen. Ich beginne mit einer Untersuchung der formalen Mittel des Gedichtes sowie einer Inhaltserschließung mit der Methode des semiotischen Strukturalismus. Dies soll der Ausgangspunkt für weitere, historisch gebundene Untersuchungen sein. Zum einen soll hier nach spezifischen Grundsätzen für die Epoche der Aufklärung gesucht werden. Zum anderen werde ich Referenzen zu zeitgenössischen Diskursen aufgreifen. Mein Hauptanliegen ist dabei, den Diskurs in seiner historischen Bedeutung darzustellen und seine Anwendung in Brockes‘ „Trauben-Hyacinth“ sichtbar zu machen. 1 Meine Ausführungen hierzu stützen sich auf folgende Quelle: Ida M. Kimber: Barthold Heinrich Brockes‘ Irdisches Vergnügen in Gott als zeitgenössisches Dokument. In: Barthold Heinrich Brockes (1680- 1747) Dichter und Ratsherr in Hamburg. Neue Forschungen zu Persönlichkeit und Wirkung. Hamburg 1980, S. 45-70; fortan: Kim 2 Entnommen aus: Barthold Heinrich Brockes. Die Trauben-Hyacinth. In: B. H. Brockes Irdisches Vergnügen in Gott. Stuttgard 1999, Band V des Irdischen Vergnügen in Gott nicht erhältlich war.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Inhalt vor Form - die dienende Funktion formaler Mittel
- II.1. Satzstruktur und Sinnesabschnitte
- II.2. Die Regelmäßigkeit des Metrums
- II.3. Reim und Versform
- III. Irdisches Vergnügen in Gottes Schöpfung
- III.1. Die Betrachtung der Blume
- III.2. Die, Sternchen
- III.3. Gottes Werk
- IV. Auswirkungen der Stilsenkung
- IV.1. Stilsenkung bei Brockes
- IV.2. Metapher und Allegorie
- V. Betrachten und Beschreiben - frühaufklärerische Naturlyrik
- V.1. Erkenntnisinteresse
- V.2. Mikro- und Makrokosmos
- V.3. Gemütsregung
- VI. Die Offenbarung Gottes in der Natur
- VI.1. Die Gartennatur
- VI.2. Die zwei Bücher
- VI.3. Natürliche Religion
- VII. Physikotheologie - Naturwissenschaften als Beweis der göttlichen Lehre
- VII.1. Die Lehre
- VII.2. Erkenntnisse
- VII.3. Vorgehensweise
- VIII. Theodizee- die Grundlage der Brockesschen Dichtungsauffassung
- VIII.1. Die Debatte um Gottes Schöpfung
- VIII.2. Brockes Dichtungsauffassung
- VIII.3. Die Theodizee in der „Trauben-Hyacinth“
- IX. Ergebnisse der Interpretation
- IX.1. Ein Lehrgedicht zu den Wissenschaften in der Aufklärung
- IX.2. Die inhaltlichen und formalen Ansprüche
- IX.3. Möglichkeiten für weitere Untersuchungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Gedicht „Die Trauben-Hyacinth“ von Barthold Heinrich Brockes, um dessen „Irdisches Vergnügen in Gott“ als zeitgenössisches Dokument des 18. Jahrhunderts zu beleuchten. Dabei werden die formalen Mittel des Gedichts untersucht und mit der Methode des semiotischen Strukturalismus der Inhalt erschlossen. Der Fokus liegt auf der Aufklärungsepoche und den zeitgenössischen Diskursen, die im Gedicht ihren Niederschlag finden.
- Formale Mittel und ihre Funktion in der Vermittlung des Inhalts
- Schöpfung Gottes und ihre Darstellung in der Natur
- Naturlyrik der Frühaufklärung und das Erkenntnisinteresse
- Physikotheologie und die Rolle der Naturwissenschaften
- Theodizee und die Debatte um Gottes Schöpfung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Autor Barthold Heinrich Brockes und sein Hauptwerk „Irdisches Vergnügen in Gott“ vor. Das Gedicht „Die Trauben-Hyacinth“ wird als Beispiel für Brockes’ Werk ausgewählt und die Methode der Analyse beschrieben. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den formalen Mittel des Gedichts. Es analysiert die Satzstruktur, das Metrum und den Reim, um die Funktion dieser Mittel für die Vermittlung des Inhalts zu beleuchten. Im dritten Kapitel wird der Inhalt des Gedichts im Kontext der Gottes Schöpfung dargestellt. Es untersucht die Betrachtung der Blume, die Sternenbilder und den Bezug auf Gottes Werk. Das vierte Kapitel widmet sich den Auswirkungen der Stilsenkung in Brockes’ Werk. Es analysiert die Stilsenkung im Gedicht sowie die Verwendung von Metaphern und Allegorien. Das fünfte Kapitel betrachtet das Gedicht im Kontext der Frühaufklärung. Es untersucht das Erkenntnisinteresse, die Darstellung von Mikro- und Makrokosmos und die emotionale Wirkung des Gedichts. Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit der Offenbarung Gottes in der Natur. Es analysiert die Darstellung der Gartennatur, das Konzept der „zwei Bücher“ und die natürliche Religion. Das siebte Kapitel beleuchtet die Rolle der Naturwissenschaften in der Physikotheologie. Es behandelt die Lehre, die Erkenntnisse und die Vorgehensweise dieser Disziplin. Das achte Kapitel widmet sich der Theodizee. Es stellt die Debatte um Gottes Schöpfung dar, erläutert Brockes’ Dichtungsauffassung und analysiert die Theodizee im Gedicht.
Schlüsselwörter
Barthold Heinrich Brockes, „Irdisches Vergnügen in Gott“, „Die Trauben-Hyacinth“, Frühaufklärung, Naturlyrik, Physikotheologie, Theodizee, Schöpfung Gottes, semiotischer Strukturalismus, formale Mittel, Inhalt, Erkenntnisinteresse.
- Quote paper
- Sarah Weier (Author), 2002, Interpretation des Gedichtes 'Die Trauben-Hyacinth' von B. H. Brockes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36744