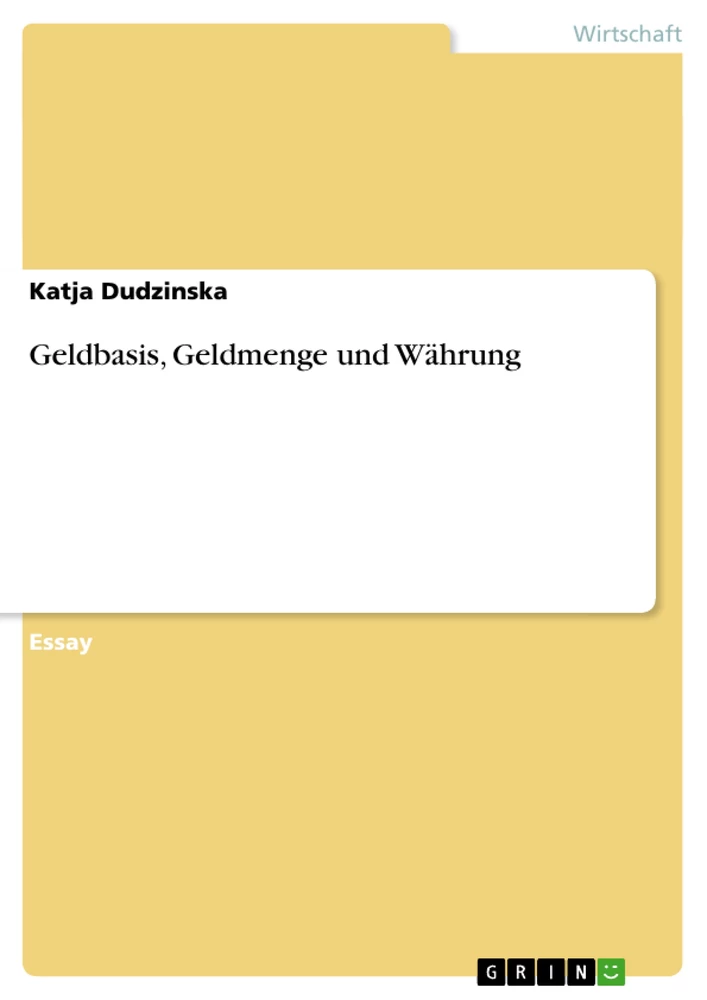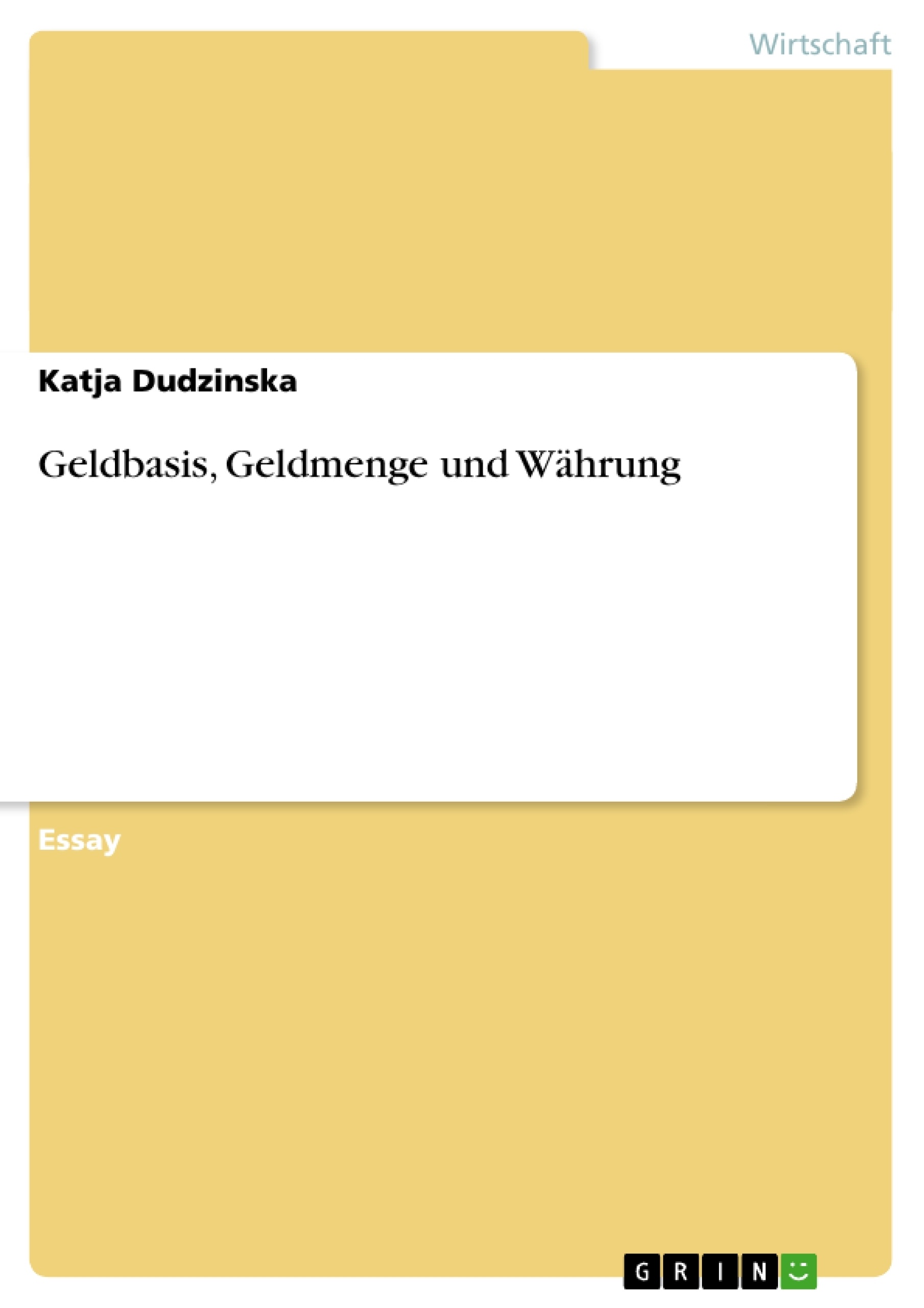Der Begriff Währung wird in einem doppelten Sinne gebraucht. Zum einen bezeichnet er die vom Staat anerkannte Geldeinheit, das jeweils gültige Zahlungsmittel, wie z. B. Dollar- oder Eurowährung. Unter Währung versteht man aber auch die Verfassung und Ordnung des gesamten Geldwesens eines Landes. Mit dem Begriff Währung wird verdeutlicht, dass die Staaten das Geldwesen nicht sich selbst überlassen, sondern durch Gesetze, Institutionen und Eingriffe zu ordnen versuchen. Grundelemente der Geldverfassung eines Landes sind das Festsetzen der Währungseinheit, die Ordnung des Münz- und Notenwesens, die Ordnung des Kreditwesens sowie die Wahl des Währungssystems. Die Geldverfassung eines jeden Landes ist in das internationale Währungssystem eingebettet. In der Regel verfügt heute jeder souveräne Staat über eine eigene Währung. Ausnahmen bilden hier zwischenstaatliche Abkommen, in denen ein Staat seine Währungshoheit in mehr oder minder großem Ausmaß auf internationale oder supranationale Organe überträgt, wie das z. B. bei Währungsunionen der Fall ist (Europäische Notenbank) (Böhlich 7; Issing Geldpol. 1,2; Duwendag 134).
Inhaltsverzeichnis
- Währung
- Begriffsklärung
- Währungsarten
- Gebundene Währungen (Metallwährungen)
- Monometallistische Währungen
- Bimetallistische Währungen
- Freie Währungen (Papierwährungen)
- Gebundene Währungen (Metallwährungen)
- Geldbasis und Geldmenge
- Geldbegriff und Geldfunktionen
- Zentralbankgeldmenge (Geldbasis, monetäre Basis)
- Geschäftsbankengeldmenge
- Geldmenge (Geldvolumen)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen Geldbasis, Geldmenge und Währung. Der Fokus liegt dabei auf der Beschreibung der verschiedenen Währungsarten, der Funktionen von Geld, der Entstehung und Zusammensetzung der Geldbasis sowie der Geldmenge. Ziel ist es, ein grundlegendes Verständnis für die Mechanismen des modernen Geldwesens zu schaffen.
- Die verschiedenen Währungsarten und ihre Eigenschaften
- Die Funktionen von Geld in der modernen Ökonomie
- Die Entstehung und Zusammensetzung der Geldbasis (Zentralbankgeldmenge)
- Die Entstehung und Entwicklung der Geldmenge (Geldvolumen)
- Die Bedeutung der Zentralbank in der Geldpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Währung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Währung und unterscheidet zwischen verschiedenen Währungsarten. Es wird erläutert, wie das Geldwesen eines Landes organisiert ist und welche Rolle der Staat dabei spielt. Die verschiedenen Währungen werden vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile diskutiert. Besonders deutlich wird die Entwicklung von gebundenen Währungen (Metallwährungen) zu freien Währungen (Papierwährungen).
2. Geldbasis und Geldmenge
Dieser Abschnitt befasst sich mit den grundlegenden Geldbegriffen und -funktionen. Es werden die verschiedenen Formen von Geld und ihre Funktionen im wirtschaftlichen Kontext analysiert. Insbesondere wird der Zusammenhang zwischen Geldbasis (Zentralbankgeld) und Geschäftsbankengeldmenge sowie der Entwicklung der Geldmenge beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Geldbasis, die Geldmenge und verschiedene Währungen. Im Mittelpunkt stehen die Funktionen des Geldes, die Rolle der Zentralbank bei der Geldpolitik sowie die verschiedenen Währungssysteme und ihre Eigenschaften.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Geldbasis und Geldmenge?
Die Geldbasis (Zentralbankgeld) wird direkt von der Notenbank kontrolliert. Die Geldmenge umfasst zusätzlich das durch Geschäftsbanken geschaffene Giralgeld (Kredite).
Welche Funktionen hat Geld in der Wirtschaft?
Geld dient als Tausch- und Zahlungsmittel, als Recheneinheit (Wertmaßstab) und als Wertaufbewahrungsmittel.
Was unterscheidet Metallwährungen von Papierwährungen?
Metallwährungen (gebunden) haben einen Eigenwert oder sind an Gold/Silber gekoppelt. Papierwährungen (frei) basieren auf dem Vertrauen in die ausgebende Institution und den Staat.
Was bedeutet Währungshoheit?
Währungshoheit ist das Recht eines souveränen Staates, seine eigene Währungseinheit festzulegen und das Geldwesen gesetzlich zu ordnen.
Was ist ein Bimetallismus?
Ein Währungssystem, in dem zwei Metalle (meist Gold und Silber) gleichzeitig als gesetzliches Zahlungsmittel in einem festen Wertverhältnis zueinander stehen.
- Citar trabajo
- Katja Dudzinska (Autor), 2003, Geldbasis, Geldmenge und Währung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36748