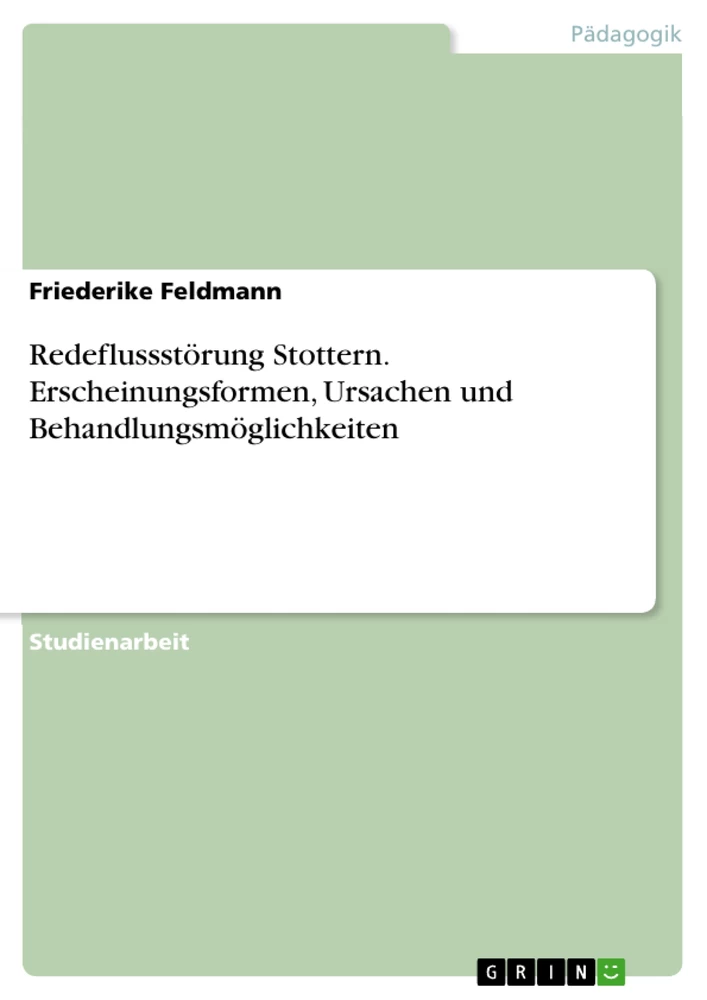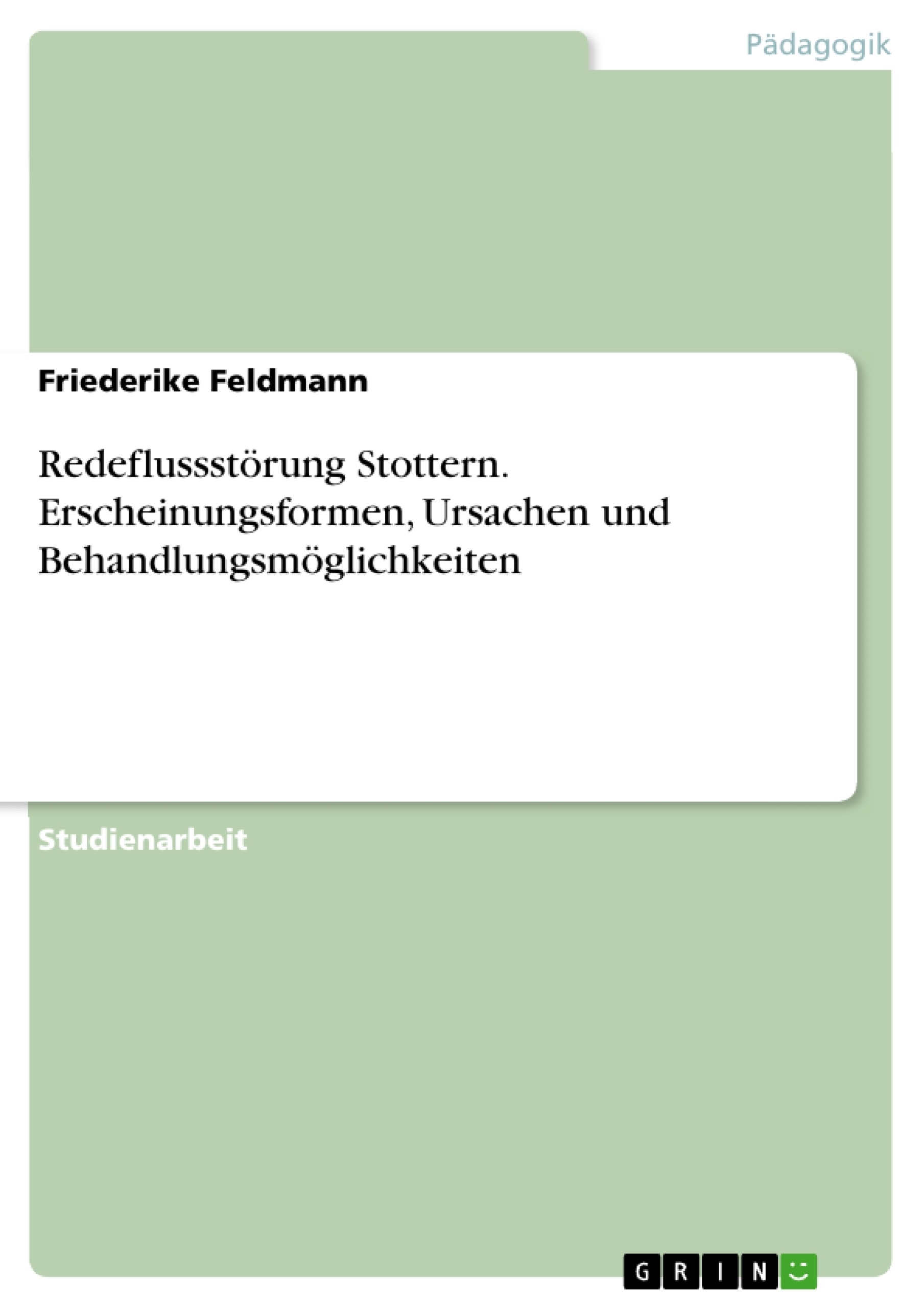In dieser Arbeit wird die Redeflussstörung Stottern genauer betrachtet. Zunächst wird es in der Einleitung darum gehen die verschiedenen Formen der Sprech- und Sprachstörung miteinander zu vergleichen und voneinander abzugrenzen. Im Hauptteil soll es vor allem um die möglichen Ursachen und Auslöser dieser Störung gehen. Unterschieden wird hier zwischen körperlichen, emotionalen und genetischen Komponenten. Es werden unter anderem ebenfalls mögliche Diagnoseverfahren und Therapieansätze beleuchtet.
Circa 1% der Weltbevölkerung stottert, das sind allein in Deutschland etwa 800 Tausend Betroffene. Störungen im Gesamtbereich der Sprache lassen sich in die Kommunikationskompenenten Sprache, Sprechen, Stimme, Rede und Schlucken differenzieren. Eine solche Klassifikation ist zum Verständnis und zur Einordnung der Erscheinungsformen durchaus hilfreich, kann allerdings auch zur Perspektivenverengung führen. Nicht alle Sprachstörungen verlaufen gleich, um eine angepasste Therapie zu suggerieren muss der Einzelfall möglichst genau mit seinen individuellen Stärken und Schwächen betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Erscheinungsformen der Sprachstörung
- 2. Stottern
- 2.1 Symptome
- 3. Diagnose
- 4. Ursachen
- 4.1 Körperliche Ursachen
- 4.2 Emotionale Ursachen
- 4.3 Genetische Ursachen
- 5. Therapie
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Redeflussstörung Stottern und analysiert ihre Ursachen, Symptome und mögliche Therapieansätze. Sie beleuchtet verschiedene Formen von Sprachstörungen und zeigt, wie sich Stottern von anderen Störungen unterscheidet.
- Erscheinungsformen von Sprachstörungen und ihre Unterschiede
- Ursachen des Stotterns, insbesondere körperliche, emotionale und genetische Faktoren
- Diagnosemethoden und -verfahren für Stottern
- Mögliche Therapieansätze für Stottern
- Psychologische Aspekte von Sprachstörungen und deren Einfluss auf die Persönlichkeits- und Sozialentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt verschiedene Formen von Sprachstörungen vor und hebt die Bedeutung der Redeflussstörung Stottern hervor. Sie zeigt die Relevanz des Themas auf und gibt einen Überblick über die Struktur und Inhalte der Arbeit.
- Kapitel 2: Stottern
Dieses Kapitel befasst sich mit den Symptomen des Stotterns und seiner Häufigkeit. Es wird erklärt, wie Stottern im Laufe des Lebens auftritt und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
- Kapitel 3: Diagnose
In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden und Verfahren zur Diagnose von Stottern vorgestellt. Es wird auf die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose hingewiesen und die Herausforderungen bei der Identifizierung von Stottern diskutiert.
- Kapitel 4: Ursachen
Das Kapitel behandelt die Ursachen des Stotterns und unterteilt diese in körperliche, emotionale und genetische Faktoren. Es beleuchtet die unterschiedlichen Aspekte, die zu Stottern führen können.
- Kapitel 5: Therapie
Dieser Abschnitt zeigt verschiedene Therapieansätze für Stottern auf und diskutiert ihre Wirksamkeit. Es werden unterschiedliche Therapieformen vorgestellt und deren Anwendungsgebiete erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Sprachstörungen, Redeflussstörungen, Stottern, Symptome, Diagnose, Ursachen, Therapie, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Sozialentwicklung, Sprechen, Sprechen lernen.
- Quote paper
- Friederike Feldmann (Author), 2017, Redeflussstörung Stottern. Erscheinungsformen, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367672