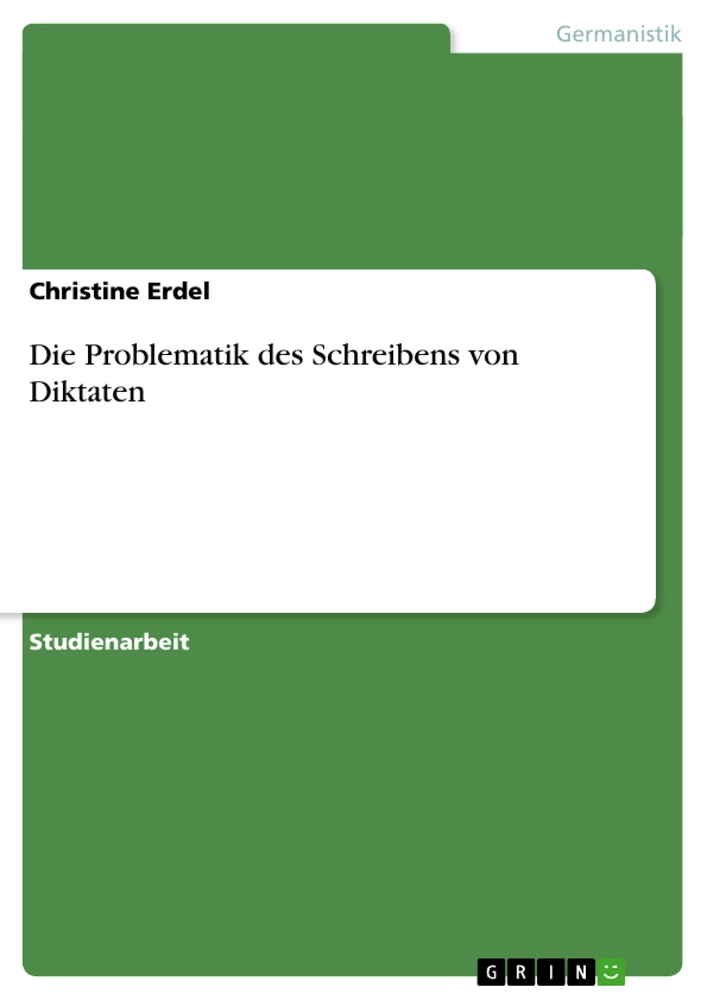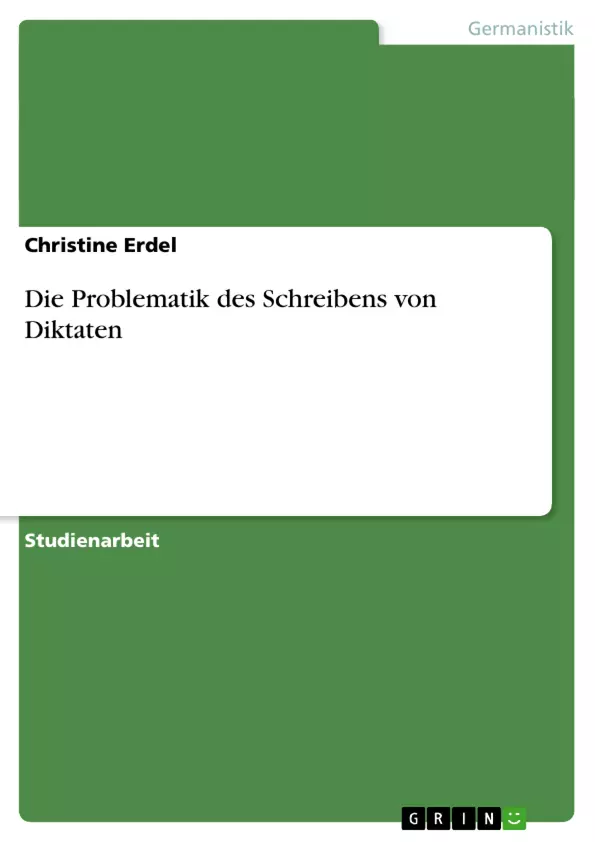[...] Schon seit 150 Jahren befassen sich Fachautoren auf kritische Art und Weise mit dem Diktat.2 Sowohl die Vor- als auch die Nachteile des Diktats wurden in vielen Aufsätzen ausführlich dargestellt. Immer noch ist das Diktat ein Reizthema, bei dem die Meinungen extrem auseinander gehen. Doch trotz der teilweise vehementen Kritik am Diktat, konnte es bis heute noch nicht wirklich aus dem Unterricht verbannt werden. Warum dies so ist, soll unter anderem in dieser Arbeit näher erläutert werden. Doch zunächst wird beschrieben, wie die Diktat-Praxis gegenwärtig in den meisten Fällen vonstatten geht und wie sie, im Gegensatz dazu, sein sollte. Anschließend werden die Probleme, die das Diktieren mit sich bringt, dargelegt. Danach wird, in Hinblick auf den Aspekt des Schwierigkeitsgrades, der Unterschied zwischen geübten und ungeübten Diktaten erläutert. Punkt vier und fünf widmen sich der Korrektur und der Benotung des Diktats. Dabei geht es um die Korrektur durch den Schüler, die Fehlerzählung durch die Lehrkraft und die Fehlermarkierung und Diktatberichtigung. Außerdem wird näher beleuchtet, was beurteilt und wie benotet wird. Bevor das Referat vorgetragen wurde, wurde in Gruppenarbeit nach Gründen gesucht, die gegen das Prüfungsdiktat sprechen. Viele der gefundenen Kritikpunkte können mithilfe der Fachliteratur bestätigt werden. Einige dieser Argumente werden in Punkt sechs aufgeführt. Wie bereits erwähnt, kommt das Diktat im Rechtschreibunterricht immer noch sehr häufig zum Einsatz. Punkt sieben befasst sich mit den Gründen dafür. Auf das herkömmliche Prüfungsdiktat sollte man möglichst verzichten, doch es sind bereits viele Alternativformen bekannt, die es sich lohnt, im Rechtschreibunterricht einzusetzen. Dazu gehören beispielsweise das Eigendiktat, das Partnerdiktat und das Zweistufendiktat. In Punkt neun werden notwendige Forderungen und sinnvolle Möglichkeiten hinsichtlich des Diktats vorgestellt. Abschließend wird anhand eines Praxisbeispiels gezeigt, wie man, auch mit Diktaten, selbstständig rechtschreiben üben kann. Dabei wird in erster Linie auf Alternativformen zum herkömmlichen Prüfungsdiktat zurückgegriffen. 2 Fix, Martin: Geschichte und Praxis des Diktats im Rechtschreibunterricht. Frankfurt/Main, 1994. S. 11
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Diktat-Praxis – wie sie gegenwärtig praktiziert wird und wie sie sein sollte
- Die Problematik des Diktierens
- Geübte und ungeübte Diktate
- Korrektur
- Korrektur durch den Schüler
- Fehlerzählung durch die Lehrkraft
- Fehlermarkierung und Diktatberichtigung
- Benotung
- Was wird beurteilt
- Wie wird benotet
- Kritik am Diktat
- Auswertung der Gruppenarbeit
- Argumente gegen das Prüfungsdiktat
- Gründe für die unveränderte Diktatpraxis
- Ursachen, die in den Anforderungen der Gesellschaft an die Schule zu suchen sind
- Ursachen, die in den Anforderungen der alltäglichen Unterrichtssituationen an die Lehrer begründet sind
- Alternativformen zum herkömmlichen Diktat
- Das Eigendiktat
- Das Partnerdiktat
- Das Zweistufendiktat
- Notwendige Forderungen und sinnvolle Möglichkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Problematik des Diktats im Rechtschreibunterricht der Grund- und Hauptschule. Sie beleuchtet die gegenwärtige Praxis des Diktats, die Kritik daran und die Gründe für seine anhaltende Präsenz im Unterricht. Darüber hinaus werden Alternativformen zum herkömmlichen Diktat vorgestellt und notwendige Forderungen für einen sinnvollen Einsatz von Diktaten formuliert.
- Kritik am herkömmlichen Prüfungsdiktat
- Gründe für den anhaltenden Einsatz von Diktaten
- Alternativformen zum Diktat
- Notwendige Forderungen für einen sinnvollen Diktateinsatz
- Praxisbeispiele für selbstständiges Rechtschreiben mit Diktaten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Diktats im Rechtschreibunterricht heraus und skizziert die Thematik der Arbeit.
- Diktat-Praxis: Dieses Kapitel beschreibt die gängige Praxis des Prüfungsdiktats und kritisiert den mangelnden Bezug zum Unterricht und den Einsatz unpassender Texte.
- Die Problematik des Diktierens: Hier werden die Schwierigkeiten beim Diktieren wie die künstliche Intonation und der fehlende Kontext beleuchtet.
- Geübte und ungeübte Diktate: Der Unterschied zwischen Diktaten mit und ohne vorheriger Übung wird erläutert.
- Korrektur: Die Korrektur durch den Schüler, die Fehlerzählung durch die Lehrkraft und die Fehlermarkierung werden detailliert dargestellt.
- Benotung: Dieses Kapitel behandelt die Kriterien für die Benotung von Diktaten.
- Kritik am Diktat: Die Kritik am Prüfungsdiktat aus verschiedenen Perspektiven wird zusammengefasst.
- Gründe für die unveränderte Diktatpraxis: Dieses Kapitel analysiert die Gründe für den anhaltenden Einsatz von Diktaten, sowohl aus gesellschaftlicher als auch aus schulischer Sicht.
- Alternativformen zum herkömmlichen Diktat: Verschiedene Alternativen wie das Eigendiktat, das Partnerdiktat und das Zweistufendiktat werden vorgestellt.
Schlüsselwörter
Rechtschreibunterricht, Diktat, Prüfungsdiktat, Übungsdiktat, Kritik am Diktat, Alternativformen, Eigendiktat, Partnerdiktat, Zweistufendiktat, Rechtschreiblernen, Grundwortschatz, Fehlerkorrektur, Benotung, Gesellschaftliche Anforderungen, Schulische Anforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird das Diktat im Unterricht oft kritisiert?
Kritikpunkte sind die künstliche Intonation, der fehlende Kontext und die Tatsache, dass Diktate eher die Rechtschreibung prüfen als sie zu lehren.
Welche Alternativen gibt es zum herkömmlichen Prüfungsdiktat?
Sinnvolle Alternativen sind das Eigendiktat, das Partnerdiktat und das Zweistufendiktat, die das selbstständige Lernen fördern.
Warum wird das Diktat trotz Kritik weiterhin häufig eingesetzt?
Gründe liegen in gesellschaftlichen Anforderungen an die Schule sowie in der einfachen Durchführbarkeit und Korrektur für Lehrkräfte im Alltag.
Was ist der Unterschied zwischen geübten und ungeübten Diktaten?
Geübte Diktate beziehen sich auf zuvor im Unterricht behandelte Wörter (Grundwortschatz), während ungeübte Diktate den aktuellen Leistungsstand ohne Vorbereitung testen.
Wie sollte eine sinnvolle Diktatkorrektur aussehen?
Eine effektive Korrektur sollte den Schüler einbeziehen (Selbstkorrektur) und Fehlermarkierungen nutzen, die zur eigenständigen Berichtigung anleiten.
- Arbeit zitieren
- Christine Erdel (Autor:in), 2004, Die Problematik des Schreibens von Diktaten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36776