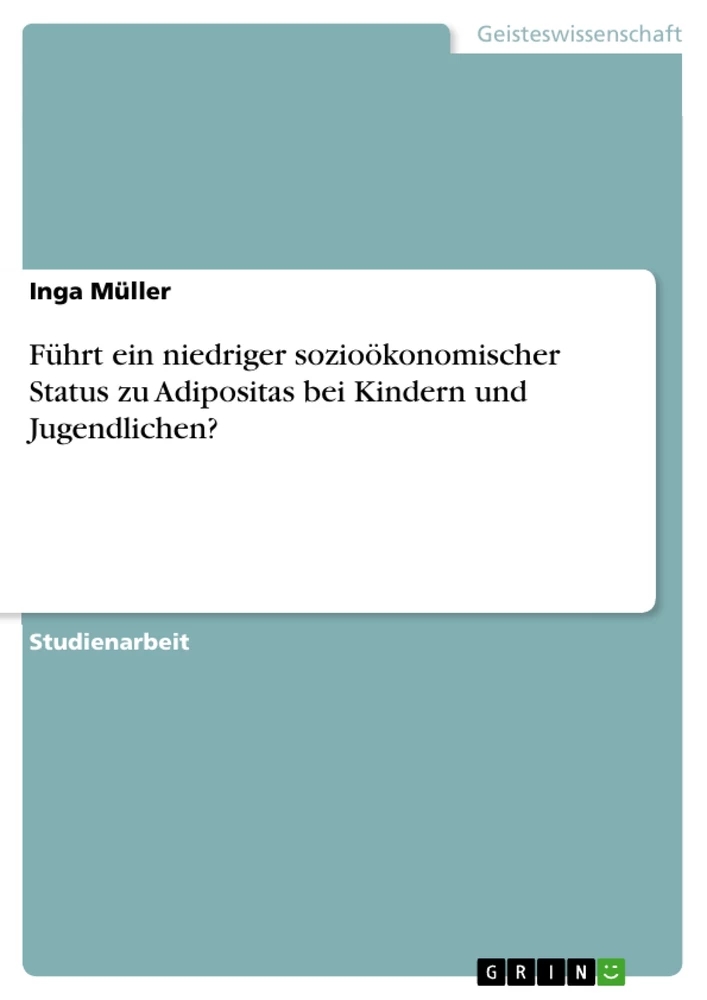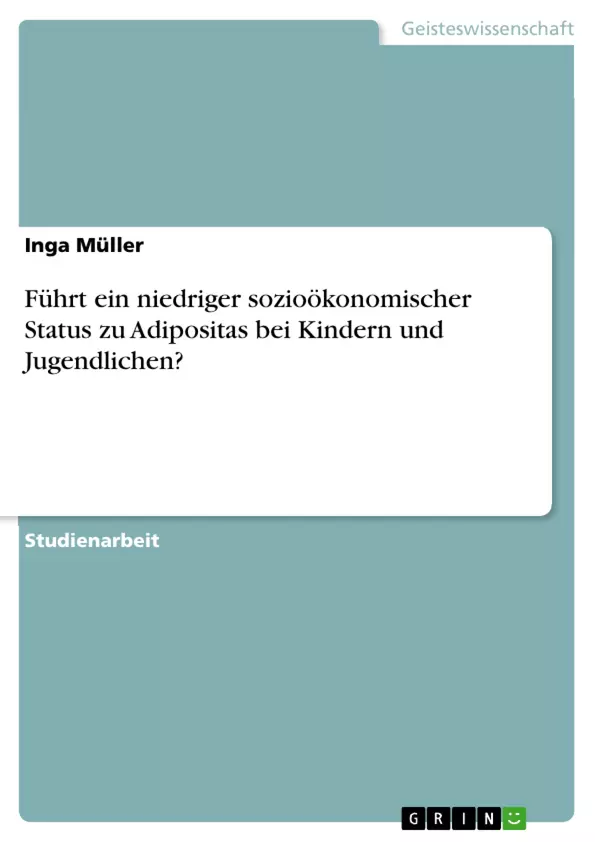Diese Hausarbeit hat das Ziel, der Frage nach dem Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Status und Übergewicht bzw. Adipositas bei Kindern und Jugendlichen nachzugehen. Als theoretische Grundlage wird hierzu Bourdieus Habituskonzept verwendet, das besagt, dass übermittelte Werteinstellungen und Überzeugungen basierend auf der Verteilung von materiellem, kulturellem und sozialem Kapital zu unterschiedlichen Lebensstilen führen. Daraus folgt die Hypothese, dass der Habitus für das Gesundheitsverhalten verantwortlich ist, materielle Faktoren allein hingegen weniger.
Bei der Analyse zweier Studien, die so einen Zusammenhang untersuchen, der deutschen Kieler Adipositas-Präventionsstudie (KOPS) aus dem Jahr 2010 und einer amerikanischen Studie von 1971 bis 2002 mit der gleichen Fragestellung, wird deutlich, dass das ökonomische Kapital allein tatsächlich wenig zur Assoziation von niedrigem SES und Adipositas beiträgt. Nur die Preise von gesunden Lebensmitteln oder Sportvereinen sind also nicht ausschlaggebend. Tatsächlich sind Lebensstilfaktoren wie ethnische Zugehörigkeit bzw. Nationalität, Wohnumgebung, Bildung der Eltern oder Lebensmittelangebot die Elemente, die eine größere Rolle spielen und somit vor allem Bestandteile des kulturellen Kapitals sind, die ein ungünstiges Gesundheitsverhalten bedingen.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Erklärung der Begriffe
- Sozioökonomischer Status
- Adipositas
- Theoretische Grundlage: Bourdieus Konzept des Habitus und der Raum der Lebensstile
- Präsentation von Studien
- Die Kieler Adipositas-Präventionsstudie
- Vorgehen
- Ergebnisse
- Diskussion
- Are American children and adolescents of low socioeconomic status at increased risk of obesity?
- Vorgehen
- Ergebnisse
- Diskussion
- Die Kieler Adipositas-Präventionsstudie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit nutzt Bourdieus Habituskonzept als theoretische Grundlage und analysiert zwei Studien, eine deutsche und eine amerikanische, um die Hypothese zu überprüfen, dass der Habitus, nicht nur materielle Faktoren, das Gesundheitsverhalten beeinflusst.
- Der Einfluss des sozioökonomischen Status auf Adipositas bei Kindern und Jugendlichen
- Die Rolle des Bourdieuschen Habituskonzepts bei der Erklärung von Gesundheitsverhalten
- Analyse und Vergleich deutscher und amerikanischer Studien zum Thema
- Bedeutung von kulturellem Kapital für das Ernährungs- und Bewegungsverhalten
- Identifikation relevanter Einflussfaktoren jenseits des reinen ökonomischen Kapitals
Zusammenfassung der Kapitel
Zusammenfassung: Diese Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Sie verwendet Bourdieus Habituskonzept als theoretische Grundlage und analysiert zwei Studien, um zu zeigen, dass ökonomisches Kapital allein wenig zur Assoziation von niedrigem SES und Adipositas beiträgt. Stattdessen spielen Lebensstilfaktoren wie ethnische Zugehörigkeit, Wohnumgebung und Bildung der Eltern eine größere Rolle, die vor allem Bestandteile des kulturellen Kapitals sind und ungünstiges Gesundheitsverhalten bedingen.
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert den Wandel des Schönheitsideals im Laufe der Zeit, von Korpulenz als Zeichen von Reichtum zu Schlankheit als Ideal in Wohlstandsgesellschaften. Sie stellt die Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen Armut, Ernährungsverhalten und Gesundheitsproblemen auf und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Definition wichtiger Begriffe, die theoretische Grundlage im Bourdieuschen Habituskonzept und die Präsentation und Analyse zweier Studien umfasst.
Erklärung der Begriffe: Dieser Abschnitt definiert die zentralen Begriffe "Sozioökonomischer Status" und "Adipositas", um Missverständnisse zu vermeiden und den Kontext der weiteren Analyse zu klären. Die Definitionen stellen die Basis für das Verständnis der folgenden Kapitel dar und verdeutlichen die Zusammenhänge zwischen sozioökonomischem Status und Gesundheit im Allgemeinen.
Theoretische Grundlage: Bourdieus Konzept des Habitus und der Raum der Lebensstile: Dieses Kapitel beschreibt Bourdieus Habituskonzept und seine Relevanz für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen sozioökonomischem Status und Gesundheitsverhalten. Es legt dar, wie verinnerlichte Werte und Überzeugungen, basierend auf der Verteilung von materiellem, kulturellem und sozialem Kapital, zu unterschiedlichen Lebensstilen und somit zu unterschiedlichem Gesundheitsverhalten führen.
Präsentation von Studien: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert zwei Studien: die Kieler Adipositas-Präventionsstudie (KOPS) und eine amerikanische Studie. Die Analyse konzentriert sich auf die Ergebnisse und diskutiert deren Implikationen für die Forschungsfrage. Der Vergleich beider Studien erlaubt es, über die Grenzen einzelner Studienansätze hinaus generalisierbarere Aussagen zu treffen.
Schlüsselwörter
Sozioökonomischer Status, Adipositas, Kinder, Jugendliche, Gesundheitsverhalten, Bourdieu, Habitus, kulturelles Kapital, Lebensstil, Ernährung, Studienanalyse, Prävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Sozioökonomischer Status und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status (SES) und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Sie analysiert, inwieweit der SES und insbesondere der Bourdieusche Habitus das Gesundheitsverhalten und damit das Risiko für Adipositas beeinflussen.
Welche theoretische Grundlage wird verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Pierre Bourdieus Konzept des Habitus und des Raumes der Lebensstile. Der Habitus beschreibt verinnerlichte Werte und Überzeugungen, die durch die Verteilung von materiellem, kulturellem und sozialem Kapital geprägt werden und das Gesundheitsverhalten beeinflussen.
Welche Studien werden analysiert?
Die Hausarbeit analysiert zwei Studien: die Kieler Adipositas-Präventionsstudie (KOPS) und eine weitere amerikanische Studie. Der Vergleich dieser Studien soll generalisierbare Aussagen ermöglichen.
Welche Schlüsselfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des SES auf Adipositas, die Rolle des Bourdieuschen Habituskonzepts, den Vergleich deutscher und amerikanischer Studien, die Bedeutung kulturellen Kapitals für Ernährungs- und Bewegungsverhalten und die Identifikation relevanter Einflussfaktoren jenseits des ökonomischen Kapitals.
Wie wird der sozioökonomische Status definiert?
Die Hausarbeit definiert den sozioökonomischen Status (SES) und den Begriff "Adipositas" explizit, um Missverständnisse zu vermeiden und den Kontext der Analyse zu klären. Die Definitionen bilden die Basis für das Verständnis der weiteren Analyse.
Welche Ergebnisse liefern die analysierten Studien?
Die Analyse der Studien konzentriert sich auf die Ergebnisse und deren Implikationen für die Forschungsfrage. Die Hausarbeit diskutiert die Ergebnisse der Kieler Adipositas-Präventionsstudie (KOPS) und der amerikanischen Studie und vergleicht diese.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Die Hausarbeit kommt zu dem Schluss, dass ökonomisches Kapital allein wenig zur Assoziation von niedrigem SES und Adipositas beiträgt. Stattdessen spielen Lebensstilfaktoren wie ethnische Zugehörigkeit, Wohnumgebung und Bildung der Eltern (kulturelles Kapital) eine größere Rolle und bedingen ungünstiges Gesundheitsverhalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sozioökonomischer Status, Adipositas, Kinder, Jugendliche, Gesundheitsverhalten, Bourdieu, Habitus, kulturelles Kapital, Lebensstil, Ernährung, Studienanalyse, Prävention.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Zusammenfassung, Einleitung, Erklärung der Begriffe (Sozioökonomischer Status und Adipositas), die theoretische Grundlage (Bourdieus Habituskonzept), die Präsentation und Analyse von Studien (KOPS und eine amerikanische Studie) und ein Fazit.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen im Bereich Soziologie und Gesundheitswissenschaften.
- Quote paper
- Inga Müller (Author), 2017, Führt ein niedriger sozioökonomischer Status zu Adipositas bei Kindern und Jugendlichen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367928