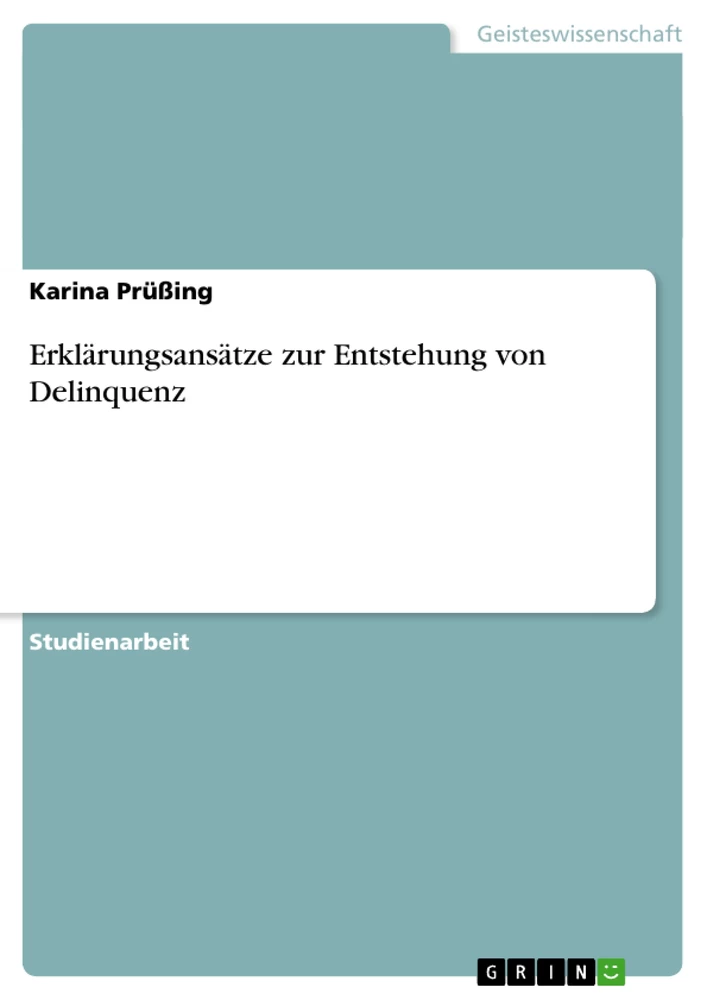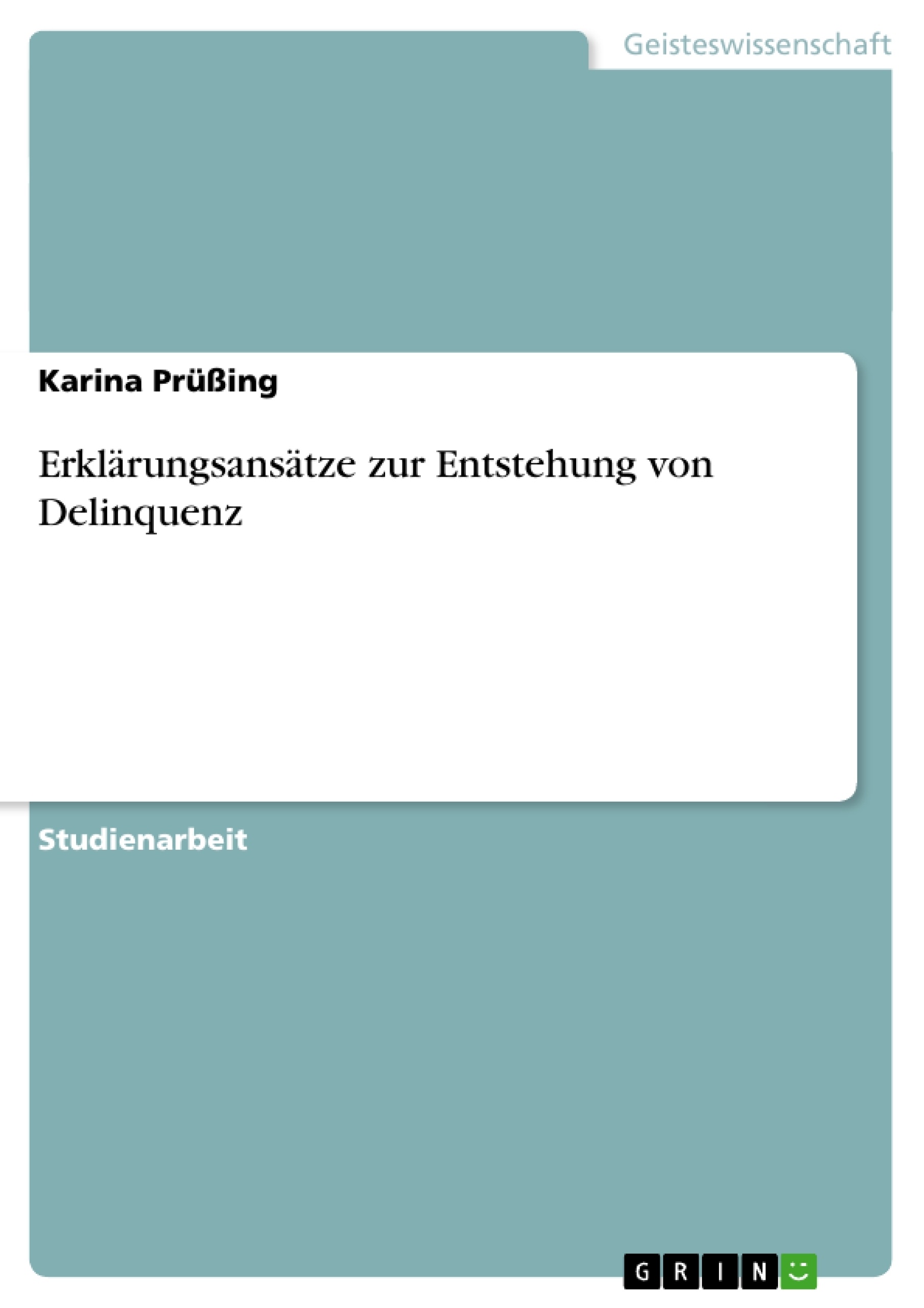Die Darstellung von Kriminalität in den Medien vermittelt oft den Eindruck, dass die Anzahl von Straftaten stetig zunimmt. Im Ergebnis verlangt die Öffentlichkeit nach mehr Härte im Umgang mit Straftätern. Dies wird zunehmend in der Politik aufgegriffen. Ein besonders deutliches Beispiel ist die rechtspopulistische Schill-Partei in Hamburg, die sich im letzten Wahlkampf durch Aufrufe zu einer Wiederherstellung der Inneren Sicherheit durch ein härteres Vorgehen gegen Kriminalität positioniert hat. Die Partei propagiert in ihrem Programm härtere Strafen für Kleindelikte und Jugendkriminalität, sowie einen Vorrang der Bestrafung vor Resozialisierungsmaßnahmen. Die Lösung für das Problem wird des weiteren im Ausbau von Polizei und Justiz gesehen. Dabei findet jedoch keine tiefergehende Auseinandersetzung mit den eigentlichen Ursachen für die Entstehung von Kriminalität statt. Ohne Kenntnisse solcher Art können jedoch keine wirksamen Gegenstrategien oder Präventivmaßnahmen entwickelt werden.
Von großer Bedeutung sind diese Kenntnisse vor allem für Arbeitsbereiche der sozialen Kontrolle, z. B. Sozialarbeit, Polizei, Justiz. Während Polizei und Justiz eingreifen, nachdem Straftaten begangen worden sind, kann man mit Hilfe sozialpädagogischer Tätigkeit schon im Vorfeld eines Deliktes eingreifen. Besonders in der Bewährungshilfe ist es von Bedeutung, an der Verhinderung weiterer Straftaten mitzuwirken. In meiner Arbeit geht es darum, anhand verschiedener theoretischer Erklärungsansätze aus Psychologie und Soziologie herauszufinden, wie dem Problem der Kriminalität in der Bewährungshilfe begegnet werden kann. Ich werde dazu nach einer kurzen Besprechung der zentralen Begriffe ausgewählte Theorien zur Erklärung delinquenten Verhaltens anhand beispielhafter Vertreter diskutieren und in Hinsicht auf ihre Bedeutung für die Bewährungshilfe bewerten.
Von der Vielzahl der vorhandenen Erklärungsansätze werde ich solche untersuchen, die Erklärungen für die Entstehung von Kriminalität in der Persönlichkeit des Menschen suchen (Psychologische Theorien) und solche, die sich mit dem Einfluss gesellschaftlicher Strukturen und Abläufe auf Individuen befassen (Soziologische Theorien).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Problemaufriss
- 1.2 Definitionen zentraler Begriffe
- 2 Erklärungsansätze zur Entstehung delinquenten Verhaltens: Psychologische Theorien
- 2.1 Lerntheorien
- 2.1.1 Skinners Theorie der operanten Konditionierung (1938)
- 2.1.2 Eysenck (1964, 1970) Gewissen als konditionierte Angstreaktion
- 2.1.3 Sutherland: Theorie des differentiellen Lernens (1939)
- 2.1.4 Die sozial-kognitive Lerntheorie von Bandura (Aggressionstheorie)
- 2.1.5 Die Bedeutung der Lerntheorien für die Praxis der Bewährungshilfe
- 2.2 Sonstige Persönlichkeitstheorien
- 2.2.1 Das Konzept der Selbstkontrolle nach Godfredson und Hirschi (1990)
- 2.2.2 Psychoanalytische Theorien
- 2.2.3 Entwicklungspsychologische Kognitionstheorien: Die Sozial-Moralische Entwicklung nach Kohlberg (1958)
- 2.2.4 Die Bedeutung der sonstigen psychologischen Erklärungsansätze für die Praxis der Bewährungshilfe
- 3 Erklärungsansätze zur Entstehung delinquenten Verhaltens: Soziologische Theorien
- 3.1 Anomietheorie
- Exkurs: Die Subkulturtheorie
- 3.2 Labeling Approach
- 3.3 Die Bedeutung der soziologischen Erklärungsansätze für die Praxis der Bewährungshilfe
- 4 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht verschiedene theoretische Erklärungsansätze aus Psychologie und Soziologie zur Entstehung von Delinquenz, um daraus Schlussfolgerungen für die Praxis der Bewährungshilfe abzuleiten. Ziel ist es, wirksame Gegenstrategien und Präventivmaßnahmen zu entwickeln.
- Psychologische Erklärungsansätze (Lerntheorien, Persönlichkeitstheorien)
- Soziologische Erklärungsansätze (Anomietheorie, Subkulturtheorie, Labeling Approach)
- Bedeutung der Theorien für die Bewährungshilfe
- Definition und Abgrenzung zentraler Begriffe (abweichendes Verhalten, Delinquenz, Kriminalität)
- Analyse der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Kriminalität und deren Auswirkungen auf Politik und Öffentlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftliche Wahrnehmung von Kriminalität, insbesondere die medial vermittelte Darstellung steigender Kriminalitätsraten und die daraus resultierende Forderung nach härteren Strafen. Es wird der Fokus auf die rechtspopulistische Schill-Partei in Hamburg gelegt, welche ein härteres Vorgehen gegen Kriminalität propagiert, ohne sich tiefgreifend mit den Ursachen auseinanderzusetzen. Die Bedeutung der Kenntnis dieser Ursachen für die Entwicklung wirksamer Gegenstrategien, besonders im Kontext der Bewährungshilfe, wird hervorgehoben. Die Arbeit selbst wird als Versuch vorgestellt, anhand psychologischer und soziologischer Erklärungsansätze, wirksame Wege zur Kriminalitätsprävention in der Bewährungshilfe zu finden.
2 Erklärungsansätze zur Entstehung delinquenten Verhaltens: Psychologische Theorien: Dieses Kapitel untersucht psychologische Theorien, die die Ursachen für delinquentes Verhalten in der Persönlichkeit des Individuums verorten. Im Gegensatz zu soziologischen Ansätzen werden gesellschaftliche Einflüsse weitgehend ausgeklammert. Es werden verschiedene Theorien vorgestellt, die unterschiedliche Aspekte der menschlichen Psyche betrachten, darunter Lerntheorien, welche das Erlernen kriminellen Verhaltens durch Verstärkung und Konditionierung erklären, und andere Persönlichkeitstheorien, die Faktoren wie Selbstkontrolle und moralische Entwicklung in den Fokus rücken. Das Kapitel analysiert verschiedene Vertreter dieser Ansätze, um zu zeigen, wie individuelles Verhalten durch die Interaktion mit der Umwelt geformt wird und wie diese Erkenntnisse in der Bewährungshilfe angewendet werden können.
3 Erklärungsansätze zur Entstehung delinquenten Verhaltens: Soziologische Theorien: Dieses Kapitel befasst sich mit soziologischen Erklärungsansätzen, die die Entstehung delinquenten Verhaltens in gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen verorten. Im Gegensatz zu den psychologischen Ansätzen des vorherigen Kapitels wird der Fokus hier auf den Einfluss von sozialen Faktoren gelegt. Die Anomietheorie, die Subkulturtheorie und der Labeling Approach werden als Beispiele für soziologische Erklärungsmodelle diskutiert. Die jeweiligen Theorien werden im Detail erklärt und anhand von Beispielen erläutert, um die jeweiligen Mechanismen und deren Relevanz für das Verständnis und die Bekämpfung von Kriminalität zu verdeutlichen. Es wird analysiert, inwiefern diese Ansätze ein Verständnis der Entstehung von Kriminalität liefern und wie sie in der Praxis der Bewährungshilfe nutzbringend eingesetzt werden können.
Schlüsselwörter
Delinquenz, Kriminalität, abweichendes Verhalten, Lerntheorien, operante Konditionierung, soziale Kontrolle, Bewährungshilfe, Soziologische Theorien, Anomietheorie, Subkulturtheorie, Labeling Approach, Prävention, Resozialisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Erklärungsansätze zur Entstehung delinquenten Verhaltens
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht verschiedene theoretische Erklärungsansätze aus Psychologie und Soziologie zur Entstehung von Delinquenz. Ziel ist es, daraus Schlussfolgerungen für die Praxis der Bewährungshilfe abzuleiten und wirksame Gegenstrategien und Präventivmaßnahmen zu entwickeln. Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftliche Wahrnehmung von Kriminalität und deren medial vermittelte Darstellung, insbesondere im Kontext rechtspopulistischer Parteien wie der Schill-Partei in Hamburg.
Welche psychologischen Erklärungsansätze werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Lerntheorien (Skinner, Eysenck, Sutherland, Bandura) und weitere Persönlichkeitstheorien. Diese umfassen das Konzept der Selbstkontrolle nach Godfredson und Hirschi, psychoanalytische Theorien sowie entwicklungspsychologische Kognitionstheorien nach Kohlberg. Der Fokus liegt auf der Erklärung delinquenten Verhaltens durch individuelle Persönlichkeitsmerkmale und deren Interaktion mit der Umwelt.
Welche soziologischen Erklärungsansätze werden behandelt?
Die Arbeit untersucht soziologische Erklärungsansätze, die die Entstehung delinquenten Verhaltens in gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen verorten. Hierzu gehören die Anomietheorie, die Subkulturtheorie und der Labeling Approach. Der Fokus liegt auf dem Einfluss sozialer Faktoren auf das Entstehen von Delinquenz.
Welche Bedeutung haben die Theorien für die Bewährungshilfe?
Die Arbeit analysiert die Bedeutung der vorgestellten psychologischen und soziologischen Theorien für die Praxis der Bewährungshilfe. Es wird untersucht, wie die Erkenntnisse aus diesen Theorien zur Entwicklung wirksamer Präventions- und Resozialisierungsmaßnahmen beitragen können.
Welche zentralen Begriffe werden definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit definiert und grenzt zentrale Begriffe wie abweichendes Verhalten, Delinquenz und Kriminalität voneinander ab. Sie analysiert auch die gesellschaftliche Wahrnehmung von Kriminalität und deren Auswirkungen auf Politik und Öffentlichkeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, Kapitel zu psychologischen und soziologischen Erklärungsansätzen, eine Zusammenfassung und einen Ausblick. Sie enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit Unterpunkten und eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Delinquenz, Kriminalität, abweichendes Verhalten, Lerntheorien, operante Konditionierung, soziale Kontrolle, Bewährungshilfe, Soziologische Theorien, Anomietheorie, Subkulturtheorie, Labeling Approach, Prävention, Resozialisierung.
- Arbeit zitieren
- Karina Prüßing (Autor:in), 2003, Erklärungsansätze zur Entstehung von Delinquenz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36813