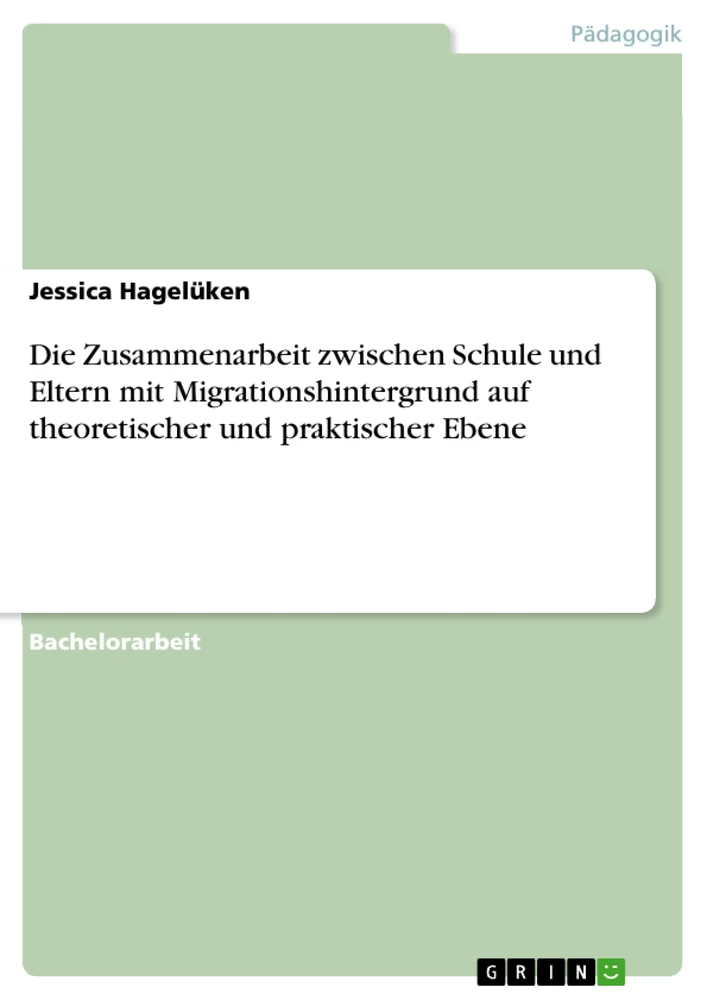Das Ziel dieser Arbeit ist es, anhand einschlägiger Fachliteratur den aktuellen Stand der Forschung in der Zusammenarbeit von Schule und Eltern mit Migrationshintergrund herauszuarbeiten. Basierend auf diesem theoretischen Vorgehen werden die Erkenntnisse anschließend durch qualitative Forschungsergebnisse mit der Praxis verglichen. Es sollen sowohl Möglichkeiten als auch Herausforderungen und Grenzen dieser Form der Kooperation sichtbar werden, um abschließende Handlungsempfehlungen für eine gelingende Elternarbeit aussprechen zu können.
Der Begriff der Interkulturalität beinhaltet das Wort 'Kultur', mit welchem eine besondere oder distinkte Lebensweise einer Gruppe in Bezug auf Werte, Sitten und Bräuche in Institutionen, Gesellschaftsbeziehungen, Glaubenssystemen oder auch im materiellen Leben als „Landkarten der Bedeutung“ Ausdruck findet, welches den Menschen zu einem gesellschaftlichen Individuum werden lässt. Clarke et al. betonen, dass Menschen durch Kultur, Gesellschaft und Geschichte geformt werden und sich selbst formen. „So bilden die bestehenden kulturellen Muster eine Art historisches Reservoir - ein vorab konstituiertes 'Feld der Möglichkeiten' -, das die Gruppen aufgreifen, transformieren und weiterentwickeln“. Mit der Annahme, dass sich verschiedene Kulturen durch andere Lebensweisen unterscheiden, wird interkulturelle Verschiedenheit zur Erklärung für Missverständnisse und Konflikte herangezogen. Ausgehend von dieser Annahme wird eine Wissensvermittlung über kulturelle Andersartigkeit und die daraus resultierenden Konflikte vermieden sowie eine generelle Homogenität aller Kulturen als geschlossenes Gebilde angenommen, welches ein Bestehen von Subkulturen innerhalb einer Region ausschließt. Von besonderer Wichtigkeit ist es daher, eindimensionale (Alltags-)Betrachtungsweisen dieser Begrifflichkeit einer Kritik zu unterziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielformulierung der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Begriffsdefinitionen
- Interkulturalität
- Der Gleichheitsdiskurs
- Das Anerkennungskonzept
- Die transkulturelle Erziehung
- Das Recht auf Differenz
- Migration und Migrationshintergrund
- Eltern und Familie
- Elternarbeit
- Interkulturalität
- Theoretische Rahmung
- Community Education
- John Deweys Konzept der demokratischen Erziehung
- Theorie der Schule nach Helmut Fend
- Bedeutung der Elternarbeit an Schulen
- Bildungsbenachteiligung von Migrantinnen und Migranten
- Zum Potential der Elternarbeit an Schulen
- Umsetzung einer Zusammenarbeit von Eltern und Schule
- Zielsetzung einer gelingenden Elternarbeit
- Formen der Elternarbeit
- Elternsprechstunde
- Hausbesuch
- Thematische Elternabende
- Eltern-Lehrkräfte-Treffs
- Zusammenarbeit zwischen Schule, Familie und Region
- Möglichkeiten der Zusammenarbeit
- Anerkennung des Rechts auf Differenz
- Verbesserung des Klimas eines Willkommen seins
- Förderung der Berufsorientierung
- Herausforderungen und Grenzen
- Strukturelle und institutionelle Schwierigkeiten
- Kulturelle und sprachliche Barrieren
- Bildungshintergrund der Eltern
- Möglichkeiten der Zusammenarbeit
- Konzeption und Methodik der empirischen Untersuchung
- Darlegung der empirischen Methoden
- Kategorienbildung
- Feldzugang
- Darstellung der empirischen Ergebnisse
- Ergebnisse der Lehrkräfteinterviews
- Darstellung der Ergebnisse der Elterninterviews
- Handlungsempfehlungen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Zusammenarbeit zwischen Schule und Familien mit Migrationshintergrund und untersucht, wie diese effektiv gestaltet werden kann, um Verunsicherungen zu minimieren und die Erziehungsverantwortung beider Seiten zu stärken. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, den Schulerfolg und die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern.
- Interkulturalität und ihre verschiedenen Deutungszugänge
- Bildungsbenachteiligung von Migrantinnen und Migranten
- Das Potential der Elternarbeit an Schulen
- Herausforderungen und Grenzen einer interkulturellen Elternarbeit
- Möglichkeiten einer gelingenden Zusammenarbeit zwischen Schule, Familie und Region
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik der interkulturellen Elternarbeit ein und erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die aus dem zunehmenden Migrationshintergrund und den daraus resultierenden Veränderungen in der Gesellschaft für die Bildungspraxis entstehen.
- Der erste Teil der Arbeit widmet sich der begrifflichen Klärung von zentralen Begriffen wie Interkulturalität, Migration, Familie und Elternarbeit. Er beleuchtet verschiedene Diskurse und Konzepte, die zur Einordnung der Thematik beitragen.
- Im dritten Kapitel wird die theoretische Rahmung der Arbeit erläutert. Dabei werden verschiedene Konzepte wie Community Education, John Deweys demokratische Erziehung und die Theorie der Schule nach Helmut Fend vorgestellt.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Elternarbeit an Schulen. Hier werden die Herausforderungen der Bildungsbenachteiligung von Migrantinnen und Migranten und das Potenzial der Elternarbeit zur Verbesserung des Schulerfolgs beleuchtet.
- Kapitel fünf widmet sich der Umsetzung einer Zusammenarbeit von Eltern und Schule. Hier werden die Ziele einer gelingenden Elternarbeit sowie verschiedene Formen der Elternarbeit vorgestellt und diskutiert.
- Das sechste Kapitel beleuchtet die Zusammenarbeit zwischen Schule, Familie und Region. Es analysiert die Möglichkeiten der Zusammenarbeit, aber auch die Herausforderungen und Grenzen, die sich in diesem Kontext ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der interkulturellen Elternarbeit, Bildungsgerechtigkeit, Bildungsbenachteiligung, Migration, Schulerfolg, Familie, Elternarbeit, Community Education, Kooperation, Herausforderungen und Grenzen, Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
- Citation du texte
- Jessica Hagelüken (Auteur), 2015, Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern mit Migrationshintergrund auf theoretischer und praktischer Ebene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368140