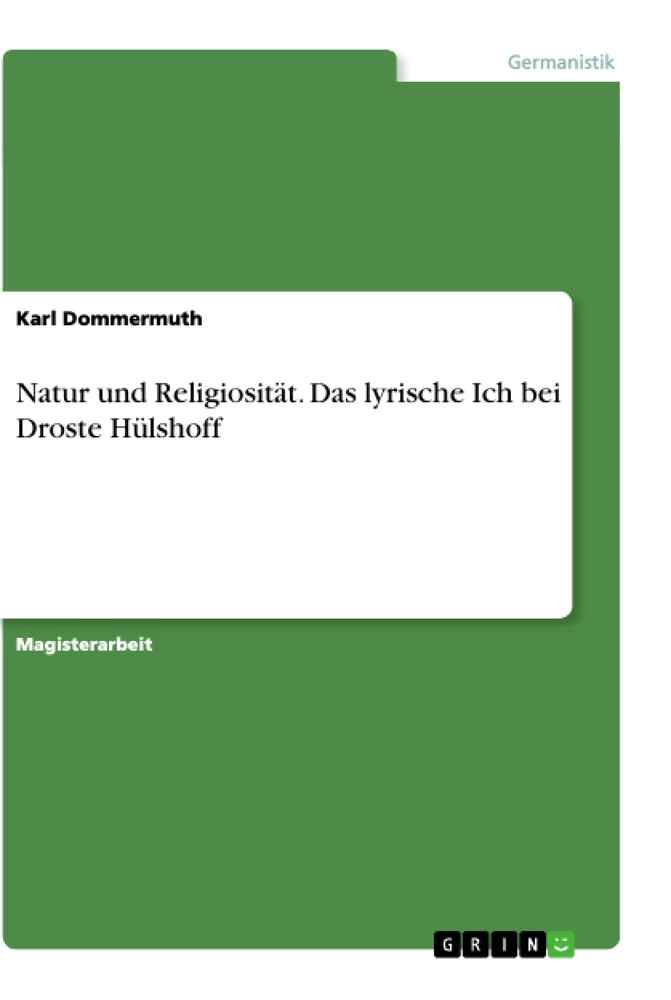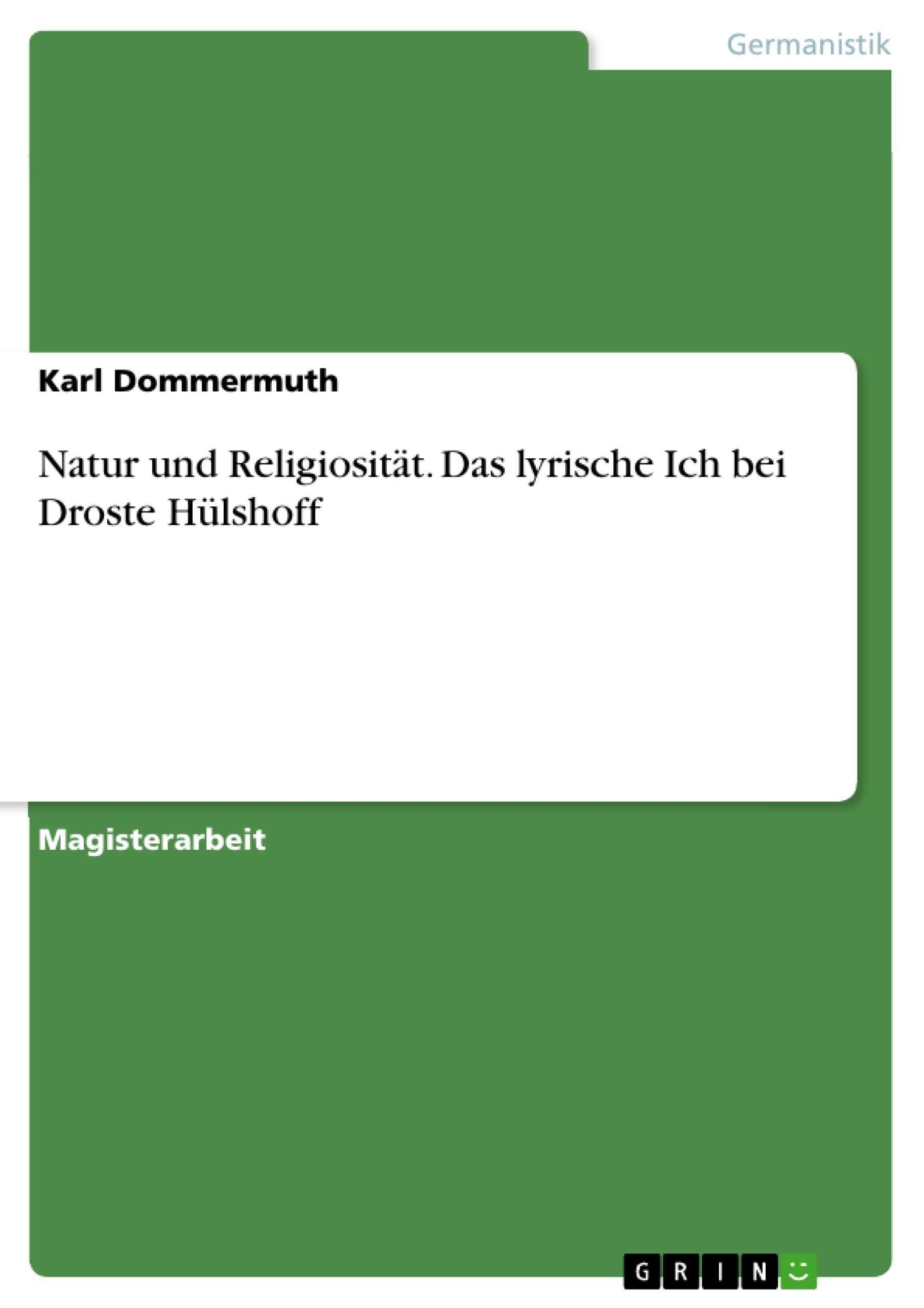‘Natur und Religiosität als Konstituenten eines lyrischen Ich’ behauptet zum einen die Vertrautheit dieses lyrischen Ich mit dem Gegenstand Natur, benennt aber auch die vorherrschende Weise, Gegenstände überhaupt zu setzen, nämlich grundsätzlich religiös gestimmt. Die genauere Klärung dieser Verhältnisse legt es nahe, sich nicht auf die Gegenstände aus ‘Natur’ allein zu konzentrieren – obwohl dieser Weg durchaus gangbar wäre.
Es bietet sich statt dessen an, zeitlich relativ nahe verfaßte Werke aus beiden Schaffensbereichen gegeneinander zu stellen, so daß einesteils die Ausrichtung des lyrischen Ich in umfassender Form sich darbietet, andererseits eine gewisse Kontinuität des Autorenbewußtseins vorausgesetzt werden kann.
Als erster Schritt in die Materie ist eine erste Lesung der späten geistlichen Gedichte Das verlorene Paradies, Die ächzende Kreatur und Gethsemane vorgesehen. Hauptanliegen dieser ersten Betrachtung ist die Herausarbeitung der Funktionen, die ‘Natur’ für das lyrische Ich dieser Texte erfüllt. Diesem Arbeitsgang fügt sich die Lesung einiger Gedichte aus dem Zyklus der HEIDEBILDER an, die sich unserem Thema gegenüber als die ergiebigsten ausweisen.
Der Übergang von Lektüre eins zu zwei wird dann eingehende Überlegungen fordern hinsichtlich des methodischen Problems, inwieweit eine Aussage über zwei thematisch und bezüglich des Geltungsanspruchs der Dichtung so unterschiedliche Bereiche möglich ist. Für den Fall einer methodisch unbedenklichen Beziehbarkeit der beiden Lyrikbereiche sollte es dann auch gelingen, auf der Grundlage dieser kleinen Textbasis eine für beide Bereiche verwertbare Modellvorstellung des lyrischen Ich im Schaffen der Droste zu erstellen.
Ein solches Modell verdankt sich dann sowohl einer wechselseitigen Durchdringung zweier lyrischer Bereiche mittels beide verbindendem lyrischen Ich als auch einem Wechsel von induktiver und deduktiver Zugangsweise derart, daß die sich aus den Textbetrachtungen ergebenden vorläufigen Ergebnisse sich in die jeweils folgende Betrachtung als Hypothesen einbringen und dort ihre Bestätigungen erwarten. Das Ergebnis dieser Arbeit begreift sich demnach als ‘Steigerung’, deren Ziel der intensivierte Blick auf die Textphänomene bei der Droste sein soll.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes?
Der Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Der Text analysiert die Themen "Natur und Religiosität als Konstituenten eines lyrischen Ich" im Werk von Annette von Droste-Hülshoff, insbesondere in ihren geistlichen Gedichten und Heidebildern.
Was sind die wichtigsten Punkte des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte:
- Zur Vorgehensweise
- Erste Lektüre der GEISTLICHEN GEDICHTE
- Das verlorene Paradies
- Die ächzende Kreatur
- Gethsemane
- Die religiösen Voraussetzungen der Droste
- Methodische Überlegungen zur Beziehbarkeit von Naturlyrik und geistlicher Lyrik
- Betrachtung ausgewählter Gedichte aus HEIDEBILDER
- Der Hünenstein
- Die Mergelgrube
- Der Knabe im Moor
- Die Krähen
- Zusammenfassung und Rückbezug auf die geistliche Lyrik
- Das Modell
- Bibliographie (Primär- und Sekundärliteratur)
Welche methodischen Überlegungen werden angestellt?
Der Text behandelt die methodischen Herausforderungen bei der Analyse von Naturlyrik und geistlicher Lyrik im Zusammenhang mit Droste-Hülshoffs Werk. Es wird diskutiert, wie eine Aussage über thematisch und in Bezug auf den Geltungsanspruch der Dichtung so unterschiedliche Bereiche möglich ist.
Welche Gedichte aus den "Heidebildern" werden betrachtet?
Die ausgewählten Gedichte aus den "Heidebildern" sind:
- Der Hünenstein
- Die Mergelgrube
- Der Knabe im Moor
- Die Krähen
Was ist das vorgeschlagene Modell zur Analyse von Annette von Droste-Hülshoffs Werk?
Das vorgeschlagene Modell zielt darauf ab, eine für beide Bereiche (geistliche Lyrik und Naturlyrik) verwertbare Vorstellung des lyrischen Ich im Schaffen der Droste zu erstellen. Das Modell beruht auf einer wechselseitigen Durchdringung zweier lyrischer Bereiche durch ein verbindendes lyrisches Ich, sowie auf einem Wechsel von induktiver und deduktiver Zugangsweise.
Welche zentralen Punkte werden in der einleitenden "Vorgehensweise" vorgestellt?
Die einleitende Vorgehensweise legt Wert darauf, den Begriff des lyrischen Ichs zu definieren und die Verknüpfung von Natur und Religiosität in Drostes Werk zu analysieren. Es wird betont, dass der Fokus auf dem "Wie" der Verknüpfung beider Komponenten liegen soll und eine Abgrenzung zu biographischen Interpretationen stattfindet. Eine Definition von "Lyrisches Ich" wird vorgestellt unter Bezugnahme auf Hegel, Iser und Ingarden.
- Arbeit zitieren
- Karl Dommermuth (Autor:in), 1990, Natur und Religiosität. Das lyrische Ich bei Droste Hülshoff, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368192